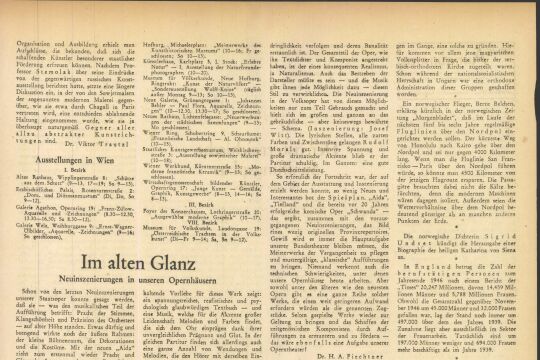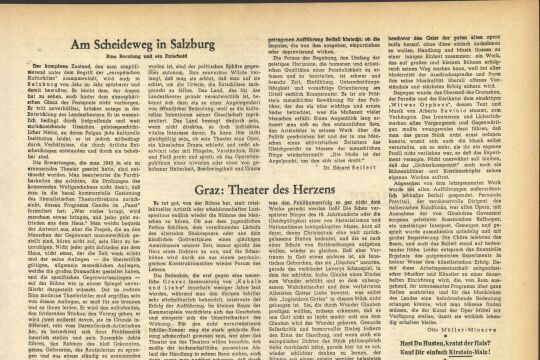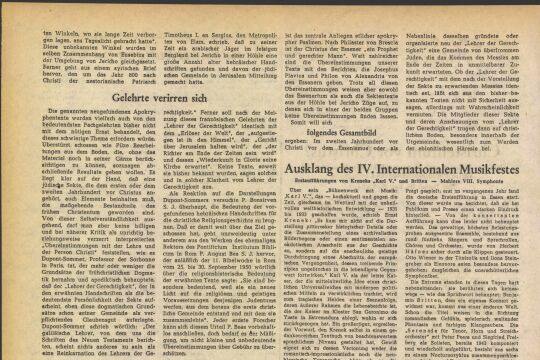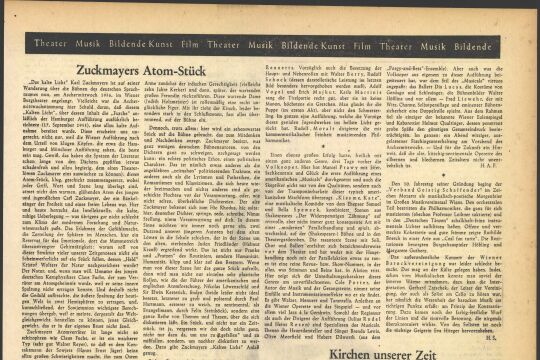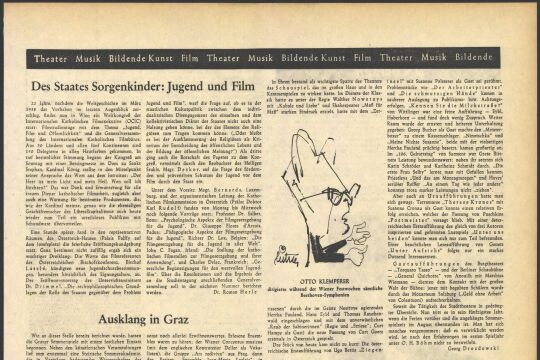Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Man spielt Menotti
Im Alphabet der Opernkomponisten steht der Name Menotti zwischen Mascagni und Meyerbeer. Zufall? Schicksal? Zumindest ein symbolischer Hinweis. Der 1911 in Cadegliano geborene Gian-Carlo verbringt einen Teil seiner Jugend in Mailand und empfängt von der dortigen Oper entscheidende Eindrücke. Aber noch wählend seiner Studienzeit übersiedeln seine EltecKiftath “‘Amerika, wo-er wtitär-ausge- bildete snjtWÜ SeinemLmenschlięlleįi. künstlerischen Naturell nach ist er ein später Nachfahre des italienischen Verismo Puccinischer und Mascagnischer Prägung. In den USA erlernte er das Handwerk, den wirkungssicheren Effekt.
Trotzdem wäre es falsch und ungerecht, in Menotti nur einen brutal auf Effekt und Erfolg lossteuernden Theatermenschen zu sehen. Seine rhetorische Anklage der Zeit und sein Mitleidspathos sind ebenso echt wie die oft unerträgliche Sentimentalität. Das gleiche gilt von seiner Musik. Sie untermalt und akzentuiert die Aktionen und charakterisiert Personen seiner (selbstverfaßten) Libretti so selbstverständlich und suggestiv wie eine gute Filmmusik. Sie ist von der gleichen stilistischen und qualitativen Unbekümmertheit wie die Kinomusik. Und sie wurde trotzdem nicht nur um des Effektes willen geschrieben — und s o geschrieben. Auch als Musiker ist Menotti naiv (wenn auch nicht unbelesen und unversiert), und diese Naivität spricht ein großes Publikum an. Seine Opern, vor allem „Der Konsul” von 1950, füllen die Häuser, während Kritiker und sensiblere Musikfreunde die Nase rümpfen. Aber das tun sie bei Meyerbeer (und beim Gefangenenchor aus „Nabucco”) ja auch Was nämlich Menottis musikalische Sprache betrifft, so gibt es darin kaum ein neues Wort. Und die Kunstform Oper ist durch sein Schaffen nicht um einen Schritt weitergebracht worden. Zumindest nicht mit den Werken seines „ernsten” Genres, dem „Konsul”, dem „Medium” und der „Heiligen von der Blacker Street”.
Aber Menottis Talent betätigt sich noch auf einem anderen Gebiet, dem der Buffa, die am stärksten von Wolf-Ferrari inspiriert scheint. Hierher gehören „Amelia geht zum Ball”, „Das Telephon” und „Die alte Jungfer und der Dieb”. Dazwischen steht das Dreikönigsspiel „Amahl und die nächtlichen Besucher”, die alljährliche Attraktion des amerikanischen Fernsehens.
In Wien waren alle genannten Werke zu sehen. Diese Ehre ist sonst keinem ‘zBftgenŽssisch’ėn Koiftįfžmistfeįi tffderfah- fen. Uhd’ das scheint’ins zuviel de Me- nowfr!Ktiltr,’lÄnd “de -’küliSflMlschettKonformismus. Immerhin ist „Die alte Jungfer und der Dieb” (der Titel erschöpft den Inljalt des knapp einstündi- gen Einakters vollkommen) eine nette Unterhaltung. Unter der feinen und einfallsreichen Spielleitung von Hans J a r a y agierten und sangen in der Volksoper Dagmar Hermann, Olive Moorfield, Ina Dressei, Heini Holecek und Oskar Hugel- mann. Eine hübsche Besetzung, durchweg singende Schauspieler, die sich in den lustigen (aber zu wenig stabilen) Dekorationen von Neumann-Spallart und in den Kostümen Alice Sch1einger 3 in guter Laune bewegten.
Den zweiten Teil des Abends bildete Puccinis Einakter „Gianni Schic- chi”, die Geschichte von den erbschlei- cherischen Verwandten des reichen Buoso Donati und dem sie übertölpelnden Schic- chi. Wir sahen diese (einzige) bitter-zynische Komödie (deren Held übrigens in Dantes „Göttlicher Komödie” vorkommt) in der Inszenierung von Otto Fritz, mit Bühnenbildern von Walter Hoe s1in und zeitgerechten Kostümen (das Stück spielt zu Florenz im Jahre 1299) von Reni Lohner. In den Hauptrollen: Erich Kunz, Christiane Sorell, Dagmar Hermann und Rudolf Christ, dazu ein weiteres Dutzend gleichfalls gutbesetzter Nebenpartien. Argeo Q u a d r i hat mit dem ambitionierten Volksopemorchester die mehr kammermusikalisch angelegte Partitur Menottis mit ihren vielen Rezitativen und Parlando-Begleitungen ebenso schön zum Klingen gebracht wie die massivere Puccinis.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!