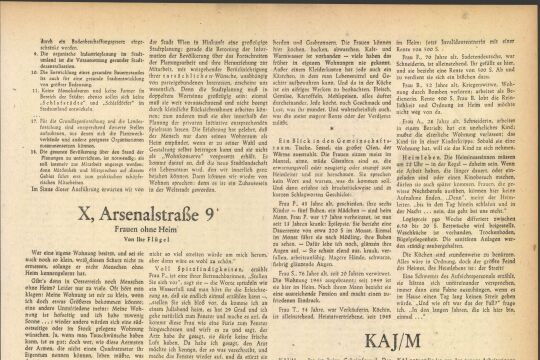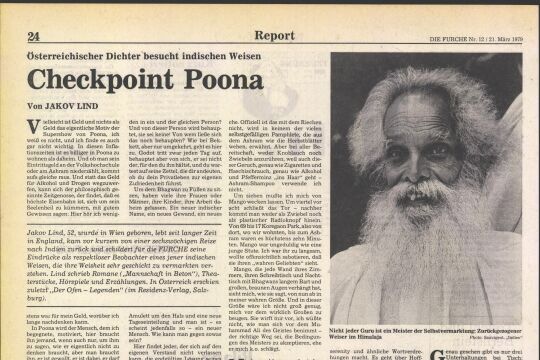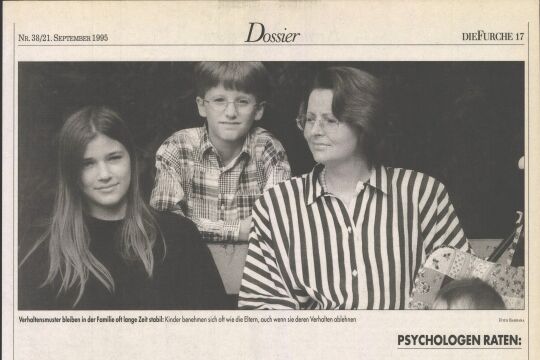Die Sozialpädagogin Ursula Beck ist Leiterin des Krisenzentrums im 23. Wiener Gemeindebezirk. Wie man nach jahrelanger Arbeit mit misshandelten und vernachlässigten Kindern dennoch an seinen Idealen festhält und nicht abgebrüht wird, lebt die 47-Jährige vor.
Wenn mich keine Geschichte mehr berühren würde, dann wäre ich schockiert“, überlegt Ursula Beck. „Denn es ist nicht immer so, dass in Familien alles gerade läuft: Dass es Strukturen im Alltag gibt, dass genügend Geld da ist, dass Menschen da sind, auf die man sich verlassen kann.“ Das hat Beck schon früh in ihren Berufspraktika gelernt. Die 47-jährige Sozialpädagogin ist heute Leiterin des Krisenzentrums im 23. Gemeindebezirk, in dem Kinder vorübergehend Schutz und Unterstützung finden, wenn sie zu Hause akut gefährdet sind, sei es durch Gewalt oder Vernachlässigung. Rund 1000 Kinder kommen jährlich in Wien für maximal sechs Wochen in Krisenzentren unter. Gemeinsam mit Eltern und Kindern werden in dieser Zeit tragfähige Lösungen für die familiären Probleme erarbeitet. Ist die Rückkehr nicht möglich, weil sich etwa Gewaltstrukturen nicht auflösen lassen, wird das Kind nicht mehr bei den Eltern, sondern in einer Wohngemeinschaft untergebracht.
Nachmittags ist es ruhig im Krisenzentrum des 23. Wiener Gemeindebezirkes. Durch die offene Balkontür weht ins Wohnzimmer warmer Sommerwind, der sich tränkt mit dem Geruch von frischem Nagellack. Ein Mädchen bepinselt ihre Fingernägel schwarz. „Ohne die dicken, schwarzen Rändern unter deinen Augen sieht du gleich viel besser aus“, ruft Beck dem Mädchen zu. „Mit elf Jahren muss man sich noch nicht so stark schminken. Nagellack ist ok.“ Das Mädchen protestiert ungläubig, verwickelt die Zentrumsleiterin aber gleich in ein freundliches Gespräch über die Abendbeschäftigung. Das Zusammenleben gestaltet sich an diesem Nachmittag ruhig und friedlich, die vier Zimmer in denen bis zu drei Kindern schlafen, sind an diesem Tag größtenteils leer. Das Wetter ist schön draußen.
„Würde den Job sofort wieder wählen.“
Mit Jeans und T-Shirt bekleidet und ihrem kurzen, leicht gegeelten, blondiertem Haar wirkt Ursula Beck unprätentiös und bodenständig. Die gebürtige Deutsche lacht viel und strahlt gleichzeitig Bestimmtheit aus. Beim Reden lässt sie sich nicht unterbrechen. Manchmal erfordert die Arbeit mit Kindern, die vorübergehend nicht zu Hause wohnen können, besondere Stärke. „Gerade Berufsanfänger können daran zweifeln, ob sie überhaupt richtig sind im Job. Man fragt sich, ob man versagt. Ich hatte selbst schon Situationen, die sehr aggressiv waren bis hin zur Bedrohung. Gerade am Anfang kann man überfordert sein, wenn die Kinder einfach über einen drüberfahren.“ Da sei es wichtig, sich mit Kollegen auszutauschen und damit umgehen zu lernen.
Ihren Job würde Beck sofort wieder wählen. „Manchmal frage ich mich: Warum eigentlich?“, lacht sie laut. Einfacher ist es jedenfalls nicht geworden. Über die Jahre sind die Gefährdungsmeldungen beim Amt für Jugend und Familie der Stadt Wien gestiegen, im Jahr 2009 waren es rund 10.450. Schulen und Kindergärten reagieren heute sensibler auf Auffälligkeiten, der Großteil der Meldungen betrifft den Verdacht auf Vernachlässigung, gefolgt von psychischer und physischer Gewalt zu Hause und in seltenen Fällen den Verdacht auf sexuellen Missbrauch.
Diesen Kindern wollte Ursula Beck schon immer helfen. „Wenn jemand im Kindergarten schon sagt, er wird Lokomotivführer, wird er das später meistens nicht. Ich aber bin wirklich Erzieherin geworden“, erinnert sie sich, als hätte es nie etwas anderes für sie gegeben. „Ich bin keine Spätentscheiderin. Ich wollte Kindern helfen, hatte Ideale und dachte anfangs noch, wenn Heimkinder nur genug Zuwendung bekommen, stabilisieren sie sich so und finden so den richtigen Weg.“ Ein naiver Gedanke? Beck überlegt. „Es ist zumindest ein hohes Ideal. Wenn man Ideale verliert, dann geht es nicht mehr. Es ist nicht so, dass man als Sozialpädagogin immer viel Einfluss darauf hat, dass alles wunderbar läuft. Ideale verändern sich ein bisschen im Laufe der Zeit. Wenn sie das nicht tun, übersteht man den Job schwer.“ Aufpassen müsse man, dass einen harte Kinderschicksale nicht auffressen – denn als Fallbetreuerin mittendrin kann einem schon einmal in Ausnahmesituationen der fachliche Blick verlorengehen.
Manche Geschichten berühren so sehr, dass in Supervision nachgearbeitet werden muss. „Man wird sonst zum hilflosen Helfer. Auf der einen Seite brauchen wir Empathie, Geduld und Zuneigung im Job, auf der anderen Seite den fachlichen Hintergrund, die Professionalität.“ Wenn Geschichten gut verlaufen, motiviert das umgekehrt ungemein. Beck erinnert sich etwa an eine zweifache Mutter mit Kindern im Volksschulalter, die sogar selbst nach praktischer Erziehungsberatung gebeten hat, weil sie in ihrer eigenen Kindheit nie Regeln erfahren hatte und sie auch nicht an ihre Kinder, die schon im Kindergarten wüst wirkten, weitergeben konnte. Dass sich das Verhalten der Kinder besserte, fiel auch in der Schule auf, die Mutter selbst war dankbar und die Kinder konnten wieder nach Hause zurückkehren. Geschichten wie diese geben Ursula Beck Sinn, der Gedanke, Schutz bieten und helfen zu können, treibt sie an. Wenn es ihr selbst zu viel wird, schaltet sie am besten beim Sport ab. „Ich habe auch ein Stück Garten, mit Erdigem zu arbeiten ist super.“ Nur eines habe in der Freizeit keinen Platz, lacht Beck herzhaft: „Ich mache nichts Soziales. Beim Sport kann ich besser entspannen.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!