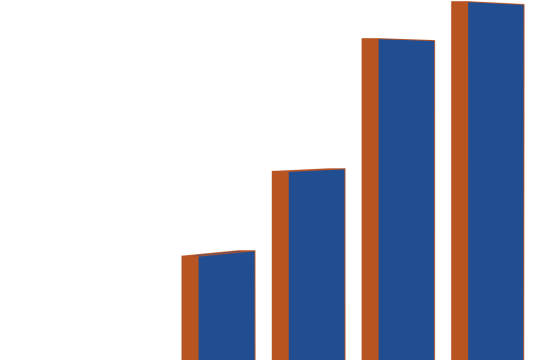Wer glaubt, ein Studium würde einen leichten Jobeinstieg garantieren, der irrt. Für ihren Wunschberuf müssen Akademiker zunehmend persönliche Opfer bringen.
Ein abgeschlossenes Studium, ewig aussichtslose Praktikumsschleifen und große Unsicherheit darüber, ob man von seinem Wunschberuf je halbwegs gut leben können wird. Ein Szenario, das vielen Studierenden bekannt vorkommen mag. Auch Florian S. findet sich in der beschriebenen Lage wieder: Während seines Studiums der Politikwissenschaften an der Universität Wien hatte er zunächst keine konkreten Berufsziele vor Augen. Nach "einer gefühlten Menge“ Praktika, wie etwa bei der Investkredit Bank AG, konnte er auch journalistische Erfahrung im öffentlich-rechtlichen Radio sammeln.
"Ich war damals ziemlich orientierungslos und hab die Chance wahrgenommen. Zunächst bin ich zu Interviews und Ähnlichem mitgegangen und in der letzten Praktikumswoche habe ich schließlich mein erstes eigenes Interview geführt und dann mit einem Kollegen versucht, daraus einen Beitrag zu machen“, erzählt Florian S. Es folgten drei weitere Volontariate in derselben Abteilung, bis er ab Sommer 2010 letztendlich als freier Mitarbeiter tätig wurde. Nach einigen Aufträgen fällt Florian S. krankheitsbedingt länger aus und kann erst im Frühling des folgenden Jahres wieder arbeiten. Durch seinen freien Dienstvertrag ergeben sich aber Probleme mit der Versicherung, schlussendlich muss er sich selbst versichern. "Hinzu kam, dass mir immer wieder gesagt wurde, dass es einen ziemlichen Sparzwang gebe und sie mir nicht mehr Aufträge zusagen könnten“, erzählt er.
"Traumberuf“ zu entbehrungsreich
Aus Mangel an beruflichen Perspektiven wechselte der Politikwissenschaftler letztendlich in eine andere Radioabteilung, aber auch dort schien die freie Mitarbeit keine Früchte zu tragen: "Abgesehen von ein paar kleineren Beiträgen konnte ich auch nicht mehr leisten. Ich war weit davon entfernt, soviel zu arbeiten, dass ich auch nur annähernd davon leben konnte, also war ich nach wie vor von der Unterstützung meiner Eltern abhängig“, sagt er..
Nach erneuten Versicherungsproblemen und wachsendem Zweifel an der Sinnhaftigkeit dieser Beschäftigung entschied sich Florian S., in den Sozialbereich zu wechseln. Seit Beginn des Jahres arbeitet er nun als Förderlehrer bei "Wien Work“, einem Unternehmen, das versucht am Arbeitsmarkt Benachteiligte zu vermitteln, im Juni des nächsten Jahres wird er das Kolleg für Sozialpädagogik abschließen.
Rückblickend war sein Umweg über den Journalismus aber keine verlorene Zeit: "Was meine Entwicklung betrifft, war es sehr lehrreich. Ich konnte an meinen Defiziten arbeiten, indem ich mich immer wieder selbst überwinden musste. Andererseits bin ich in eine persönliche Krise gerasselt, wie ich sie weder vorher noch nachher erlebt habe“. Im Sozialbereich habe Florian S. nun seine wahre Berufung gefunden.
426 Kilometer wöchentlich oder rund 20.000 Kilometer im Jahr: Diese Strecke legt der Niederösterreicher Christian Punzengruber von seinem Heimatort bis zu seiner Arbeitsstelle zurück. Seit vier Jahren pendelt der studierte technische Mathematiker zwischen dem Mostviertel und Wien.
Montag früh geht es direkt in die Arbeit zu einer Glücksspielfirma in Gumpoldskirchen, am Abend dann geht es in seine Wohnung nach Wien Ottakring und über das Wochenende wieder zu Freundin, Familie und Freunden nach Niederösterreich.
Der Weg zur Arbeitsstelle verlief glatt: "Gelesen, beworben und fertig“, lacht der 31-Jährige. Nachdem er sein Studium in Linz abgeschlossen hatte, habe er Stellenangebote gelesen und wäre dabei sofort bei einer Ausschreibung des Glücksspielkonzerns hängen geblieben. Schlussendlich war diese Firma auch die einzige, bei der ein Bewerbungsschreiben des Niederösterreichers einging: "Im Nachhinein war das leichtsinnig, aber es hat mir gefallen, dass es nichts mit Versicherungen oder Banken zu tun hatte - dorthin verschlägt es nämlich fast alle mit meinem Studium“, erklärt er.
So abwechslungsreich sich die Stelle in der Ausschreibung anhörte, erwies sie sich laut Punzengruber auch in Wirklichkeit: Er berechnet Spiele nicht nur, sondern entwickelt sie zur Gänze, neben dem Besuch von Spielemessen, wie sie etwa jährlich in Großbritannien stattfinden, hat der Niederösterreicher auch bereits Spiele für den wohl bekanntesten Glückspielort der Welt entworfen: Las Vegas. Einziger Wermutstropfen seines ansonsten "fast optimalen“ Jobs sei das wöchentliche Pendeln: "Anfangs habe ich mir immer gedacht, dass ich das eh nur für ein oder maximal zwei Jahre mache und mir dann etwas suche, das näher meiner Heimat ist“, erzählt Punzengruber. Mittlerweile beliefert er Casinos schon seit vier Jahren mit den neuesten Spielen. "Wäre die Arbeit nicht so klasse, würde ich das schon lange nicht mehr machen“, meint er.
Keine befriedigende Dauerlösung
Auf lange Sicht möchte der 31-Jährige aber wieder im Mostviertel leben, vor allem wenn die Familienplanung beginnt, könne er es sich nicht vorstellen, an fünf Tagen in der Woche nicht zuhause zu sein: "Da versäumt man einfach zu viel“. Über freie Stellen in seiner Heimat informiert sich der Mathematiker regelmäßig, für den passenden Job in der Umgebung würde der Niederösterreicher - wenn die Fahrzeit im Rahmen von etwa einer Stunde bleiben würde - jederzeit wieder Pendeln: "Wahrscheinlich ist das heute normal, dass man so eine Flexibilität und Mobilität ins Berufsleben mitbringen muss. Zumindest ist es normal für mich und für das, was ich studiert habe“.
Anders als bei Christian Punzengruber und Florian S. war der gebürtigen Burgenländerin Beate K. schon lange bewusst, dass sie eines Tages als Museumskuratorin arbeiten möchte. Deshalb entschloss sie, sich an der Universität Wien für Kultur- und Sozialanthropologie zu inskribieren. "Ich bin da recht blauäugig hineingegangen. Das hat mich einfach fasziniert und was im Studienbuch stand, hat sich sehr spannend angehört“, erzählt sie.
Mal studieren und dann weiterschauen
Trotz kritischer Stimmen der Verwandtschaft hinsichtlich der beruflichen Perspektiven nach dem Studium, blieb sie optimistisch: "Ich habe mir immer gedacht, dass sich schon irgendetwas finden wird und dass ich jetzt einfach einmal studiere und dann weiter schaue“. Tatsächlich ergab sich nach dem Abschluss des Studiums die Gelegenheit zu einem Praktikum in einem Museum in Deutschland.
Wie so oft wäre auch dieses Volontariat jedoch rein durch neu gewonnene Erfahrungen entlohnt worden: "Dann hätte ich aber auch eine Unterkunft bezahlen müssen und man muss ja auch von etwas leben. So hätte ich also nebenbei eigentlich noch einen Job haben müssen, um mir das leisten zu können. Dann habe ich mich entschieden, mich stattdessen noch für das Doktoratsstudium zu inskribieren“. Um sich die geplante Feldforschung für die Diplomarbeit zum Thema "Missionsarbeit auf Fidschi“ vor Ort leisten zu können, begann Beate K. schließlich auf freier Dienstvertragsbasis in einem Marktforschungsinstitut zu arbeiten. "Im Nachhinein war das naiv, denn man hat viel Arbeit, ist aber kaum abgesichert“, meint sie heute.
"Nachdem dann meine Hochzeit vor der Tür gestanden ist, habe ich mir gedacht, dass nun der Ernst des Lebens beginnt und ein Angestelltenverhältnis nicht schlecht wäre, wenn wir einmal eine Familie gründen wollen“, erklärt Beate K. Bald wurde sie als Assistentin in einer Firma für Devisenmanagement eingestellt, die jedoch durch die Folgen der Wirtschafskrise Konkurs anmelden musste.
So wurden erneut viele Bewerbungen versendet und immer wieder zeigte sich dasselbe Problem: "Viele haben gesagt, dass mir die Positionen aufgrund meines Magistertitels vielleicht irgendwann zu wenig sein werde, dass ich vielleicht mehr Gehalt oder mehr Aufgaben erwarten werde. Die meisten Arbeitgeber dachten, dass ich nicht lange bleibe“. Schließlich wurde die studierte Kulturwissenschaftlerin beim österreichischen Normungsinstitut "Austrian Standards“ fündig, wo sie heute in der Personalabteilung beschäftigt ist. Sich im Kulturbereich zu bewerben, wäre vor allem wegen dem geplanten Familienzuwachs kein Thema mehr gewesen. Dass sie heute in einem gänzlich anderen Berufsfeld arbeitet, als es ihr zu Studienzeiten vorschwebte, sieht Beate K. gelassen: "Ich bereue es nicht, dass ich Kultur- und Sozialanthropologie studiert habe. Es hat mir Spaß gemacht und ich wäre heute nicht die Person, die ich bin, wenn ich das alles nicht so gemacht hätte.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!