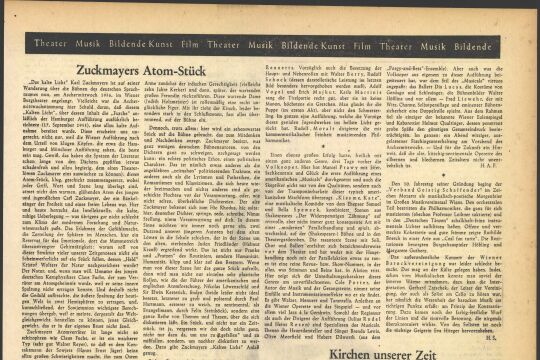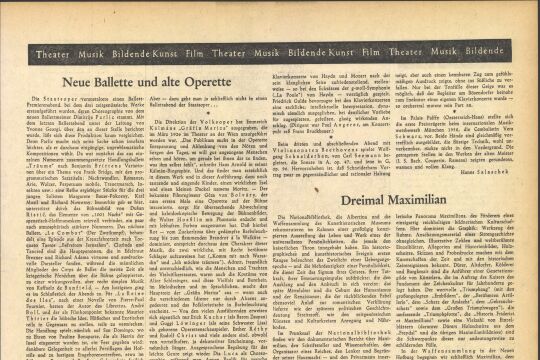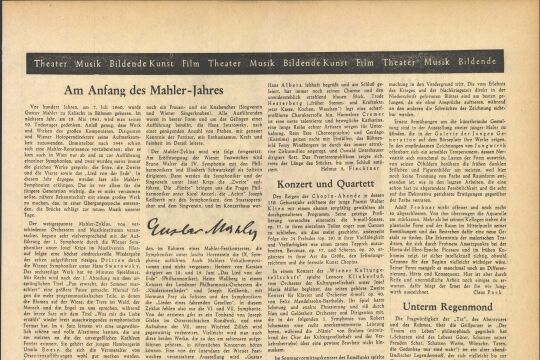Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Premiere mit Silberglanz
Knapp vor den Ferien brachte die Volksoper Emmerich Kälmäns Operette „Die Csdrddsfürstin“ mit Glanz und Gloria heraus, die eine Suite von Wiederholungen gewährleistet hätten, die denn im Herbst auch einsetzen dürfte. Man hat Text und Musik gelassen, wie sie sind, und keine Bearbeitung hätte es besser machen können. Denn das Textbuch von Stein und Jenbacih ist gut und spannend gebaut, und Kälmäns Musik, von einem halben Jahrhundert überlärmt, hat nichts von der Frische und Zügigkeit ihrer Melodien, nichts von ihrem prickelnden Charme eingebüßt, ist geschickt und diskret instrumentiert und ein Musterbeispiel von Form und Geschmack. Die Uraufführung fand 1915 im Johann-Strauß-Theater statt. Was waren das für Zeiten der Operette! Annähernd gleichzeitig spielte man im Theater an der Wien Leo Falls „Rose von Stambul“ und im Bürgertheater Oskar Straus’ „Rund um die Liebe“. Werke, die es trotz der Kriegszeit auf mehr als 500 Aufführungen en suite brachten. Etwas von dem Glanz dieser silbernen Operettenzeit ist in der Sommerpremiere der „Osärdäsfürstin“ eingefangen. Die Inszenierung van Edwin Zbonek, das Bühnenbild von Walter Hoesslin und die Choreographie von Dia Luca können sich sehen lassen; die Musik unter Anton PauUk hatte allen Elan der Partitur.
Von den Darstellern sind Peter Minich als Edwin Ronald, Erich Kuchar als Bani und Guggi Löwin- ger als Komtesse Stasi an erster Stelle zu nennen, denen sich Herbert Prikopa als Feribaosi und Egon Jordan als Fürst Leopold durch eine noble Art des Unterspielens anschließen, ebenso Lilly Stepanek als Fürstin. Eine Fehlbesetzung war Adele Leigh als Sylvia Varescu. Die in der Höhe zuweilen scharfe Stimme hätte man ihr wohl verziehen, auch ihre Erscheinung war sehenswert und durchaus die einer
Dame. Aber das Ungarmädel, das Sylvia ist und bleibt, vermochte sie nicht darzustellen. Sie blieb mehr Whisky als Paprika, mehr Nordlicht als Lampion. Daß sie trotzdem bestand und, . soweit ihre Intuition reichte, ihre Aufgabe erfüllte, spricht für sie. Der Erfolg der Sommerpremiere übertraf alle Erwartungen, und manche bekannte Nummern mußten wiederholt werden.
„Brillanten aus Wien“ spielte man im Raimundtheater. Es ist ein Stück um das Schicksal des Wiener Goldschmieds Josef Strasser, formal eine Art Volksstück mit Musik, ein Zwischengenre, nicht ohne Reiz, aber von Frische und sprühender Lebendigkeit der Wiedergabe sehr abhängig. Diese Frische war leider nicht oder doch nur teilweise gegeben, es gelang nicht, den Staub der Mottenkiste ganz wegzublasen. Mario Haindorff spielte den Goldschmied ohne klares Profil, Lydia Weiss als sein Töchterl bringt wohl Lebendigkeit, aber auch sprachliche und gesangliche Unarten auf die Bühne. Marianne Schönauer als
Maria Theresia und Hans Fretzer als Leopold Lampelmayer waren die glaubhaftesten Gestalten; Peter Gerhard und Axel Skumanz blieben sich selber treu, und das ist immerhin etwas, Günter Frank als Husarenleutnant Max hatte die Sympathien auf seiner Seite. Die übrigen taten ihr Bestes, was nicht immer das Beste war. Das Stück nennt sich „Singspiel in 4 Bildern“ von Rudolf Österreicher und Curt von Lessen, Gesangstexte und Musik von Alexander Steinbrecher. Die musikalische Leitung (Rudolf Bibi und Leopold Großmann) hatte diesmal kein Orchester, sondern bloß zwei Klaviere zu betreuen. Die Regie (Peter Dörreu) schien zuweilen wenig gestrafft. Die Choreographie schuf Rein Este, die Bühnenbilder Ferry Windberger. Die Musik lebte lim großen ganzen vom bekannten Lied vom „Wegerl im Helenental“. Das Publikum freute sich daran und spendete liebenswürdigen Beifall.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!