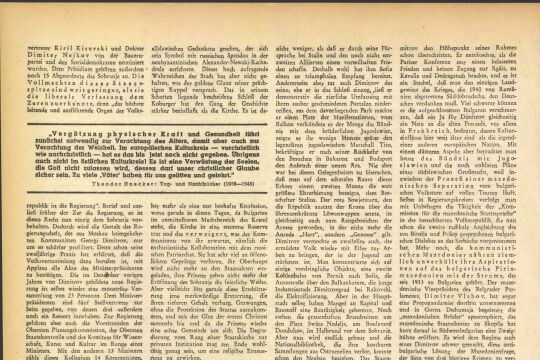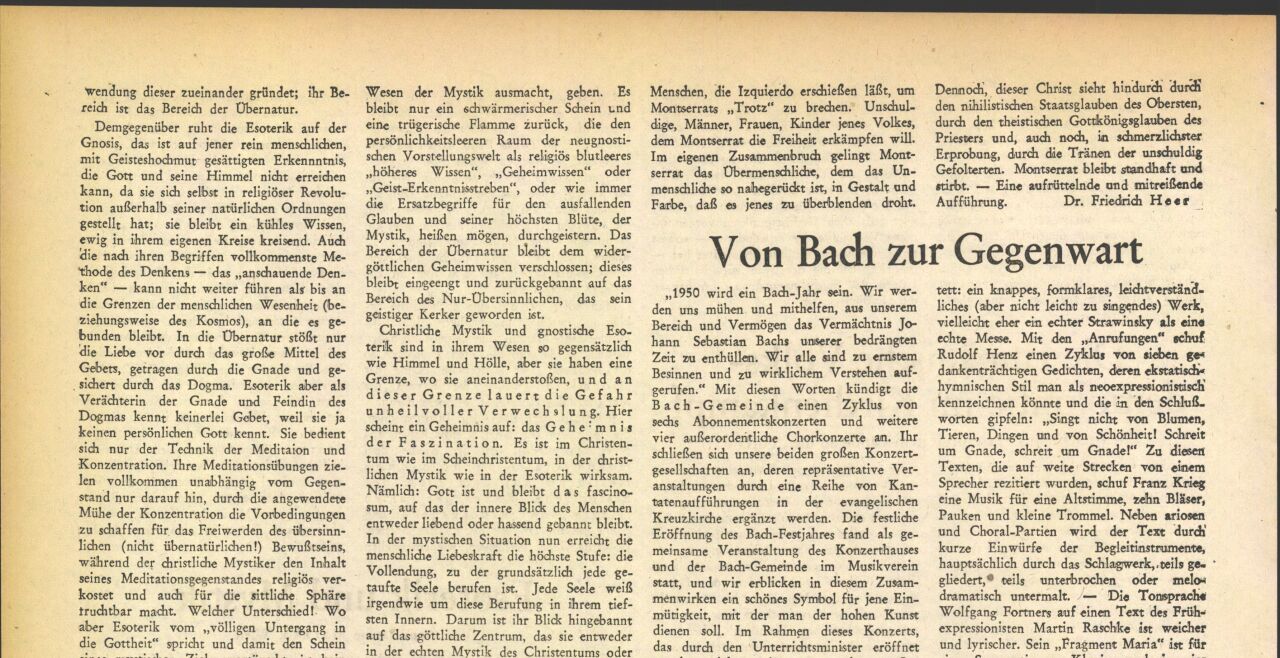
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Starktonige Zeitdramen
Das Theater der Courage, das seinem Namen alle Ehre macht, eröffnet die neue Spielzeit mit einer Offensive für den Friedensgedanken. Das mit dem österreichischen Dramatikerpreis 1949 ausgezeichnete Drama „Die Patrouille“ von .Wilhelm Steiner und „Das Zeichen des Jona“ von Günther Rutenborn bauen einen Abend. Das Werk des Österreichers wird von dem des Deutschen ergänzt. — Steiner geht senkrecht aufs Ganze; er verbindet die Toten des ersten Weltkrieges mit den Toten des zweiten Weltkrieges durch eine Patrouille, die, von ersteren ausgesandt, in das Leben geriet — in das Leben der deutschen Jahre 1918 bis 1938. Da sich die Lebenden zu schwach erweisen, für den Auftrag der Toten, für Frieden und Freiheit zu kämpfen, werden sie zurückgerufen ins Land der Toten. Sie sterben und fallen im militärischen und zivilen Mord des neuen Krieges. Steiner ist linear, knapp, ein Propagandist seiner Ideen, ein nüchterner, unmißverständlicher Propagandist im guten Sinn des Wortes. Er stellt keine metaphysischen Haupt- oder Nebenfragen. Die Tragödie des deutschen Volkes löst sich ihm auf in die Tatsache der Schwäche jener Männer, die, heimgekehrt aus dem ersten Krieg, berufen waren, dem Aufgang des zweiten zu wehren. — Mit dieser Antwort gibt sich der Deutsche, Günther Rutenborn, nicht zufrieden. „Das Zeichen des Jon a", in dem Babel mit Berlin, die scharlachrote babylonische Dirne mit den Machtherren unserer Tage identifiziert wird, ebenso. wie Jona, der Prophet, mit dem U-Boot-Kapitän, der aus gesunkenem Boot als einziger errettet wird — dieses Drama ist kein surrealistisches Experiment, auch keine Anleihe von Pirandello oder einem anderen außerchristlichen Dramatiker unserer Tage, sondern ein sehr starker Versuch, ein neues christliches Geschichtsdrama zu schaffen. Denn: es ist nicht Koketterie und Witzelei, wenn die Darsteller hier immer wieder aus den Rollen fallen — und eben in jene Rolle hineinfallen, die ihresgleichen vor Jahrtausenden bereits einmal gespielt haben und ‘die sie gestern, in der Bedrängnis durch das apokalyptische Untier des totalen Staates, wieder aufnahmen — und morgen wohl wieder übernehmen werden … Nein, das ist kein dramaturgischer Kniff eines sensationslüsternen Stück-Schreibers, sondern die Aussage jener Gleichung, jener Realpräsenz, aus der der Symbolismus alt- und urchristlicher Geschichtsdeutung seit den Tagen des Sehers von Patmos lebt: die Menschen spielen, seit das gottmenschliche Drama begann, immer wieder dieselben Rollen, sie nehmen das Zeichen des Menschensohnes und des Gegenmenschen an — und tragen es als ihre Standarte durch den Feuerofen Babylons und den der Gegenwart und pflanzen es auf an den Gerichtsstätten, Galgen und Schlachtfeldern jeder Stunde dieser Weltgeschichte, die immer im Zwielicht steht: offen dem Gericht und der Erlösung. Ein Stück, das hohe Anforderungen stellt und das sehr tapfer gemeistert wird von dieser Avantgardebühne. Hier ist nicht die „Burg“, hier ist nicht die „Akademie", hier aber schlägt ein Herzensschlag, der das Furchtbare zu bestehen wagt, das uns alle angefallen hat und dem im gültigen Wort und in der reinen Tat zu begegnen noch den wenigsten gelungen ist: die wahre Tragödie unserer Zeit.
Ein innerlich verwandtes Zeitstück ist, obwohl es äußerlich 1812 in Venezuela spielt, „Im Namen des Königs“ von Emanuel Robins, übertragen von Matthias V e r e n o, die dritte Premiere der Insel. — Das Land stöhnt unter dem Druck der Besatzungsmacht. Rechtlosigkeit, Grausamkeit, Raub, Schändung, Mord. Da stellt sich Montserrat, ein spanischer Offizier, nach einer persönlichen Begegnung mit dem Feind, mit Simon Bolivar, dem Führer der südamerikanischen Unabhängigkeitsbewegung, auf dessen Seite. Er verrät den Fluchtort des Freund-Feindes, von dem er die Stiftung einer neuen Zeit der Menschenwürde und Freiheit erhofft, nicht, obwohl grausamste Versuchungen ihn bedrängen. Der Versucher trägt dreifache Gestalt: er ist Oberst Izquierdo, „der Linke“, wie schon sein Name sagt, ein Generalstäbler, dem in seinem Kriegerleben jedweder Glaube an Gott und den Menschen abhanden gekommen ist. Er ist dann, in feinerer Körnung, Padre Coronil, „der Rechte", der Scheingerechte, dem als Erben einer tausendjährigen Tradition der Glaube an Gott völlig identisch geworden ist mit dem Glauben an den irdischen König. Und der Versucher manifestiert sich zum dritten, bedrängendsten und qualvollsten in sechs Menschen, die Izquierdo erschießen läßt, um Montserrats „Trotz“ zu brechen. Unschuldige, Männer, Frauen, Kinder jenes Volkes, dem Montserrat die Freiheit erkämpfen will. Im eigenen Zusammenbruch gelingt Montserrat das Übermenschliche, dem das Unmenschliche so nahegerückt ist, in Gestalt und Farbe, daß es jenes zu überblenden droht.
Denncxh, dieser Christ sieht hindurch durch den nihilistischen Staatsglauben des Obersten, durch den theistischen Gottkönigsglauben des Priesters und, auch noch, in schmerzlichster Erprobung, durch die Tränen der unschuldig Gefolterten. Montserrat bleibt standhaft und stirbt. — Eine aufrüttelnde und mitreißende Aufführung.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!