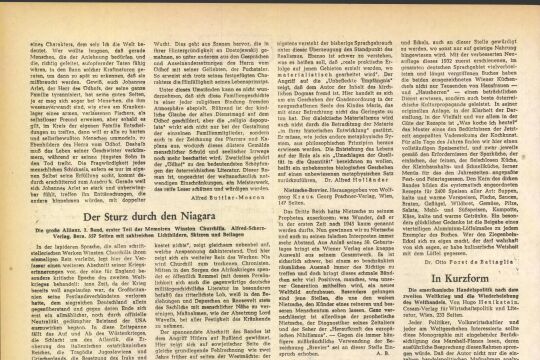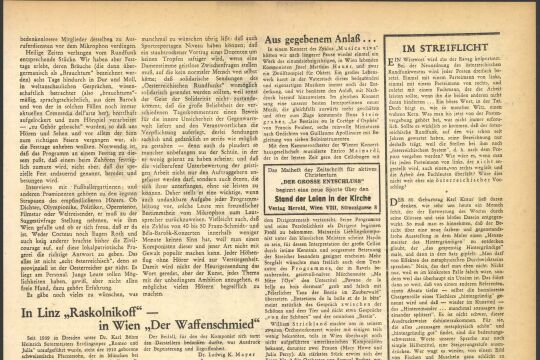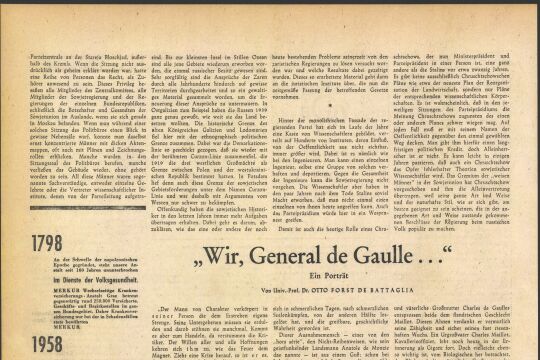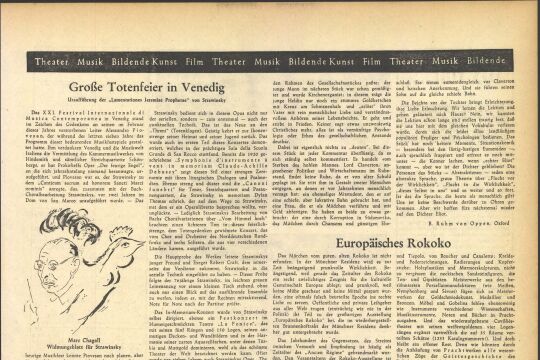Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Urlaub auf Ehrenwort
Es ist zwecklos, sich beim Film „Urlaub auf Ehrenwort“ des Streifens zu entsinnen, den Carl Ritter 1937 für die Ufa drehte; und es ist ebenso zwecklos, Nachforschungen anzustellen, inwieweit die neue Fassung den wirklichen Absichten des Regisseurs Liebeneiner entspricht. (Man behauptet, sie wäre gegen seinen Willen „umgeschnitten“ worden.) Immerhin steht der Name des Regisseurs und Mitverfassers des Drehbuches auf dem Programm. Ist der Streifen wirklich eine „Verzuckerung“ des Barras? Fördert er die kriegerische Gesinnung? Wer „ja“ sagt, der hat schlecht aufgepaßt. Der sah weder das Kind, das einem Kommißbrot hungrig nachschaut; der bemerkte die schullandverschickten Kinder, die mütterlosen, nicht (denn, die Mütter mußten arbeiten); der begriff nicht, daß die Männer, denen für armselige sechs Stunden — gegen Kommandanturbefehl — im gebombten Berlin Gelegenheit geschenkt wurde, ihre Angehörigen aufzusuchen, keiner „Fahne“, keiner „Idee“ und schon gar nicht einem „Obersten Befehlshaber“ die Treue hielten, sondern einzig dem Mann,, der wohl Leutnant, immer aber Mensch war und dafür seinen Kopf riskierte. Und was manche Szenen hektischen Lebensgenusses angeht: Wer, der dabei war, wollte leugnen, daß am Rande des Todes die Flamme der Liebe am steilsten emporloderte?
Pierre Daninos Roman „Major Thompson entdeckt die Franzosen“ war seinerzeit ein amüsanter Lesestoff. Was Preston Sturges darnach gedreht, ist — bei all seiner Regiekunst — doch nur ein dünner Tee geworden, und der Kummer über dieses an englischen Kaminen kaum würdig gefundene Getränk wächst mit jedem Wort der Synchronisation, die Esprit in Sprit destilliert. Dieses „Tagebuch des Misters Thompson“ wäre ohne die schauspielerischen Typen mühsam zu lesen.
Gleichfalls ein französischer Film ist „Reif auf jungen Blüten“ nach dem Roman von Vicky Baum „Eingang zur Bühne“. Es ist undelikat von den Autoren, verallgemeinernd darauf hinzuweisen, daß der Weg zur Höhe mit, sagen wir schonend, Gefälligkeiten, gepflastert ist. Wenn man nun außerdem die Handlung (Außenaufnahmen) nach Wien verlegt, wirft es ein schiefes Licht auf die hiesigen musikalisch-pädagogischen Verhältnisse. Als Kuriosität sei noch erwähnt, daß man die Akademie der Wissenschaften auf dem Universitätsplatz für ein „Wiener Konservatorium“ (soll wohl heißen: „Akademie für Musik und bildende Künste“) ausgibt und daß ein Bildhauer sein Atelier ausgerechnet im Beethovenhaus auf dem Heiligenstädter Pfarrplatz hat. Schließlich hat man Gesangpartien („Figaro“, „Tristan“) unzureichenden Stimmen anvertraut und die Synchronisation schludrig gemacht.
Zielbewußt durchgeführt, wäre der Streifen „V e r-femte Frauen“ (sein französischer Originaltitel lautet besser: „Marchandes d'illusions“) ein Dokumentarbericht über das Wirken der inneren Mission geworden. Etliche kolportagehafte Züge verwischen den Eindruck. Immerhin steht mit der Figur der Seelsorgehelferin (Giselle Pascal) die Verkörperung eines Ideals vor uns. Religiöse Festigkeit, schwesterliche Liebe, helfendes Mitgefühl sind einem sozialen Problem gegenübergestellt.
„Die wunderbare Liebe der Bianca Maria“ ist ein kitschiger Titel für eine durchaus saubere Geschichte um einen spanischen Edelmann und ein blindes Zigeunermädchen. Wo die Originalsprache (spanisch) — wie in den Gesängen zu den gelungenen folkloristischen Aufnahmen — belassen wurde, entsteht sogar so etwas wie Atmosphäre. Schade, daß man mit der visionären Revueeinlage einen wesentlichen Faktor des Stückes verwischte: das Bemühen, gesellschaftliche Zustände durch echte Nächstenliebe zu bessern.
Nach „Othello“ war „Herr Satan persönlich“ (mit Orson Welles) eine schwere Enttäuschung. Etliches an dieser Kriminalaffäre wirkt abstrus, anderes verschmockt. Mit virtuoser Kameraführung allein ist nichts getan.
Primitive Unterhaltungsware bietet die „Insel der Leidenschaf t“. Gangsterluft weht auch im „M enschenraub auf Singapur“. Geschossen, geprügelt wird dort, „W oderWindstirbt“. Wer sich von der „Karawane der Sünde“, einem italienischen Film, etwa (weil er unter Landarbeitern spielt) einen „Bitteren Reis“ erwartet, erhält nur Kohl vorgesetzt, den man anbrennen ließ. „S i n d b a d s Sohn“ wäre, bei zielstrebiger Regie und einem nur halbwegs tauglichen Drehbuch, eine nette Satire auf pseudo-orientalische Abenteuerfilme geworden. Indes geriet nur ein Monsterschinken daraus, zu dem man als pikant sein sollende Mayonnaise fragwürdige Revueszenen servierte.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!