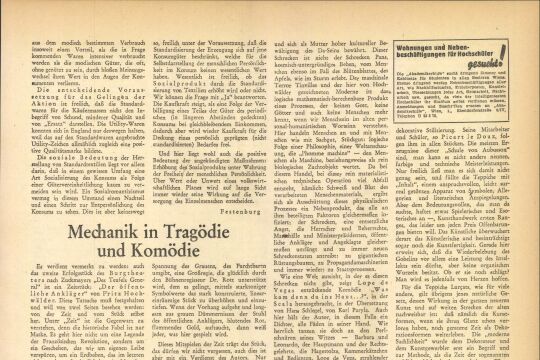Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Vexierspiel mit dem Nichts
Sehr bald nach Beginn bekennt der Schriftsteller Valmont in dem Zweipersonenstück „7003“ von Fritz Hochwälder: „Mir fällt nichts ein.“ An sich ein gefährliches Wort, das leicht zu Ironie herausfordert. Tatsächlich ringt der Schriftsteller drei Akte darum, für das Geschöpf seiner dramatischen Phantasie, Hans Bioner, diese wesenlose, charakterlose, gewissenlose Wohlstandskreatur, den Gegenspieler zu finden. Er möchte ihn nämlich radikal ändern, „zurückvermenschlichen“, wenn schon nicht durch Krankheit, Einsamkeit, Liebe, so wenigstens durch eine Untat, ein Verbrechen. Aber selbst das mißlingt gründlich, denn die Figur Bioner ist nicht einmal ein Unmensch, ein Bösewicht, sondern ein Nichtmensch, ein Nichts. Sein Bekenntnis: „Bereuen? Nie gehört! Bin ich ein Mensch, ein Christ, ein Atheist? Müßte doch was da sein, irgend was. Nie was getan, nie was gewesen.“ 1003 heißt die Schicksalszahl in deutlicher Anspielung an Don Juans Sündenregister; hier ist sie bloß die Erkennungsnummer eines überschnellen Sportwagens. Eine Traumnacht lang setzt sich Valmont mit dem Phantom seiner überhitzten Einbildungskraft auseinander, um sich am Ende verzweifelt einzugestehen, daß der Nichtmensch nur „eine Projektion unserer eigenen Niedertracht“ ist, denn „nicht die Welt, das Hirn ist krank“. Aus dem Drama ohne Helden ist ein NichtStück geworden. Selbstgespräch, Dialog zwischen Ich und dem anderen Ich.
Faust-Mephisto, Don Juan-Leporello geistern durch dieses Antistück und nicht zuletzt Pirandello, der so unvergleichlich gezeigt hat, wie man eine Weit, einen Menschen erst auf der Bühne erschafft. Aber bei allem bitteren Pessimismus hatte Pirandello eines voraus: den Glauben an das strahlende Recht der Einbildungskraft. Hinter Fritz Hochwälders Pessimismus steht das absolute Nichts. („Was noch nicht Dreck ist, wird zu Dreck gemacht.“) Es fällt einigermaßen schwer, dem Satz im einführenden Aufsatz des Programmheftes zuzustimmen: 1003 sei „ein letztes, chiffriertes Warnsignal an uns alle“ vor dem Nichtmenschen. Dazu ist das Spiel, von einigen dialektischen Plattheiten abgesehen, zu intellektuell konstruiert, zu wenig überzeugend — für die anderen, sosehr es als persönliches Bekenntnis des Autors Hochwälder, als eine Art Zwischenstation auf seinem Weg zu einer weiteren dramatischen Auseinandersetzung, bedeutsam sein mag.
Die Uraufführung im Theater in der Josefstadt unter der einfallsreichen Regie von Veit Relin war mit Erfolg bemüht, über das Fehlen jeder Handlung, Entwicklung und Dramatik hinwegsehen zu lassen. Ausgezeichnet die beiden einzigen Darsteller: besonders Hannes Messemer als Schriftsteller mit vollem Einsatz seiner reichen und intensiven schauspielerischen Fähigkeiten; neben ihm Kurt Heintel als der über alles feixende Nichtmensch. Das Bühnenbild, Atelierraum mit einer Plastik von Fritz Wotruba und die Riesenprojektionen jener Figuren, von denen gerade die Rede ist (darunter einige sehr eindeutige und daher aufdringliche von einer Exklusivparty), stammen von Stefan Hlawa. Der Beifall galt einem auf hohem Niveau mißlungenen Stück, insbesondere aber der Mammutleistung der beiden Darsteller.
Auch in Österreich scheint man die klassischen japanischen Nö-Spiele, die in ihrer ursprünglichen Form das strengste Stiltheater der Bühnengeschichte darstellen, entdeckt zu haben. Nach einem Wiener Kellertheater und den Grazer Kammerspielen folgt nun das Kleine Theater der Josef Stadt im Konzerthaus,das drei moderne Nd-Spiele des Japaners Yukio Mishima aufführt. Der junge Autor versucht darin, die klassische Tendenz zum Typisieren und zum Einordnen des Menschen in gesellschaftliche Normen insofern zu überwinden, als er das Spiel psychologisch auflockert, um so seine Fabeln und Typen menschlich näherzubringen. Die Spiele wollen „den Grenzbereich zwischen Leben und Tod“ zum Schauplatz und die „Suche nach absoluter Wahrheit in der menschlichen Seele“ zur Handlung haben. Alle drei handeln von enttäuschter Frauenliebe. In „Die Dame Aoi“ ist es die zerstörende Gewalt einer Liebesverbindung, die nur durch ein Opfer gelöst werden kann; im zweiten Spiel, „Die getauschten Fächer“, läßt sich eine Malerin von einem Modell inspirieren, das vor Liebe wahnsinnig geworden ist; und Spiel drei, „Gesicht im Spiegel“, zeigt eine Tänzerin, die sich aus Eifersucht ihr schönes Gesicht verunstalten will, doch durch ihr Spiegelbild davon abgehalten wird. Die Poesie der undramatischen Einakter wird immer wieder durch moderne Elemente (Klinik, Psychoanalyse, Auktion, Cocktailverabredung usw.) „aufgelockert“. Der Eindruck bleibt zwiespältig, und mehr als eine reizvolle Kuriosität werden diese fremden und geheimnisvollen theatralischen Gebilde auf unseren Bühnen kaum je werden.
Unter der Regie von Edwin Zbonek bemühten sich die Schauspieler (unter ihnen besonders Ursula Schult und Renate Berg) um den nur schwer zugänglichen Darstellungsstil, in dem neben dem Wort auch die Gebärde wichtig ist. Freundlicher Beifall.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!