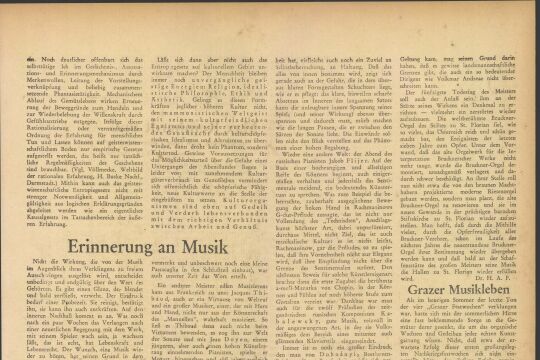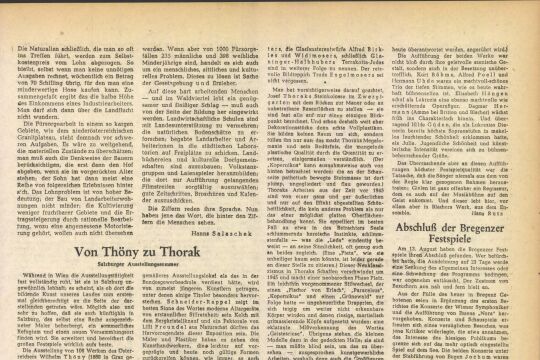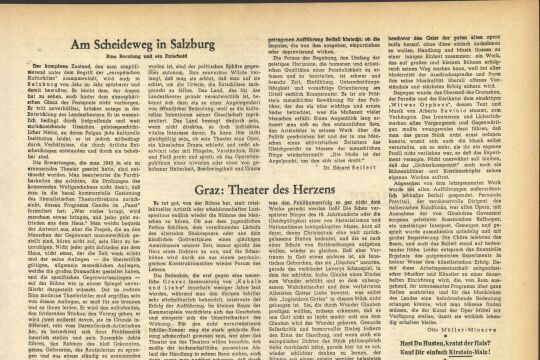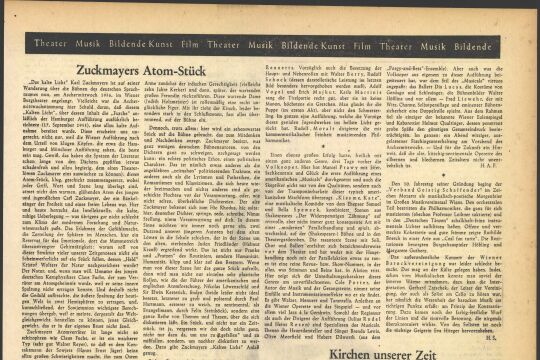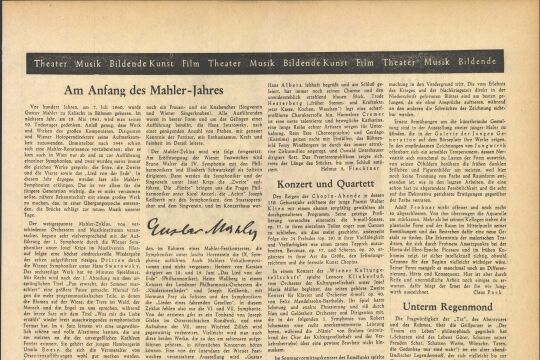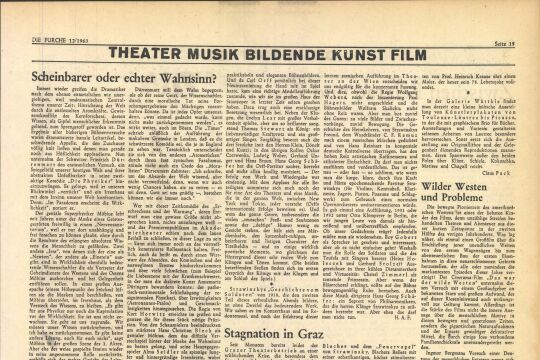Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Von Kornwall zum Wolfgangsee
Den mannigfaltigen Ansprüchen zu genügen, die das Publikum einer großen Provinzstadt traditionsgemäß an sein Musiktheater stellt, ist sicherlich nicht immer leicht. Wirft man einen Blick auf den Spielplan der G r a z e r Oper, so ist man beeindruckt: die Spannweite des Repertoires reicht derzeit vom „Tristan“ bis zum „Weißen Rößl“ oder — geographisch ausgedrückt — von Kornwall bis zum Wolfgangsee. Das ist immerhin imponierend, zumal sich die Werke, die zwischen den beiden Extremen ihren Platz haben, in durchaus respektabler Weise dem Gesamtbild einfügen. Da gibt es Mozart, Verdi, Puccini ebenso wie Weber, Lort-zing, Bellini und die klassische Operette. Was fehlt, ist die moderne Oper: das macht dem Fachmann Kummer, schert aber den als konservativ bekannten Grazer Musikfreund wenig. Was dem auswärtigen Betrachter des Spielplans als Fülle imponiert, erscheint allerdings dem eingeweihten „Konsumenten“ nicht immer in ebenso hellem Licht. So stößt zum Beispiel die geschlossene Aufführung von Wagners „Ring“ auf unüberwindliche Hindernisse, und ein Werk wie der „Tristan“ ist eben ohne Gäste doch nicht zu besetzen. Dennoch muß anerkannt werden, daß zumindest in der Pflege Wagners einiges riskiert wurde; Neben, dem wRiag“, dessen Abende auf Monate Verteilt werden muß-tou.gab es-rieben dem obligaten „Parsifal“ zu Ostern in letzter Zeit auch eine Neuinszenierung des „Tristan“: eine ambitionierte Aufführung unter Klobucars Führung, mit deutlichem Willen zur Stilisierung in Bühnenbild (Skalicki) und Personenregie (W. Weber), eine zwar nicht ideale, dafür aber stimmgewaltige Isolde (Grob-Prandl) und ein brauchbarer, aber nicht sonderlich markanter Tristan (Walter Geisler).
Mit weit gemischteren Gefühlen sah man sich einer Neustudierung des „Freischütz“ gegenüber. Das Unbehagen des Betrachters wurde hervorgerufen durch jene in Graz nicht mehr unbekannte, jedoch höchst fatale Unentschlossenheit der Regie (A Diehl), sich für eine Stilform in der Interpretation zu entscheiden. Eine gewisse Statfk in der Gruppierung, oratorien-haft postierte' Chöre und manche durchaus geglückte Stilisierung der Gestik wechselten ab mit illusionistischen Elementen, die sich in der Wolfsschlucht zu peinlichem Geisterbahnspuk verdichteten. Dazu ein Alptraum von Bühnenbild, in dem die Försterstube als himmelblau getünchte, kahle gotische Kapelle mit Stehleiter und Kleiderhaken figuriert — kurzum, der optische Anteil war kläglich. Um so mehr konnte man sich am Musikalischen delektieren: von einzelnen schwächeren Leistungen abgesehen, waren die Sänger, besonders aber der Chor und das Orchester unter Gustav C z e r n y in erstaunlich guter Form.
Mit einer turbulenten .Inszenierung des guten alten „Weißen Rößl“ hielt der Gastregisseur Ernst Pichler sein Publikum in Atem. Die Einfälle überschlugen sich, ein Gag jagte den anderen, die Drehbühne rotierte fröhlich, — und so übersah man gerne manche Schwächen und künstlichen Streckungen. Womit sich also die Lebensfähigkeit dieses unverwüstlichen Musicals wieder einmal bestätigt hätte.
Im Schauspiel ist der Tisch nach wie vor weit bescheidener gedeckt. Die Stagnation dauert noch immer an, die Hilflosigkeit in der Spielplangestaltung wird immer deprimierender. Neben einer sehr flotten und beweglichen Inszenierung von N i c o I a j s auch in Wien gespielter „Zwiebel“, mit der sich Dr. Gerstinger verabschiedete, um dem Grazer Betrieb zugunsten bundesdeutscher Gefilde den Rük-ken zu kehren — neben dieser hübschen Aufführung und einer indiskutablen Shakespeare-Kasperliade („Viel Lärm um nichts“) im Opernhaus gab es in den letzten Monaten als Neuheit nur Pag-nols liebenswerte Komödie „Die Frau des Bäckers“. Nun ist das zwar auch kein Stück, mit dem man einen kärglichen
Spielplan noch gegen Ende der Saison aufputzen könnte, aber — was man auch immer gegen die gefällige Sentimentalität und volkstümliche Deftigkeit seiner Spiele sagen mag — Pagnol versteht jedenfalls sein Handwerk und ist imstande, ein uraltes Thema (der alte Mann und die junge Frau) so geschickt abzuwandeln, daß ihm einerseits das köstliche Parfüm des „Midi“ anhaftet und es anderseits trotz der kräftigen Lokalfarbe an jedem Punkt der Welt gleich gut verstanden wird. Die Aufführung in den Grazer Kammerspielen — unter dem Gastregisseur Walter Gebhardt — war um Buntheit des Milieus und um Prägnanz der von einer ehrlichen Poesie' erfüllten Schlußszene bemüht, konnte aber manche Süßlichkeit und auch etliche Längen des Stückes nicht vertuschen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!