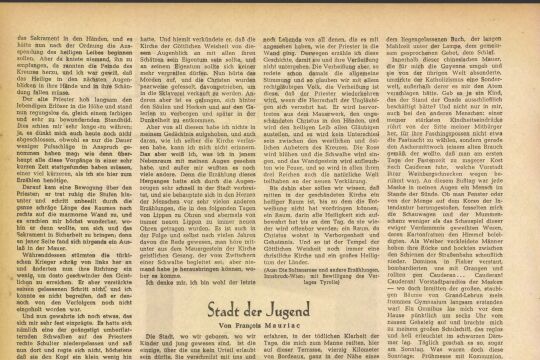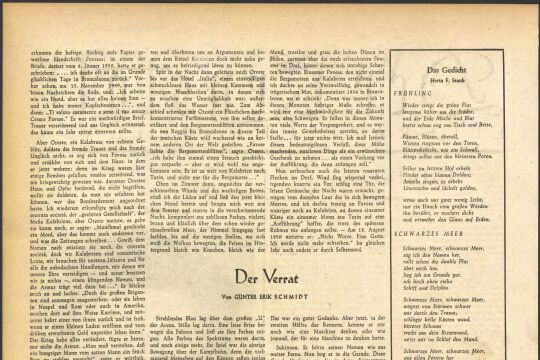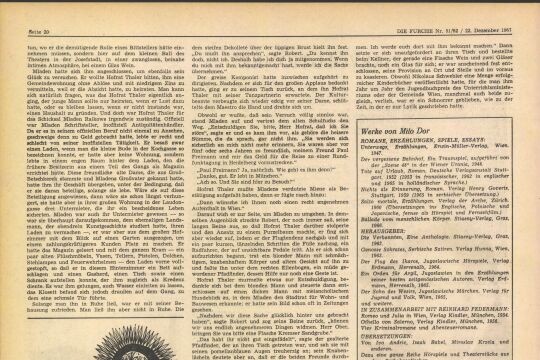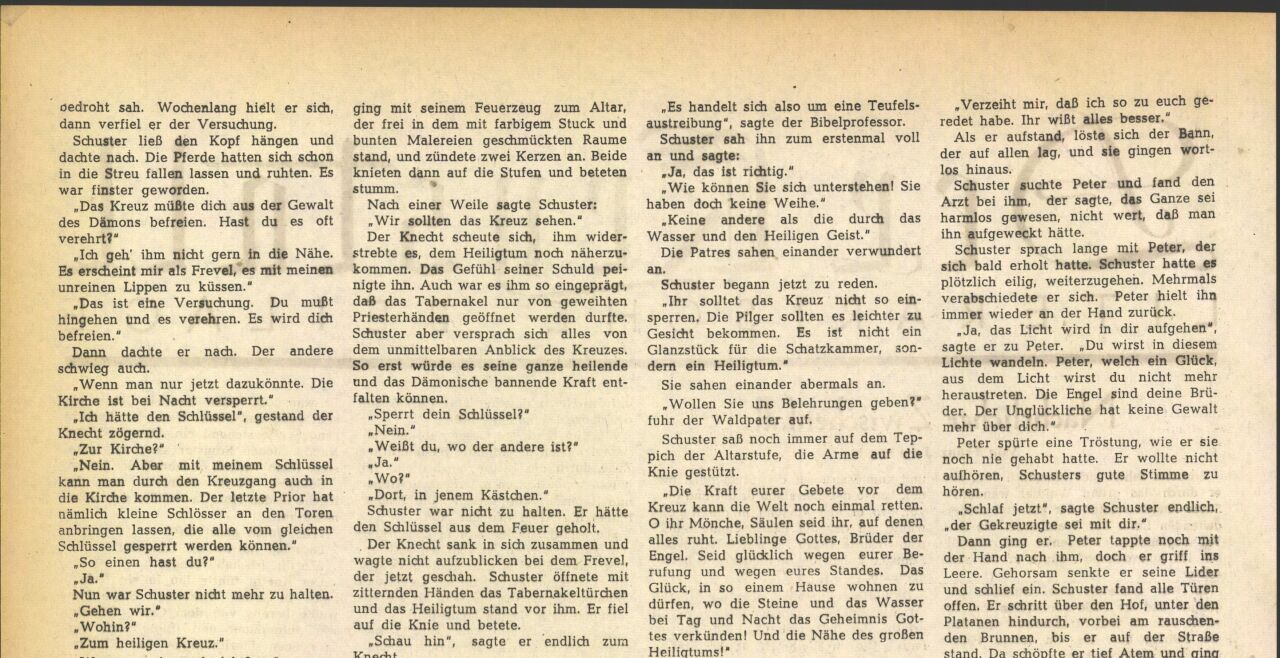
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
ZüricJicr Gesprädie
An der Kaibrücke in Zürich läßt die pausenlose Jagd der Allerweltsautos mir für einen Augenblick Atem und Fuß stocken. Aber schon fühle ich mich von rechts und links untergefaßt, und während die Signalscheibe den Passanten den Weg freigibt, geleitet mich ein älteres Einheimischenehepaar über die Straße. Zwei helle Gesichter von bestem alemannischem Schnitt neigen sich mir zu mit jener ein wenig unpersönlichen Freundlichkeit, mit der dieses alte Gastland seinen Besuchern begegnet. Bald sitzen wir in einer Grünanlage unter einer breitschattenden Plantane und meine Beschützer beginnen die Unterhaltung der Fremden zu Ehren hochdeutsch mit einem gemütlich schwäbischen Anklang, nicht im Schwyzerdütsch, das freilich, seit die totalitäre Drohung im Nordosten verstummt und das Wissen um die Notwendigkeit des Einbaues eines neuen Deutschland in ein neues Europa hier Gemeingut geworden ist, manches von seiner defensiven Ausschließlichkeit verloren hat.
Die stattliche, wohlgekleidete Frau neben mir trägt trotz der Pracht der Haute Couture in den Geschäften der Bahnhofstraße am Kopf ein Seidentüchlein und an den Füßen die soliden Schuhe, in denen schon vor 80 Jahren die Dichterschwestern Regula Keller und Betsy Meyer zum Markt am Stampfenbach gingen. Ich bewundere die Disziplin der spielenden Kinder, die die Rasenflächen so schonsam betreten. „Sie wissen, daß es ihr Schaden ist, wenn sie sie ruinieren“, sagt der Herr und setzt mit einem Pestalozzi-Lächeln hinzu: „Nur nicht zu viel kommandieren und nicht zu viel verbieten, damit sind wir Schweizer immer gut gefahren!“
Gegen Abend sehe ich zwischen den lichtgrünen Buchen des Zürichberges, unter denen Richard Wagner so gerne promenierte, die Hausfrauen der komfortablen Siedlungshäuser stehen und auf das Migrosauto warten, das ihnen Fleisch, Brot, Gemüse und anderen Wirtschaftsbedarf in dieses abgelegene Buen Retiro bringt. — Ob sie nicht besorgten, daß einstweilen bei ihnen eingebrochen werde? — „Warum sollte jemand einbrechen?“ kommt überlegen die Gegenfrage. „Bei uns hat jeder, was er braucht.“
Am 1. Mai bewegt sich durch die Straßen des Industrievorortes Oerlikon ein Maiumzug. Voran ein wohlgenährter und gutgekleideter Fahnenjunker, dem die Last des roten Palladiums unter der heißen Frühlingssonne so manchen Schweißtropfen erpreßt, hinter ihm viele ansehnliche Männer und Frauen von
„Verzeiht mir, daß ich so zu euch geredet habe. Ihr wißt alles besser.“
Als er aufstand, löste sich der Bann, der auf allen lag, und sie gingen wortlos hinaus.
Schuster suchte Peter und fand den Arzt bei ihm, der sagte, das Ganze sei harmlos gewesen, nicht wert, daß man ihn aufgeweckt hätte.
Schuster sprach lange mit Peter, der sich bald erholt hatte. Schuster hatte es plötzlich eilig, weiterzugehen. Mehrmals verabschiedete er sich. Peter hielt ihn immer wieder an der Hand zurück.
„Ja, das Licht wird in dir aufgehen“, sagte er zu Peter. „Du wirst in diesem Lichte wandeln. Peter, welch ein Glück, aus dem Licht wirst du nicht mehr heraustreten. Die Engel sind deine Brüder. Der Unglückliche hat keine Gewalt mehr über dich.“
Peter spürte eine Tröstung, wie er sie noch nie gehabt hatte. Er wollte nicht aufhören, Schusters gute Stimme zu hören.
„Schlaf jetzt“, sagte Schuster endlich, „der Gekreuzigte sei mit dir.“
Dann ging er. Peter tappte noch mit der Hand nach ihm, doch er griff ins Leere. Gehorsam senkte er seine Lider und schlief ein. Schuster fand alle Türen offen. Er schritt über den Hof, unter den Platanen hindurch, vorbei am rauschenden Brunnen, bis er auf der Straße stand. Da schöpfte er tief Atem und ging eilends weiter, ohne sich umzusehen. Groß standen die Sternbilder der Nacht über ihn.
Aus dem Roman „Aber, aber, Herr Schuster“. Mit Bewilligung des Verlages Anton Pustet, Graz-Salzburg. bürgerlichem Äußern mit freundlichen Gesichtern, in munteren Gesprächen.
„Wofür diese Leute demonstrieren, was sie wohl noch zu erreichen wünschten?“ bricht es aus mir hervor. „Vielleicht nur, daß sie das Erworbene bewahren“, erwidert heiter einer von den Züricher Zuschauern und fügt dann ernst hinzu: „So wie wir alle, wenn uns Gott gnädig ist.“
In den Züricher Straßenkiosken gibt es keinen Schmutz und Schund, auch wenig leichtgeschürzte Unterhaltungs-jourale, dafür viele gediegene Zeitschriften in allen Weltsprachen. Die Züricher Buchhandlungen, so wie überall ein nicht durchaus zuverlässiger Spiegel der geistigen und seelischen Landschaft, bevorzugen die großen „Europäer“, Cronin, Graham Greene, Bernanos, Andre Gide, Etienne de Greeffe und von den wenigen Deutschen Hesse und Thomas Mann, der ja in Zürich seinen umstrittenen Goethe-Vortrag hielt. Ich erkundigte mich, was man hier dazu gesagt hätte. Darauf wurde mir die zurückhaltende Antwort zuteil:
„Wir lassen unsere Gäste nach Gutdünken und Vermögen sprechen und vortragen.“ Und dann wies man mir mit Behagen die eigene Hausbibliothek, in der neben Shakespeare, Goethe und Moliere vornehmlich die großen Schweizer, Geß-ner, Keller, Meyer, Zahn und Heer, und der Österreicher Adalbert Stifter stehen.
Diese simplen Gespräche, nicht wie die „Disputationes Turicenses“ im Kreise eines Konrad Ferdinand Meyer und seinen Marienfelder Freunde mit einer hochgeistigen Elite, sondern mit einfachen Bürgern geführt, umreißen das geistige Profil Zürichs, soweit es sich während eines kurzen Aufenthaltes dem aus einer ganz anders geschichteten Umwelt zugereisten Österreicher offenbart. Es ist das stolze, von keinem physischen und moralischen Kriegsstigma Versehrte Antlitz einer Stadt, die sich nicht nur als geistige und materielle Metropole ihres eigenen Landes, sondern auch als eines der großen Zentren des südwestdeutschen Raumes betrachten kann. In dieser / alten Reichsstadt karolingischer Gründung auf keltisch-römischem Siedlungsboden liefen von jeher alle kulturellen Nervenstränge zwischen den Rätischen Alpen, dem Rhein und dem Bodensee, der Jura und dem Schwarzwald zusammen. Das gab und gibt ihr die internationale Aufgeschlossenheit ihrer berühmten Lehr- und Kunststätten, die kosmopolitische Gastfreundlichkeit, die lässig vornehme Gebärde der Duldsamkeit gegenüber den von ihr Beherbergten. Die alte Stadtrepublik, die alle Rütlikämpfe der sieb gestaltenden Eidgenossenschaft ruhmvoll mitmachte, mußte sich in 500 Jahren gegen allzu viele Hände wehren, die sich begehrlich nach ihrem Reichtum und ihrer Eigenwüchsigkeit ausstreckten. Das prägte das Wesen ihrer Bewohner mit jenem Zug vorsichtiger Selbstbehauptung und nüchterner Selbstbeschränkung, der starken Bindung an Überlieferung und Herkommen, die um der Selbsterhaltung willen das innerste Wesen vor dem Fremden verschließt.
Vor dem Züricher Münster steht, in Erz gegossen, Ulrich Zwingli, Reformator und Kriegsmann, mit herb verschlossenen Zügen, so wie er auf dem Kappeler Schlachtfeld den Tod suchte und fand. Nahe der grünen Limmat lächelt auf dem Hintergrund von See und Bergen das weltoffene Antlitz des Malerdichters Salomon Geßner, der mit seinen Idyllen dem verzopften und verspielten Europäer neue dichterische Wege wies. Diese Polarität, die immer wieder im Züricher Charakter aufbricht, hat sich immer wieder im Zeichen vorbehaltloser Vaterlandsliebe geeint.
Es wirkt um so liebenswürdiger und hinreißender, wenn sich die sachliche Haltung eines echten Zürichers im Schwünge eines starken Gefühls löst. Ein solches Erlebnis wurde mir zweimal zuteil. Einmal, als bei einem Gespräch über die internationalen Spannungen und Gefahren gereifte Männer in bürgerlichen Stellungen bekundeten, sie würden im Notfall so wie ihre Vorfahren, sich in den Gebirgen zusammenscharen und ihre demokratische Freiheit, den Lebensatem ihrer Heimat, bis zum letzten verteidigen. Diese Äußerung, ohne Pathos, kühl und ernsthaft getan, ließ keinerlei literarischromantische Deutung zu.
Das zweitemal fiel beim Anblick der in voller Frühlingsschönheit prangenden Stadt das Wort von der Schicksalslosig-keit der Schweiz, als eine Art homerische Insel von der Vorsehung zwischen den Mahlströmen und Sintfluten zweier Weltkriege aufgespart. Da blickten die Züricher nur stumm auf die Rote-Kreuz-Flagge auf dem Dache eines Nachbarhauses, jenem Zeichen nimmermüder, parteiloser Menschenliebe und Hilfsbereitschaft, das sie und ihre Landsleute über allen Schicksalen des selbstmörderischen Europa aufgepflanzt haben.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!