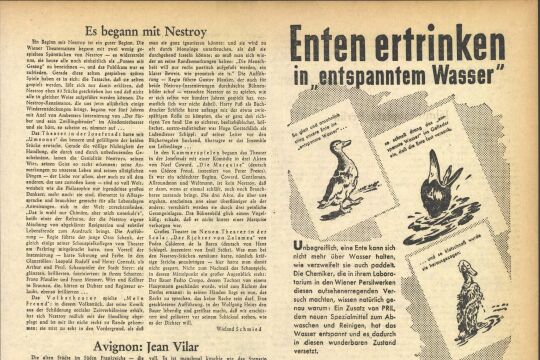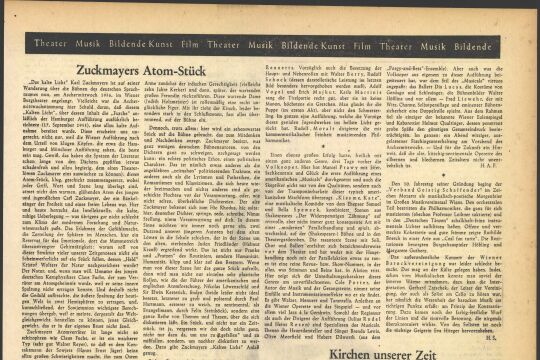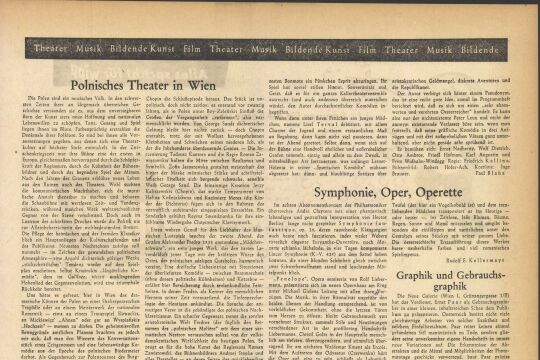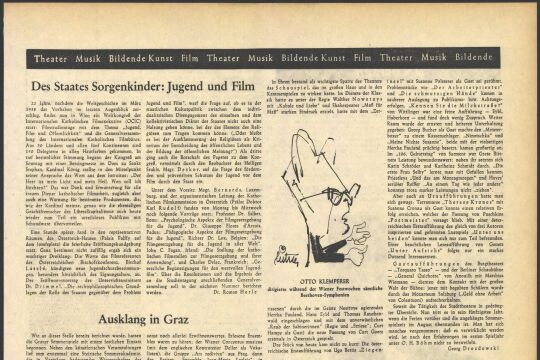Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Klassische Langeweile
Für die Realisierung von Goethes „Tasso“ auf der Bühne von heute bietet sich eine ganze Reihe von Interpretationsmöglichkeiten an — von der musikalisch bestimmten, ästhetisch zelebrierenden Version etwa (wie sie Müthel vor gut 25 Jahren am Burgtheater eingeführt hatte) über die beinahe klinische Studie des „Falles Tasso“ (wie wir sie von Oskar Werner kennen) bis zur neu-linken Parabel vom Kunstproduzenten Tasso, den die (höfische) Gesellschaft sich hält als sublimes Statussymbol (wie sie sich in der Ümfunktionierung von Goethes Stück in der Bremer Inszenierung Peter Steins darbot). Der einzige Effekt von Michael Hampes „Tasso“-Inszenierung in Graz ist — bestenfalls — gepflegte Langeweile: Was sich da in dem synthetischen Arkadien an Ferraras Hof tut (oder vielmehr nicht tut), das ist so himmelweit von unserer Wirklichkeit entfernt, in seinem vermeintlich „klassischen“ Gehaben von solcher Künstlichkeit, daß das Publikum angeödet wird.
Vermutlich wollte der Regisseur das Wort des Dichters möglichst unpathetisch wirken lassen. Er hatte aber nicht bedacht, daß zur Vermittlung eben dieses Wortes, will man es zum Angelpunkt einer Aufführung machen, ausnahmslos nur vorzügliche Sprecher und am klassischen Dichtungstheater geschulte Darsteller gehören. Die Forderung nach solch interpretatorischen Tugenden erfüllte indes nur Diet-lindt Haug, die eine großartig disziplinierte Sanvitale mit kristallener Diktion gab, während Lotte Marquardt Prinzessin) daneben sprachlich stark abfiel und ihr auch darstellerisch für diese Partie jegliches Format fehlte. Unter einem anderen Regisseur wäre der begabte Otto Davis vielleicht ein guter Tasso geworden, hier wirkte er mit Lorbeerkränzlein und biedermeierlichem Mao-Look doch eher deplaciert —
von Adolf Wesselys Herzog ganz zu schweigen, einem Elegant von neureicher Billigkeit, der aussah wie der Besitzer eines Nobelheurigen.
*
Bedeutend besser erging es dem begabten Regisseur Klaus Gmeiner mit einem wenig gespielten Werk Nestroys: „Der Färber und sein Zwillingsbruder“ hatte zwar in den fünfziger Jahren die österreichische Nestroy-Renaissance eingeleitet, ist aber nichtsdestoweniger ein dramaturgisch nicht eben starkes Stück. Die Falltüren und Fußangeln, die die Doppelrolle bietet, werden kaum oder gar nicht ausgenützt; Nestroy hat sich weit mehr dem Motiv vom schüchternen kleinen Mann verschrieben, den der Zufall plötzlich zu unerhörten kriegerischen Taten und damit verbundenen militärischen Ehren hinauf katapultiert. Von dieser Komik lebt der zweite Akt, während der letzte sich ein bißchen mühsam dem Ende zuschleppt. Dafür aber ergießt sich über den ersten Akt ein wahrer Goldregen von Aphorismen und Bonmots, die der Autor aus dem Zusammenprall von Begriffen wie Zoll und Zöllner, Krieg und Ehe, Farbe und Färber bezieht. Die vielen Weisheiten und Bissigkeiten werden von dem großen Nestroy-Darsteller Anton Lehmann gekonnt ans Publikum gebracht, die Figur des Färbers Blau jedoch schien Lehmann nicht mehr ganz zu liegen. Fritz Holzer als löwenschluchtscher Bedienter bewies sehr eindrucksvoll seine Fähigkeit, Nestroy zu spielen und zu sprechen.
Ballettmeister Fred Marteny, den der Grazer Intendant Schubert unverzeihlicherweise ziehen läßt, gab seine letzte abendfüllende Veranstaltung im Opernhaus. Leo Dilibes' populäre „Coppeita“ wurde in Mar-tenys Choreographie zu einem großen Erfolg nicht nur für die hervorragende Primaballerina Marie-Louise Wilderijkx und ihren Partner
Michel Rahn, sondern auch für das wohltrainierte, zahlenmäßig aber schon recht dezimierte Corps de ballet. Die dekorativen Bühnenbilder Wolfram Skalickis trugen ebenso zum Gelingen des Abends entscheidend bei.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!