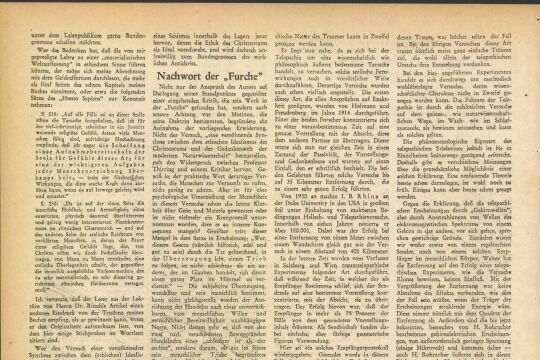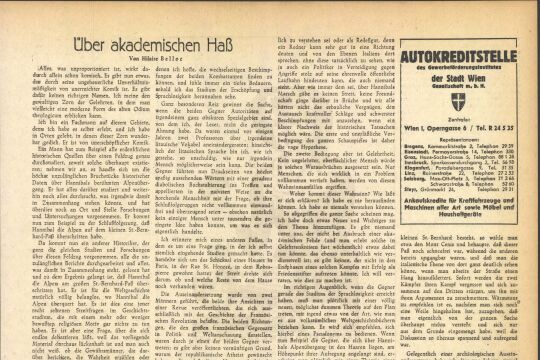Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Rasputin stirbt zu oft
Kaum hat man Stemmle verkraftet, kommt schon Hossein — mit einem flimmernden Porträt von Rasputin. Diesmal sollte die Sache noch dokumentarischer, noch authentischer sein, gleichwohl es sich erneut um ein Spiel, also weithin um Fiktives, Erdachtes handelt. Der Anspruch wird wie folgt begründet: „Der Mörder schrieb das Drehbuch” (so der Titel eines einschlägigen Artikels). Der Mörder des russischen Mönchs ist angeblich der russische Fürst Jussupoff. Er starb kürzlich, lebte aber noch zur Entstehungszeit des Films hochbetagt im französischen Exil. Aber er hat das Szenario zu dem Film „Ich habe Rasputin getötet” nicht verfaßt. Das taten Alain Decaux, Claude Desailly und Robert Hossein, der das — übrigens von Jussupoff hernach mißbilligte — Spektakel nicht eben zur vollen Freude der Kritik auch inszenierte.
Der deutsche Robert (A. Stemmle) hatte, so wurde geflissentlich gemeldet, für seine vom Zweiten Deutschen Fernsehen ausgestrahlte Bildschirmfassung in zwei Teilen alle nur erreichbaren Unterlagen benützt, darunter auch solche eines 1918/19 tätigen sowjetischen Untersuchungsausschusses. Der französische Robert (Hossein) folgte, so lauteten ebenfalls gewisse Informationen, in seinem Lichtspiel getreulich einem Bericht von Felix Felixowitsch Jussupoff. Der fürstliche Report schildert — natürlich vom Standpunkt des Autors — die einzelnen Vorgänge, vor allem die der Ermordung Rasputins, bis ins letzte Detail. Erscheinen sie auch so auf der Leinwand? Keineswegs! Sie mußten sich dramaturgischen Gesetzen und sonstigen, auf Publikumswirksamkeit, d. h. Effekte bedachten Manipulationen unterwerfen. Auch gab es Schwierigkeiten anderer, zum Beispiel physischer Art — so etwa bei Peter McEnery, dem Mörderinterpreten, der leider Linkshänder ist, mit der rechten Hand nicht schießen kann und daher notgedrungen beidhändig auf das Opfer feuert, was den historischen Tatsachen nicht entspricht. Gewiß, nur eine Kleinigkeit, doch unter den obtval- tenden Umständen zählt auch sie.
Man sollte eben die Exaktheit der Wiedergabe von etwas, das im Spiel rekonstruiert wird, propagandistisch nicht so sehr Herausstellen (Hossein: „Der Film wird die Anatomie eines Mordes sein”; verwegen sprach er auch von „Cinėma Vėritė”, der vom Fernsehen abgeguckten „Kinowahrheit”). Doch ist der Hinweis auf den dokumentarischen Charakter hier nur ein Vorwand. Früher bot man denselben Gegenstand kinematographisch schlicht als Sensation an — mit viel Dämonie, wollüstigen Orgien, breit ausgespielter Tötung, d. h. deren „Eskalation” vom Gift bis zum Abknallen und Niederknüppeln des immer noch Lebenden. Mehr beabsichtigte man bei solchen Darbietungen nicht. Man war anspruchsloser, irgendwie redlicher.
Tatsächlich ging und geht es bei diesem Stoff weniger um geschichtliche Treue, faktische Echtheit, sondern um die Schilderung eines einzigen, großen Abenteuers — das nämlich von Grigorij Jefimowitsch Rasputin, einem Bauern, der zum mächtigsten Mann im Zarenreich aufstieg und dessen Wesen bis heute recht unterschiedlich, vielfach gegensätzlich beurteilt wird. War er ein „Heiliger” oder ein „Teufel”, ein „Wunderarzt” oder ein „Scharlatan”, ein „Betrüger” oder ein „Ehrenmann”, ein „Narr” oder ein „kluger Kopf”, ein „Patriot” oder ein „Vaterlandsverräter” (dies etwa im Komplott mit der Deutschen, d. h. der Zarin, einer gebürtigen hessischen Prinzessin, und den Deutschen, mit denen er einen Sonderfrieden schließen wollte)? Man weiß es nicht. Niemand weiß das — auch kein Drehbuchautor, kein Film- oder Fernsehregisseur. Im Grunde wollen diese es auch gar nicht wissen. Sie haben ja nicht die Absicht, Geschichte zu dozieren, sondern Geschickten zu erzählen. Das ist etwas anderes.
Schon vierzig Jahre lang erzählt man Rasputin-Geschichten. Das geschieht in Büchern, auf der Bühne, der Leinwand und neuerdings auch auf dem Bildschirm. Kinematographisch begann es bereits 1918 mit dem amerikanischen Streifen „Der Sturz der Romanows” von Herbert Brenon (der rund ein Jahrzehnt später unter demselben Titel erschienene Sowjetfilm von Esther Schub hat mehr dokumentarischen Charakter). Und es wird heuer — nach wenigstens einem Dutzend Kinoerzeugnissen und Fernsehproduhtionen — gewiß nicht enden. So sind gegenwärtig beispielsweise die Russen damit beschäftigt, dasselbe Thema in einem Zelluloidgebilde „Der Antichrist” abzuhandeln, allerdings in Form einer ideologischen Auseinandersetzung mit antibürgerlicher, antireligiöser Tendenz. Auch hört man von anderen Plänen, etwa solchen Hollywoods.
Nach seinem unnatürlichen Tod im Jahre ‘1916 starb Rasputin noch viele Male in effigie, filmisch und televisionär. Er starb als „Heiliger Teufel”, als „Dämon des Zaren”, „Dämon der Frauen”, „Dämon von Rußland” usw. Er starb in amerikanischen, deutschen, französischen, italienischen und anderen Studios. Er starb realistisch, naturalistisch, „veristisch” und auch stillos beziehungsweise geschmacklos. Er starb schwarzweiß, farbig, im Normalformat, auf Breitwand, in den TV-Zeilennormen von 405 bis 819, am häufigsten freilich 625-Standard. Er starb in Gestalt von Conrad Veidt, Harry Baur, Pierre Brasseur, Gert Fröbe (um nur die bedeutendsten Darsteller zu nennen). Und wie er das tat — es waren fast immer Glanzleistungen der Interpretation.
Rasputin stirbt zu oft. Es genügt jetzt. Man sollte ihn endlich in Ruhe lassen. Zumal sein Tod auch in der dauernden Wiederholung nicht besser wird. Und doch nichts dabei herauskommt — wenigstens für die Geschichte nicht. Daß die Filmbesucher und Fernsehzuschauer sich angesichts der abscheulichen Haupt- und Staatsaktion unterhalten, womöglich ergötzen, ist ja kein Argument. Das können sie auch bei Bob Hope, Fernandel oder Millowitsch, wahrscheinlich sogar besser, jedenfalls weniger grausam…
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!