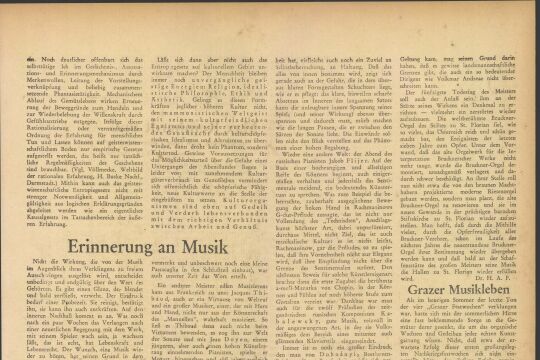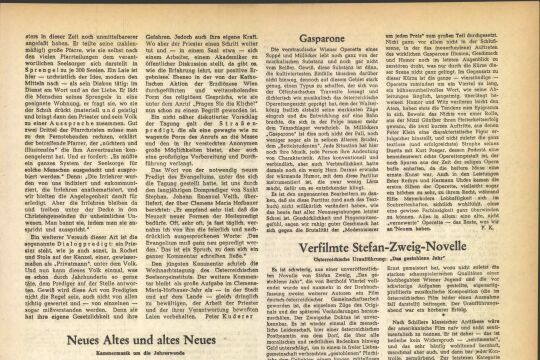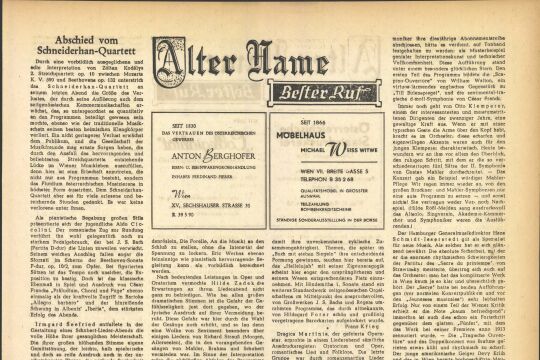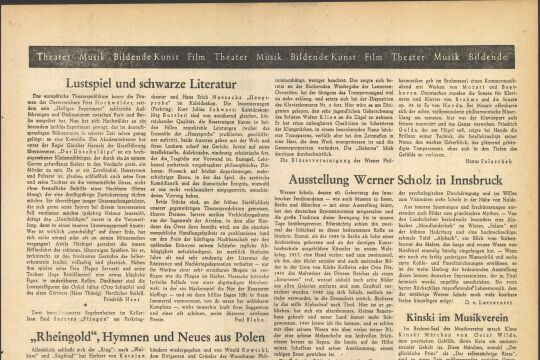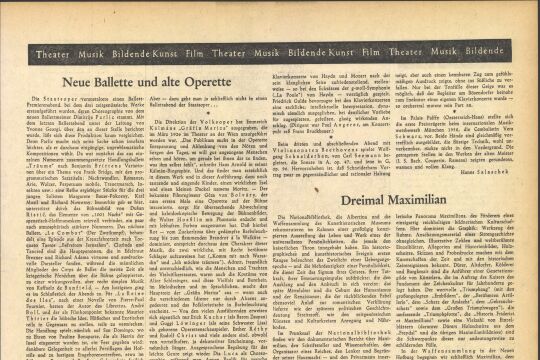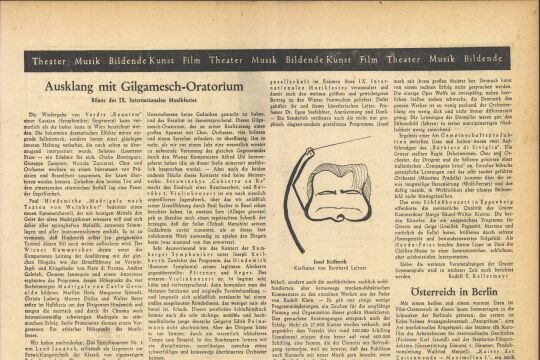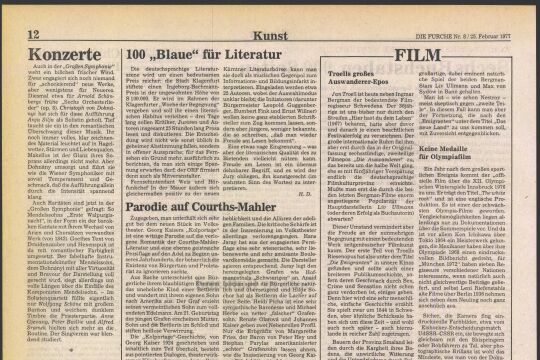Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Blick in zwei Welten
Zwei Meisterpianisten, die das Publikum in Aufregung versetzen können: Vladimir Ashkenazy spielte im Musikverein Rachmaninoffs 3. Klavierkonzert, und Rudolf Serkin, der große alte Herr unter den Starinterpreten der Wiener Klassik, setzte sich im Konzerthaus mit Beethoven auseinander. Zwei Abende - zwei Stile, Klavier zu spielen, zwei musikalische Weltanschauungen, zwei Welten.
Ashkenazy ist sozusagen ein Motor. Ein Computer, der Rachmaninoffs sonst eher schwerblütig, prunkvoll und sentimental aufgebauschte Klavierkonzerte bis zum Skelett abräumt. Und damit einen Rachmaninoff hervorkehrt, der klanglich schlank, kraftvoll, hochdramatisch wirkt. Die Entschlak-kungskur hat dem Altmeister des Salonkonzerts jedenfalls gutgetan. So leidenschaftlich, so virtuos, mit so sicherem Geschmack aufgeführt, fesselt dieses 3. Klavierkonzert.
Dabei kann man Ashkenazy keineswegs Gefühlskalte nachsagen: er vermeidet nur das dicke Aufträgen, in dem manche mittelmäßige Pianisten schwelgen, wie er alle persönlichen Überzeichnungen unterläßt. Bei aller Rasanz der Tempi, bei aller Farbigkeit des Ausdrucks wirkt sein Spiel stets klar, sachlich, distanziert. Und manchmal, wenn’s aus den Melodien gar zu schwülstig trieft, merkt man auch den Anflug von Ironie, mit dem dieser Meisterpianist dem Publikum zuzwinkert.
Ashkenazy kam mit Colin Davis und dem London Symphony Orchestra. Und in ihnen hat er bei Rachmaninoff Idealpartner. Davis kultiviert einen schlanken, romantischen Stil, dosiert alle Effekte in seinem Orchester mit höchster Präzision, ohne daß es an Schmelz, an dunklem Streichergeschum-mer, am samtigen Orchesterpedal fehlte. ^Weniger Vergnügen bėrei--tete Davis hingegen mit seiner*Auf-führung von Brahms’ „Vierter“: Eine Materialschlacht gegen Brahms. Nervös aufgeheizt, keuchend, als müßte Brahms gegen Tschaikowskys „Fünfte“ im Wettrennen bestehen.
Wer Ashkenazys Wunderwelt moderner Sachlichkeit, die Eleganz seines „objektiven“ Klavierstils, mit Rudolf Serkin vergleichen konnte, erlebte, was allein Persönlichkeit am Klavier bewirken kann: Serkin, 74, spielte die „Mondscheinsonate“, die „Appassionata“ und Opus 106, die Hammerklaviersonate. Nichts war hier von der gepflegten Glätte so vieler Beethoven-Abende zu spüren, nichts von der rasanten Fingerfertigkeit, in die sich manche Pianisten im Opus 106 flüchten. Serkin spielte wie ein Tischler, bei dem die Hobelspäne fliegen. Gepflegtes Spiel, die überfeinerte Anschlagskultur scheinen ihm egal zu sein. Er meißelt geradezu an den Sonaten. Taucht tief hinein ins musikalische Material, hört hinein, arbeitet mit der Besessenheit eines Künstlers, der alles seiner Konzeption unterordnet, alles diesem Konzept entsprechend abschleift. Höchst subjektiv, aber zwingend. Natürlich geht er dabei manchmal eigenwillige Wege. Tempi werden radikal gesteigert. Manche Läufe verschummert. Andere wieder aggressiv gesteigert. Aber es bleibt dennoch interessant, weil hinter all seinen Eigenbröteleien doch die Vorstellungen dieses Künstlers spürbar werden. Vorstellungen, die wert sind, sich mit ihnen kritisch auseinanderzusetzen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!