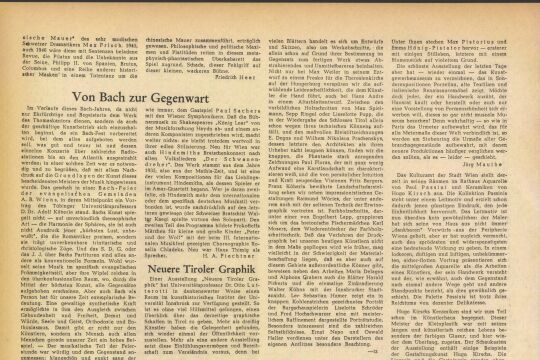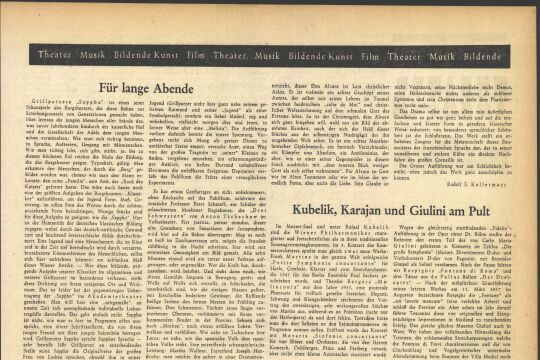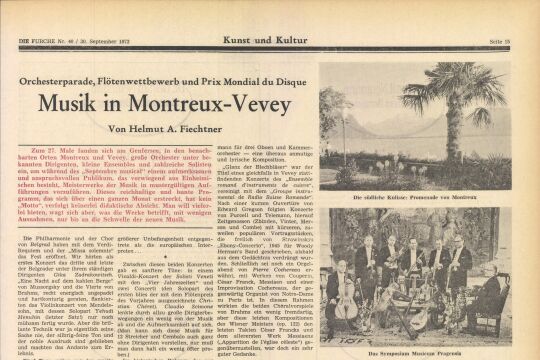Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Aus dem Konzertsaal
Der Beitrag Englands zu der Entwicklung der Kunstmusik des 15. und 16. Jahrhunderts war nicht nur durch das Schaffen bedeutender Tonsetzer des Landes, wie Dunstable, Dowland, Morley und Gibbons, gegeben, sondern auch durch die Musizierfreudigkeit, mit der sich das englische Musikleben dieser Epoche mit italienischen, französischen und spanischen Komponistengruppen auseinandersetzte. Von den nicht wenigen englischen Gesellschaften, die sich heutzutage mit der Pflege alter Musik beschäftigen, gab jetzt das von John Beckett geleitete Londoner Ensemble „Musica reservata“ ein Gastspiel im Brahmssaal unter dem Motto „Musik aus der Zeit des Christoph Columbus“. Unter den aufgeführten Liederkomponisten traten Juan del Encina, Vasquez und Mu-darra besonders hervor, schöne Instrumentalstücke steuerte u. a. Antonio de Cabezön bei. In den hauptsächlich von Streichern begleiteten Vokalstücken ist die Gesangstimme absolut dominierend. Die vorzüglich musizierenden Gäste bewährten sich in einer dem historischen Stil möglichst gerecht werdenden Aufführungspraxis, welche expressive Melodieführung, Satztechnik und musikalische Form deutlich in Erscheinung treten ließ.
*
Adam Harasiewicz hat man von früheren Abenden her in guter Erinnerung. Daß er sich diesmal mit Mozarts — als Einspielstück? — wenig freundlich behandelter A-Dur-Sonate, KV 331, nicht aufs beste einführte, ließen seine drei Chopin-Mazurken, noch mehr die As-Dur-Ballade schnell vergessen. Der Künstler spielt Chopin mit markantem Anschlag, aber dennoch mit romantischem Ausdruck, läßt gerne Glanzlichter seiner fulminanten Technik aufleuchten. Ravels dreisätziger Sonatine, einer dezent malenden Klangphantasie, kommt Harasiewicz mit reicher Anschlagspalette und feinen dynamischen Abstufungen bei. Daß der nicht zu Liszts glücklichsten Eingebungen zählende „Mephisto-Walzer“ als Erfolgsstück von den Pianisten gerne gespielt wird, bestätigte Harasiewicz bald als passionierter Fingerakrobat, bald als gewaltiger Tastendonnerer ä la Cherkassky. Mehrere Draufgaben im vollbesetzten Brahmssaal.
Paul Lorenz
*
So wenig festlich ist die „Große Symphonie“ im Musikverein wohl noch nie eröffnet worden. Ein Abend, an dem die Symphoniker unter Heinz Wallberg bloß routiniert, grau in grau, ohne viel Feingefühl sich ihrer Aufgaben entledigten. Vor allem bei Tschaikowskys Violinkonzert assistierten sie ohne jede Spannung. Wallberg, der für Yuri Temir-kanow einsprang, beschränkte sich aufs Zusammenhalten der Instrumentalgruppen. Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“ haben wir schon lange nicht so lärmend, das heißt, so wenig differenziert gehört. Wen wundert's, daß die Steigerungen „aufgesetzt“ wirkten, weil die einzelnen Stücke jeweils schon vom Anfang an zu plump und grobschlächtig realisiert wurden. Elastischer zeigte sich das Orchester bei Haydns „Ox-ford“-Symphonie (Nr. 92), die immerhin klanglich schlank, feinglied-rig, kultiviert gespielt wurde. — Daß das Konzert dennoch ein ' Ereignis bescherte, war der jungen Geigerin Kyung-Wha Chung zu danken. Das preisgekrönte, international erfolgreiche Geigenwunder, ist dem Wiener Publikum seit November 1971 bekannt: eine rasante junge Dame mit hervorragender Technik, überragender Musikalität, Geschmack. Brillant gelangen ihr die Rahmensätze in Tschaikowskys D-Dur-Konzert, geschmeidig, fein schattiert die Canzonetta. Man kann auf ihren Soloabend im Musikverein gespannt sein.
Auch im ORF-Sendesaal beginnt die neue Saison mit einem Nationalitätenreigen: Miltiades Caridis, nun Philharmonikerchef in Oslo, führte mit den Tonkünstlern Ravels „Ma mere l'oye'“, Blochs „Schelomo“, Valens „Friedhof am Meer“ und Kodälys „Hary Janos-Suite“ auf; Musik aus Frankreich, Israel, Norwegen, Ungarn. Novität für Wien war das Werk Olav Fartein Valens, eines norwegischen Komponisten, Jahrgang 1887, der zeitweise in Madagaskar gelebt und bei Bruch in Berlin studiert hat. (Er starb 1952.) „Der Friedhof am Meer“, 1933 in Mallorca entstanden und durch Paul Valerys gleichnamiges Gedicht angeregt, ist eine symphonische Dichtung, deren Spannungen und Steigerungen vor allem aus dem emotionellen Bereich kommen. Ein gedämpftes, in dunklen koloristischen Valeurs dahinwallendes Stück voll Poesie. Sauber erarbeitet wirkte die Wiedergabe der Bloch-Rhapsodie, in der die amerikanische Cellistin Christine Walevska Temperament, Ausdruckskraft, brillante Technik nachwies.
*
Ebenfalls Im Sendesaal gastierte das 1964 gegründete Nipponia-Ensemble aus Tokio mit klassischer und neuerer japanischer Musik. Seinen Aufgaben entsprechend ist es eine Gruppe aus prominenten japanischen Solisten und Komponisten, die auf traditionellen japanischen Instrumenten spielen: auf lautenartigen Saiteninstrumenten (Sangen und Biwa), auf einer Art Brettzither (Koto), auf Flöten (Nokan, Shakuhachi, Shinobue) und Schlagzeug. Aus dieser Zusammensetzung ergibt sich der nervös rasselnde, flirrende, stets scharfe Originalklang der Stücke, denen oft eine ebenfalls etwas scharfe Singstimme gegenübersteht. Aufgeführt wurden Festmusiken des alten Tokio, Stücke des 17. und 18. Jahrhunderts für die einzelnen Instrumentengruppen, schließlich Kompositionen von Mi-noru Miki, dem Leiter des Ensembles und Nagasawa; Piecen, in denen traditionelle Kompositionselemente Ritualmusik die streng klassische japanische Technik in Paraphrasen abgewandelt werden, die für uns allerdings doch ein wenig den Charakter von Delfter Chinoiserien haben.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!