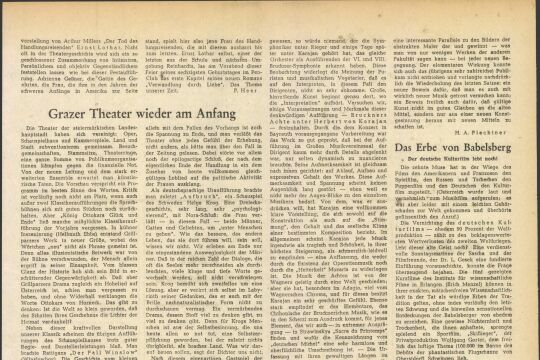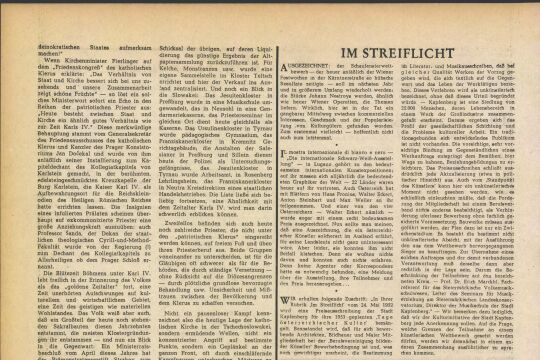Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Boulez reformiert den Konzertbetrieb
„In der Metropolitan Opera nichts Neues!’, wäre über die Eröffnung der zweiundzwanzigsten und letzten Spielzeit des Hauses unter Führung Rudolf Bings eine Falschmeldung. Gewiß: Sparmaßnahmen lassen keine einzige Uraufführung zu. Und nach dem Fehlschlagen einiger Versuche, den Spielplan mit zeitgenössischen Werken aufzufrischen, setzt man, um volle Häuser zu garantieren, wieder auf sichere Pferde. Unter den fünfundzwanzig zur Aufführung vorgesehenen Opern stehen, die Nationalität der Komponisten betreffend, die Italiener mit elf an der Spitze; Deutsche und Österreicher sind mit neun, Franzosen mit fünf Werken repräsentiert, Amerikaner fehlen.
„In der Metropolitan Opera nichts Neues!’, wäre über die Eröffnung der zweiundzwanzigsten und letzten Spielzeit des Hauses unter Führung Rudolf Bings eine Falschmeldung. Gewiß: Sparmaßnahmen lassen keine einzige Uraufführung zu. Und nach dem Fehlschlagen einiger Versuche, den Spielplan mit zeitgenössischen Werken aufzufrischen, setzt man, um volle Häuser zu garantieren, wieder auf sichere Pferde. Unter den fünfundzwanzig zur Aufführung vorgesehenen Opern stehen, die Nationalität der Komponisten betreffend, die Italiener mit elf an der Spitze; Deutsche und Österreicher sind mit neun, Franzosen mit fünf Werken repräsentiert, Amerikaner fehlen.
Die Zahl der allein für die Erstdarbietungen bestimmten Dirigenten ist ebenso unökonomisch wie schwindelerregend: sie beläuft sich auf achtzehn, und in ihr sind die hauseigenen musikalischen Leiter der Wiederholungsvorstellungen nicht miteingeschlossen. Sparsamer dosiert sind die Neueinstudierungen, in chronologischer Folge Webers „Der Freischütz“ (mit Pilar Lorengar, Edith Mathis, Sändor Konya, Gerd Feldhoff, und von Leopold Ludwig dirigiert); Wagners „Tristan und Isolde“ (Jess Thomas, Birgit Nilsson, Cesare Šiepi, Thomas Stewart; Dirigent: Erich Leinsdorf); Debussys „Pellėas und Mėlisande“ (Barry McDaniel, Teresa Stratas und Giorgio Tozzi; am Pult: Colin Davis); Donizettis „Die Regimentstochter“ (Joan Sutherland, Luciano Pavarotti, Fernando Corena und — in einer Sprechrolle — Ljuba Welitsch; von Richard Bonynge dirigiert); und Verdis „Othello“ (James McCracken, Teresa Zylis-Gara, Sherill Milnes; musikalische Leitung: Karl Böhm). Das Regiment der Stabführer setzt sich außer den Genannten aus den Generalmusikdirektoren von Frankfurt, Augsburg und Mannheim — Christoph von Dohnänyi, Gäbor öt- vös, Hans Wallat — und aus Francesco Molinari-Pradelli, Christopher Keene, John Richard, Carlo Fran, Michelangelo Veltri, James Levine, Alain Lombard, Serge Baudo, Thomas Schippers und Franz Allere zusammen. Ein Luxus, mit dem Bings Nachfolger Göran Gentele durch die Bestellung Rafael Kubeliks als musikalischen Leiter des Hauses weitgehend aufräumen dürfte.
„Bellende Hunde beißen nicht!“ Pierre Boulez, vor dessen radikalen Neuerungsplänen die Abonnenten der philharmonischen Konzerte erzitterten, hat für das erste Jahr seiner Tätigkeit als Chefdirigent und musikalischer Direktor des Orchesters das denkbar ausgewogenste Programm gewählt. Es wird vom symphonischen Schaffen Franz Liszts und, zum kleineren Teil, vom Oeuvre Alban Bergs beherrscht; jenes, um ein vernachlässigtes Kapitel musikalischer Entwicklung aufzuzeigen, dieses, um den „Wozzeck“- und „Lulu“-Komponisten als einen der drei Hauptrepräsentanten der Neuen Wiener Schule auch beim Konzertpublikum als Bahnbrecher einzuführen. Boulez teilt die Leitung von 36 Programmen mit Leonard Bernstein, dem „Ehrendirigenten“ des Orchesters, und mit sieben Kollegen (Michael Gielen, Lorin Maazel, Karel Ancerl, Bruno Madema, Michael Tilson Thomas, Istvan Kertėsz, Dean Dixon). Mit vier Veranstaltungen im „Shakespeare-Theater“ erhält das Jahrespensum einen Ruck ins Zeitgenössische, besser gesagt: ins Zukünftige. Wer sich der Mühe unterzieht, die Komponistennamen auf ein Blatt Papier zu schreiben, dem werden dreißig Linien nicht genügen. Gute sechzig wird er brauchen, will er jedem Werk eine Zeile widmen. Quantitativ vieles zu bieten, scheint Boulez dem Wunsch gleichgesetzt zu haben, qualitativ Bestes zu geben.
Wer aber hätte von einem der „überladenen Musik des 19. Jahrhunderts“ abholden Mann die große, dem Schaffen eines Bruckner, eines Mahler, eines Richard Strauss eingeräumte Bedeutung erwartet? Wer vermutet, daß jedem Nono ein Tschaikowsky, jedem Ligeti ein Rachmaninoff, Arnold Schönberg Mussorgsky, Hindemith Debussy, Bartök Berlioz, kurz gesagt: allem „Neuen“ ein „Altes“ entsprechen werde? Und daß dabei immer noch Platz für eingestreute Seltenheiten verbleibt: für ein Klarinettenkonzert Webers, für Holsts „Planeten“, für Arbeiten von įves, Carter, Varėse, Riegger, Ruggles und Barber, da für Chopin, dort für Prokofieff — man könnte ad libitum fortfahren. Ebenso ausgewogen ist die Paarung der einzelnen Werke, sei es, um sie als Dokumente einer stilistischen Formgebung zusammenzufassen, sei es, um die Kontrastwirkung ihrer Stile zu verschärfen. Boulez sieht es als Verpflichtung an, daß die Kontinuität der musikalischen Entwicklung durch seine Spielplangestaltung ein neues Gesicht erhalte. Und Kontinuität ist nicht etwas in sich Verharrendes, sondern ein ständig Weiterfließendes. Man wird erkennen, welche neuen Gesichter die Musik durch Liszt und Berg erhalten hat, auch sie keine endgültigen, sondern von später Gekommenen umgeformte Gesichter, über deren Ausdruck bereite die noch nicht klar erkennbaren Konturen weiterer Veränderungen liegen. Was Boulez zu unternehmen wagt, läßt sich Erziehungsarbeit, Schrulle, unlösbares Unterfangen nennen. Da er aber seine Aufgabe als eine Sendung ernst nimmt, kann man für die Jahre seiner Tätigkeit an der Spitze der New Yorker Philharmoniker ein besseres Verstehen- und Kennenlemen jeder Musik, einen gesamtkulturellen Gesundungsprozeß erwarten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!