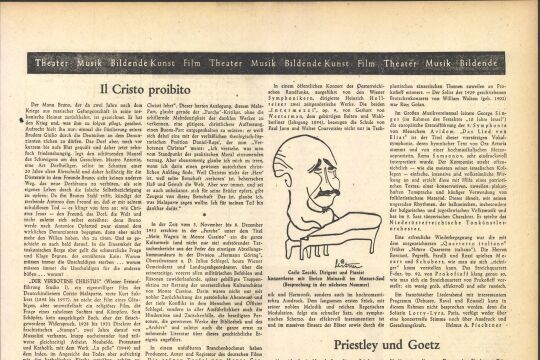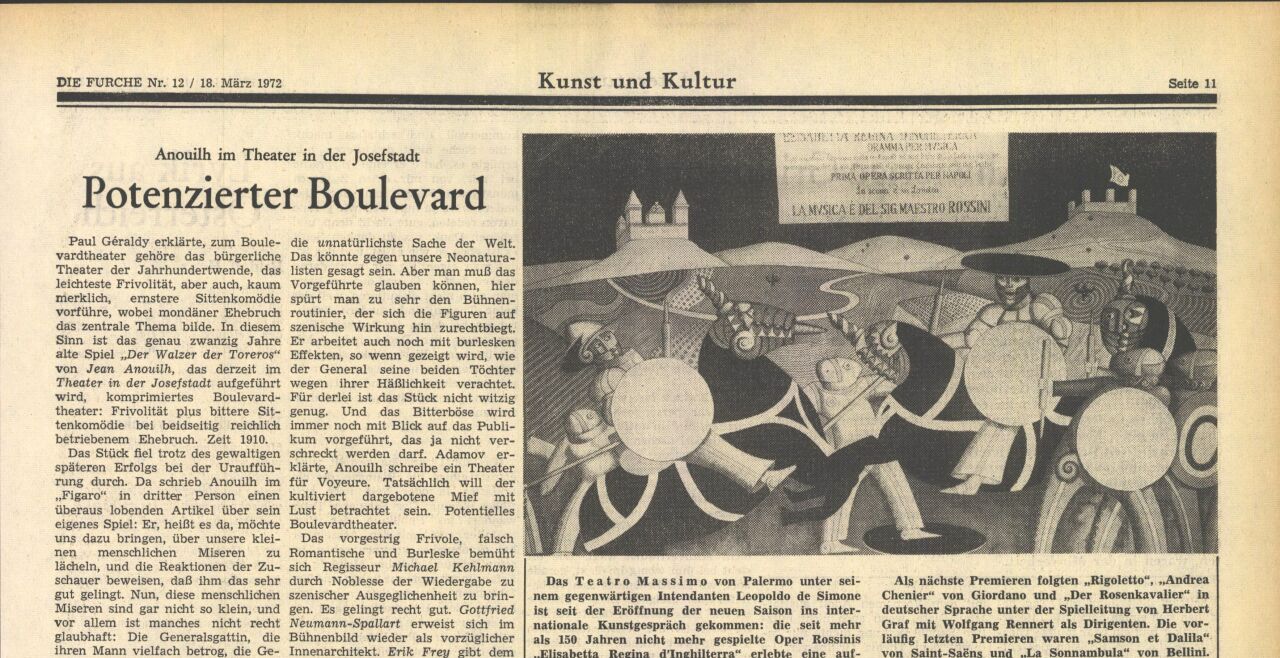
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Candada“
Peter Keuschnig und das ORF-Orchester, immer auf der Suche nach Neuem und selten Gespieltem, haben in ihrem letzten Konzert vier Werke von österreichischen Komponisten (unter ihnen einen Wahl-Salzburger) vorgestellt, die den Jahrgängen 19Ö5 bis 1917 entstammen.
Peter Keuschnig und das ORF-Orchester, immer auf der Suche nach Neuem und selten Gespieltem, haben in ihrem letzten Konzert vier Werke von österreichischen Komponisten (unter ihnen einen Wahl-Salzburger) vorgestellt, die den Jahrgängen 19Ö5 bis 1917 entstammen.
Ein Stück Wiener Musikgeschichte spiegelt sich im Leben und Werk Leopold Spinners, der 1906 in Lemberg geboren wurde, in Wien zunächst Schüler des Schönberg-Schülers Paul Amadeus Pisk war und danach, von 1935 bis 1938, intensiv bei Anton von Webern lernte. Er emigrierte zunächst nach den USA und lebt heute, komponierend und unterrichtend, in London. Spinner erhielt 1934 den Hertzka-Preis der Universal-Edition, wurde bei mehreren Musikfesten der IGNM aufgeführt und widmete sein op. 18, mit welchem das ORF-Konzert unter Keuschnig begann, Igor Strawinsky. „Prelud and Variations“ für mittleres Orchester mit Celesta, Harfe und vielerlei Schlagzeug ist technisch eine Kombination von Schönberg-scher Reihentechnik und Webern-scher Teilmotivarbeit, die vornehmlich zu Klangfarbenmelodien benützt wird. Drei-, vier- und fünftönige Grundgestalten werden in allen möglichen Kombinationen eingesetzt und variiert. Im ganzen: eines jener vielen Zwölftonwerke, dem man, obwohl sauber gearbeitet und gut durchgehört, wenig Chancen für die nächsten fünfzig Jahre gibt.
Theodor Berger, Jahrgang 1905, hat zwei abendfüllende Ballette und zahlreiche Orchesterwerke, meist mit programmatischen Titeln geschrieben. In seinem Opusverzeichnis gibt es kaum Kammermusik, kein einziges Lied. Statt des angekündigten „Divertimento für Männerchor und Instrumente“ wurde Bergers „Rondo ostinato“ nach einem spanischen Motiv gespielt, das in seiner ersten Fassung für zwanzig Blechbläser, in einer neueren für 12 Blech-, 12 Holzbläser und Schlagwerk geschrieben ist. Merkwürdig in fast allen Stük-ken dieses in einem kleinen Ort in Niederösterreich geborenen Komponisten ist das Orientalisierende seiner Melodik und Harmonik. Pikant in diesem Werk, das sich bereits seit 25 Jahren auf den Programmen der Wiener Orchester hält und wiederholt bei Tourneen exportiert wurde, ist der ostinate 13/s-Rhythmus, originell auch seine relativ einfache Struktur und Machart.
Rolf Maedel, 1917 in Berlin geboren, bei Ernst Pepping und Johann Nepomuk David ausgebildet, lebt seit 1947 in Salzburg, zunächst als Assistent Bernhard Baumgartners, jetzt als Theorielehrer am Mozarteum. Sein viersätziges Konzert für Streicher und Cembalo, das Maurina Mauriello spielte, steht durchaus auf dem Boden der Tona-lität, lehnt sich an das barocke Con-certo an, hat einen interessanten Solopart und klingt recht apart.
Karl Schiske, Jahrgang 1916, ist viel zu früh, im 54. Lebensjahr, gestorben. Er war einer der fortschrittlichsten und anregendsten Kompositionslehrer an der Wiener Musikakademie und hatte so verschiedenartige Schüler wie Cerha, Zykan, Schwertsik und Urbanner. Er selbst hat mehr als 50 Werke geschrieben, in den verschiedensten Besetzungen, darunter fünf Symphonien und ein Oratorium. Sie spiegeln die verschiedenen Techniken, mit denen er sich auseinandersetzte. „Candada“ op. 45 wurde jetzt erst uraufgeführt. Es ist von unsemantischen, „dadaistischen“ Lautgedichten von Herbert Möslacher angeregt worden und für gemischten Chor, Sopran (Solo: Annelies Hückl) und Orchester gesetzt. Seit eh und je liebte Schiske das Zahlenspiel. Hier, in seiner nachgelassenen Kantate, regiert durchaus die Vier: „Candada“ besteht aus vier Sätzen auf vier Lautgedichte und ist für vierstimmigen Chor gesetzt. Das Orchester besteht aus je vier Holzbläsern, vier Blechbläsern, vier Solostreichern und vier Schlagwerkern. Nur das Klavier tanzt aus der Viererreihe, dafür sind aber die Reihen beziehungsweise Themen in den vier Grundformen ausgeführt, und zwar nach den Regeln der Dosekaphonie, zu der sich Schiske schon sehr früh, seit etwa 1949, bekannte. Zu Lebzeiten des Komponisten, so erklärt uns das Programm, habe man nicht gesagt, diese „dadaistischen“ Texte aufzuführen, es wird aber mehr an dem großen Apparat gelegen haben, den diese vier Miniaturen erfordern.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!