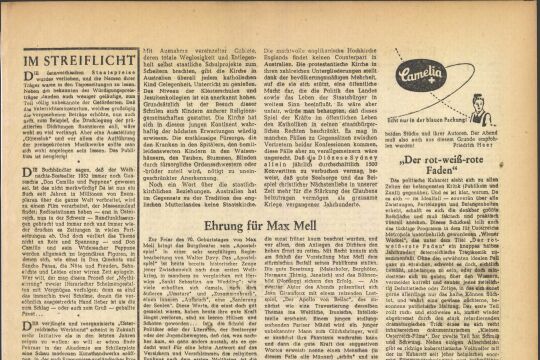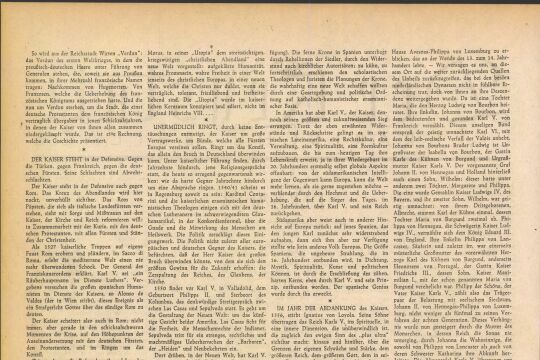Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Fabrik brennt…
Der gesellschaftliche Umbruch, der die Jahrhunderte, in denen der Adel unter der Herrschaft eines Kaisers dominierte, von der heutigen Zeit schied, in der es für jeden Aufstiegsmöglichkeiten zu führenden Positionen gibt, fand am Ende des Ersten Weltkrieges statt. Franz Nabl, der sich neben seinem epischen Schaffen auch geraume Zeit die Dramatik als Ziel gesetzt hatte, erreichte mit seinem „Trie- schübel” an etwa achtzig Bühnen große Erfolge. Seine danach 1929 entstandene Komödie „Schichtwechsel” zeigt die Auswirkungen des großen Umbruchs. Sie wird nun im Theater in der Josefstadt gespielt.
Der Munitionsfabrikant Basch engagiert einen Chauffeur, der ihm durch sein Eingreifen bei einem Autounfall das Leben rettete. Nun stellt sich erstens heraus, daß dieser Chauffeur ein ehemaliger Baron und Kavallerieoffizier ist. Im Sinne der (damaligen) neuen Zeit hat er mit seiner Adelsvergangenheit innerlich gebrochen. Zweitens ist im Haus des Fabrikanten eine ehemalige Prinzessin, die mit einem sozialdemokratischen Abgeordneten verheiratet ist, zu Gast. Das Urbild, laut Nabl „ganz anders geartet”, kennt man. Die „Schichten” wechseln? Nabl setzt eine zeittypische Konstellation als Absprung, die dramatisch entwicklungsfähig wäre. Leider enttäuscht er.
Nachdem die jüngere Belegschaft der Fabrik aus Protest gegen eine Waffenlieferung in einen ihr politisch mißliebigen Staat die Fabrik anzündet, so daß nur Ruinen übrigbleiben, versandet das Stück ins Gefällige. Hans Weigel ist die notwendige Straffung des Stücks und sicher auch manche Pointe zu danken. Noble Aufführung unter der Regie von Emst Haeusserman, die das österreichische sympathisch zur Geltung bringt. Vilma Degischer in der dominierenden Rolle der „roten Prinzessin”, die den ihr von früher bekannten Chauffeur-Baron mit der Tochter des Hauses verheiraten möchte, läßt durch Charme und Herzlichkeit viele Mängel des Stücks vergessen. Erik Frey ist ein soignierter Fabriksherr, Otto David gibt mit Haltung den ehemaligen Baron. In weiteren Rollen: Marianne Nentwich als Tochter, Christine Böhm als Hausgehilfin, Harald Harth als verbissener Neffe. Das Bühnenbild von Lots Egg wirkt unkonventionell ansprechend.
„Maria Tudor”, ein „historisches Drama in drei Tagen” von Victor Hugo, in der Übersetzung von Georg Büchner im Burgtheater: Gesteigerte „Dramatik”. Weit über Shakespeare und Schiller hinaus. Die historische Maria Tudor, Tochter Heinrichs VIII. und Stiefschwester Elisabeths I., die man die „Blutige” genannt hat, da unter ihrer vierjährigen Regierung an die 33 Ketzer verbrannt wurden, war in ihrer Frömmigkeit zutiefst überzeugt, all ihr Wirken geschehe zur Ehre Gottes.
Nichts davon in diesem Stück, das zu Anfang ihrer Regierung spielt, noch ehe sie Gemahlin Philipps II. von Spanien wird. Es geht ausschließlich darum, ihren von den Großen am Hof gehaßten Günstling, den Italiener Fa- biano Fabiani, zu stürzen. Typisch für ein Stück scharf gespannter Dramatik: In der ersten Szene kündigt es der spanische Gesandte Renard an, in der letzten erfahren wir, daß Fabiani hingerichtet ist. Dazwischen gibt es eine bewegte Handlung, deren Konstellationen dauernd wechseln.
Victor Hugo, der 31 Jahre alt war, als er dieses Stück schrieb, bietet nichts als Effekttheater. Die Gestalten werden gewaltsam um der Dramatik willen in äußerste Positionen gedrängt, die mehrfach zu übersteigerten, kaum glaubhaften Haltungen führen. Alles bleibt völlig äußerlich. Die deutsche Fassung, die der 22jährige Georg Büchner geschaffen hat, verbessert das Stück durch geschickte Raffungen, verringert das allzu aufdringlich Direkte, das allzu Knallige und erweist damit ein subtiles Gefühl für die Bühne, das Victor Hugo hier völlig abgeht.
Unter der Regie von Gerhard Klingenberg wird das Theatralische des Stückes, statt es zu mäßigen, voll ausgespielt, treibt Gisela Uhlen die Rache der Königin zum äußersten Höhepunkt, tobt sich in Rachearien ungehemmt aus. Ein Schönling ist Frank fioffmann als Fabiani keineswegs, er gibt ihm^gleißnerische Leidenschaft. Von der Fußverletzung, die er sich einige Tage vor der Premiere zugezogen hatte, merkt man nichts. Männlich, verhalten wirkt Kurt Schossmann als Gilbert. Eva Rieck fehlt - als Jane - Ausstrahlung. Kurt Beck glaubt man die Beharrlichkeit, mit der er auf den Tod Fabianis dringt. Veniero Colo- santi und John Moore entwarfen pompöse Bühnenbüder, die der Theatralik des Stückes und der Aufführung entsprechen. Wozu dieser gewaltige Aufwand? Ausgrabungen sind gut, aber sie müssen dafürstehen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!