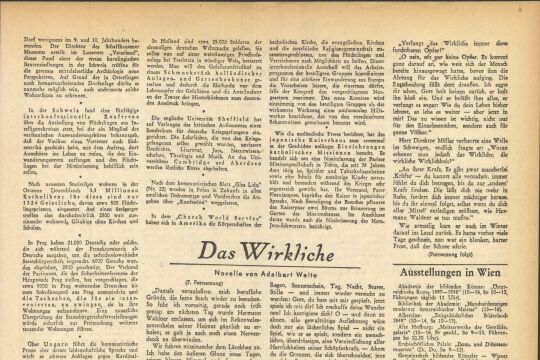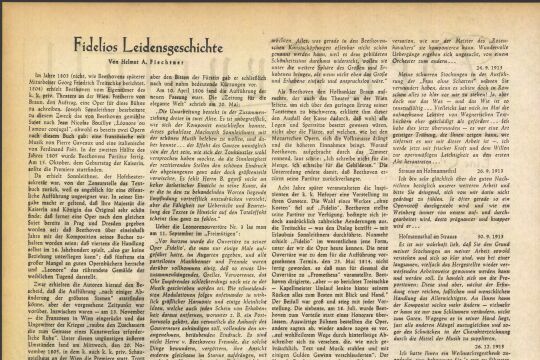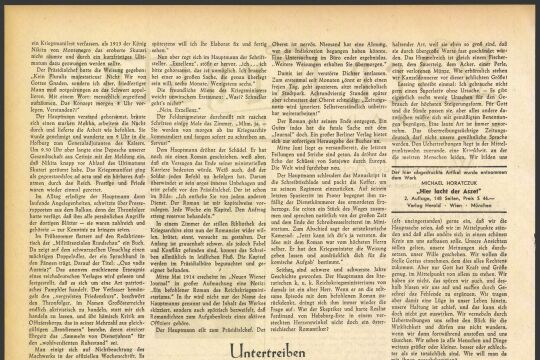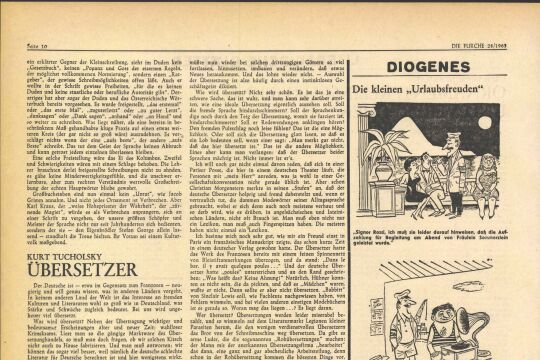Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Komödie der Worte
In der Lyrik stößt man immer wieder auf ein sehr schönes Bild: der Tag als Landschaft, in die wir hineingehen, in der wir uns bewegen, umsehen dürfen. Was wir mitnehmen auf diese Reise, ist wenig und doch viel. Zuwenig, um wirklich das auszudrücken, festzuhalten, was wir fühlen, erleben, beschreiben wollen; zuviel, um nicht damit lügen zu können, um sich nicht darin zu verirren.
Was das ist, das wir da mithaben? Die Sprache, das Wort. Es ist nicht meine Absicht, zu hinterfragen, was ein Ludwig Wittgenstein oder Ferdinand Ebner darüber gedacht, geschrieben hat. Aber wir alle stehen mit Worten in unserer Tag-Landschaft.
Meist gehen wir damit herum, stolz und klug, ohne zu merken, daß wir mitspielen in der großen „Komödie der Worte". So nannte Arthur Schnitzler einen Einakterzyklus, der 1915 uraufgeführt wurde.
In „Große Szene" begegnet uns da der Schauspieler Herbot. Er jongliert mit den Worten, mit der Wahrheit, betrügt, belügt, spielt
immer seine „Hauptrolle", als Ankläger und auch als Angeklagter. Seine Frau, die sein Spiel, seine Lügen nicht mehr ertragen kann, will ihn verlassen, kann es aber nicht. Denn Herbot bleibt liebenswert, erscheint ihr wie ein „großes Kind". Er verspricht, nicht mehr zu lügen, wird aber weiterlügen.
„Worte sind nichts — Worte sind alles", schreibt Schnitzler dazu in seinem Fragment „Das Wort". Sprache bezeichnet er darin als „unpräzises Material, das uns das Lügen so leicht, so verantwortungslos, so entschuldbar macht."
Das haben auch wir erkannt, nützen wir geschickt aus. Uberall wird sie gespielt, die Komödie der Worte. Nicht nur auf jener Bühne, die wir den Politikern gebaut haben, auf die wir sie ge-
stellt haben und wo sie jetzt spielen und zeigen, was sie alles können. (Sogar Volksbefragungen werden von ihnen durchgeführt — vielleicht zur Belustigung des Publikums oder um uns, die Abonnenten dieses „Theaters" zu versöhnen — das Spiel aber nimmt unverändert seinen Lauf).
Die Massenmedien, Zeitungen, Radio, sie alle leben vom Wort. Auch wir „bemühen" uns. Worte werden gedreht, gewendet. Jeder „Wortverwender" ist schließlich sein eigener Maskenbildner, spielt heute den „freien" Orest und morgen den Stiefelputzer des Königs (wenn's nur was einbringt).
Die Komödie der Worte — oder sagen wir besser: Tragödie der Worte? — ist ein Erfolg, immer ausverkauft. Die Sprache muß
für alles herhalten. Wir erzählen, was wir gehört haben (obwohl wir taub sind) und was zu tun ist (obwohl wir nichts tun werden).
Worte wie „Liebe" kitzeln dem einen in der Nase, lassen den anderen rot sehen. Ein paar wenige werden dabei still und sogar menschlich. Dabei wissen wir, wie wichtig, wie notwendig das Sprechen, das Schreiben für uns ist. Aber uns kann nichts mehr betroffen machen, solange wir nicht in diese Landschaft, den Tag, hinausgehen können — auch ohne Worte, die für alles gut sind.
Vielleicht sollten wir das Schweigen und das Sprechen neu lernen. Die Worte neu erfahren, sie berühren, abtasten, bevor wir sie loslassen, weitergeben.
Viel zu lange spielen wir alle — auch ich - mit in dieser Komödie/ Tragödie der Worte. Nicht die Worte sind schuld. Wir selbst sind es, die wir unsere Taglandschaften verwüsten, sie unbegehbar machen.
Der Verfasser ist Student der Germanistik und Publizistik in Wien.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!