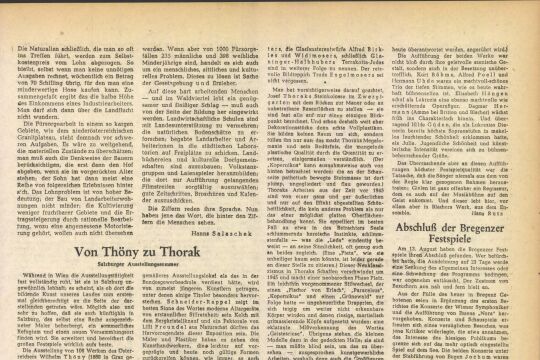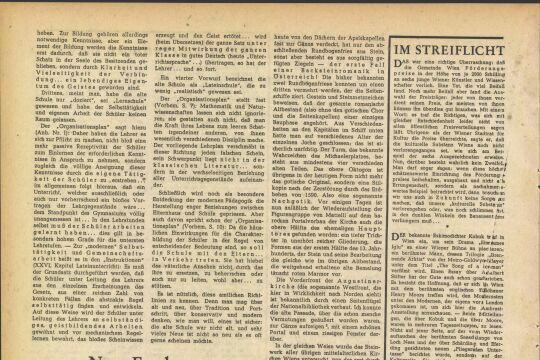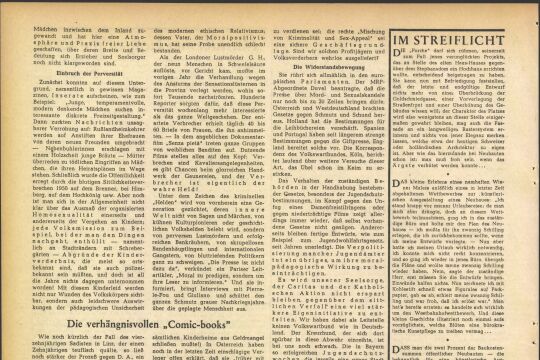Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ein Provisorium für alle Zeiten?
Mag sein, daß den Tausenden Fremden, die jetzt Tag für Tag mehr oder weniger erwartungsvoll den Wiener Stephansplatz erreichen, stehenbleiben, emporblicken, ihre Kameras zücken, wenn sie welche mithaben, nichts auffällt. Mag sein, daß auch vielen Wienern nichts mehr auffällt, wenn sie mehr oder weniger eilig und gedankenlos über den Stephansplatz eilen.
Im grauen Bodenbelag eine graue, doch deutlich abgehobene Fläche, unter der man sich alles und nichts vorstellen kann. Der geographische Mittelpunkt Wiens? Eine Stelle, an der irgendwann irgendwas passiert ist? Oder einfach eine abstrakte Spielerei? Nicht weit davon deutet schließlich auch ein Grundriß in rotem Stein auf grauem Stein etwas an, daß hier einmal etwas gestanden hat, nämlich, was längst nicht mehr steht, eine Kirche, und daß man selbst, der Fußgeher, über einer in der Erde verborgenen Kapelle steht.
Aber die andere, die grau in graue Fläche, ist auch kein reiner Zierat, sondern erinnert an etwas, nämlich daran, daß hier einmal etwas geschehen sollte. Daß hier eigentlich irgend etwas stehen sollte, was den Stock-im-Eisen-Platz vom Stephansplatz optisch zu trennen hätte, eine Art Raumteiler im Freien, etwas, über dessen Notwendigkeit sich alle, die sich über die Gestaltung des Stephansplatzes Gedanken machen, einig sind.
Nur, leider, mit dieser grundsätzlichen Einigkeit hat sich's. Darüber, was hier stehen könnte, stehen sollte, und was dieses hier Stehende symbolisieren, wofür es - jenseits seiner Funktion als optischer Raumteiler -stehen könnte und sollte, darüber gehen die Meinungen auseinander. Und zwar weit.
Vor langer Zeit schon haben die zu einem geschlossenen Wettbewerb eingeladenen Bildhauer Wander Ber-toni, Hans Hollein, Alfred Hrdlitsch-ka, Rudolf Kedl und Josef Pillhofer der Wiener Stadtverwaltung ihre Entwürfe eingereicht. Man hat nichts mehr davon gehört. Die Projekte wurden niemals ausgestellt, und die Veranstalter konnten sich bislang nicht dazu durchringen, eines davon zu prämieren.
Unter diesen Umständen ist es jedenfalls nicht abwegig, wenn sich auch Nicht-Eingeladene Gedanken über die Gestaltung des Uberganges zwischen Stock-im-Eisen-Platz und Stephansplatz machen. Der Wiener Graphiker, Volkskundeforscher und Buchautor Otto Swoboda etwa hat ein Projekt vorgelegt, das sich auf das bevorstehende Dreihundert-Jahr-Jubiläum der Türkenbelagerung von 1683 bezieht und mit einem oder drei entsprechend beschrifteten Obelisken an die Befreiung Wiens von der Türkennot erinnern soll. Seine Begründung: In ganz Wien gebe es schandbarerweise kein Denkmal, das an den Polenkönig Sobieski und sein Entsatzheer erinnert!
Vorerst herrscht großes Schweigen im Walde. Nämlich im Pfeilerwalde des Rathauses.
Der Wiener Stephansplatz wurde seit 1945, als mit dem Dom auch ein großer Teil seiner Umgebung abbrannte, mehrmals verpfuscht. Für einen großen Teil der Neubauten möchte eigentlich niemand mehr verantwortlich sein. Da am Platz als architektonischer Gesamtheit nichts mehr zu retten ist, bemüht man sich wenigstens um den Stephansplatz als Pflasterfläche mit neuralgischen Punkten.
Zweieinhalb Nachkriegsjahrzehnte lang wurde die Unnötigkeit einer U-Bahn für Wien dekretiert. So braucht sich niemand zum Vorwurf zu machen, an die Unterbringung von U-Bahn-Abgängen auf dem Stephansplatz nicht gedacht zu haben. Doch ist es immerhin symptomatisch für den totalen Ausverkauf stadtpla-nerischer Optionen, wenn es sich seit Jahren immer wieder als völlig unmöglich erweist, ein geeignetes Ecklokal auf dem Stephansplatz zu erwerben, um es in einen U-Bahn-Abgang verwandeln zu können.
Der gegenwärtige Abgang auf dem Stephansplatz wird einerseits als Provisorium und anderseits als relativ kleines Übel angesehen, doch könnte sich beides als Illusion erweisen: Da in diesem Fall besonders gute Aussichten auf eine Verifizierung des Napoleon zugeschriebenen Ausspruches bestehen, nichts sei so dauerhaft wie ein Provisorium, werden wohl die ersten Beinbrüche auf der offenen und im Winter vermutlich vereisten Treppe den Praktikern, die eine Überdachung fordern, die nötigen Argumente in die Hand geben, um die Einwände der Ästheten vom Tisch zu wischen.
Das andere Loch in die Tiefe, die „Schnecke“ der Garagenabfahrt, fällt, weil hhjter dem Dom, wenigstens nicht so auf. Und ist ja auch, weil nicht mehr zu ändern, außer Streit gestellt. Schüchterne Begrünungsversuche demonstrieren guten Willen wenigstens zur kosmetischen Korrektur.
So bleibt denn dort, wo nicht nur bekrittelt, sondern auch konkrete Änderungsmöglichkeit nachgewiesen werden soll, wenig mehr als der Vorschlag, Leuchtschriften auf der Fassade des Erzbischöflichen Palais abzumontieren und die Schaukästen, welche die Planke der Dombauhütte „verzieren“, samt dieser Planke zu entfernen und die Dombauhütte geschickter unterzubringen.
Bisher war der Effekt schon hier so gering, daß es als Wunder anmuten würde, käme es über den Raumteiler, Pardon, das Denkmal zwischen Stephans- und Stock-im-Eisen-Platz, wirklich zu einer Einigung. Wobei die Uneinigkeit zumindest den einen positiven Effekt hat, daß wenigstens nichts geschieht, was jemand von den Beteiligten als Verschandelung des Platzes werten könnte.
Das wirklich Positive geschieht im (Halb-)Verborgenen: Im Erzbischöflichen Palais wurden die Wirkung der
Arkaden störende Einbauten beseitigt, und drei renovierte Barockräume werden nicht nur musealen Zwecken dienen, sondern auch der Kommunikation zwischen Kirche und Welt.
Genau dies erhoffen sich kirchliche Stellen auch von der ausgegrabenen, von der U-Bahn-Station her zugänglichen Sankt-Virgils-Kapelle. Die Antwort vom Museum der Stadt Wien, das dafür sein Plazet zu geben hätte, steht bislang noch aus.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!