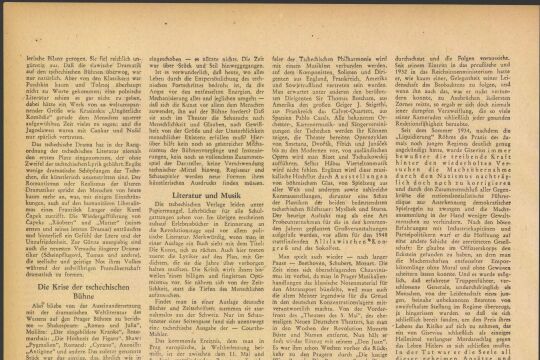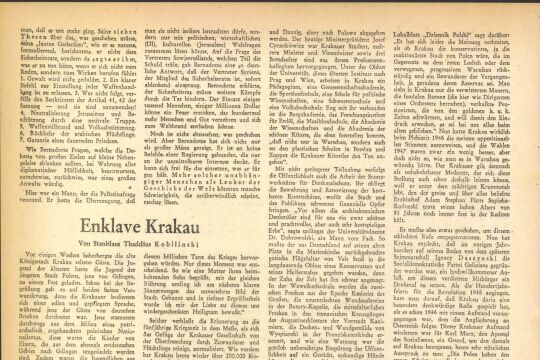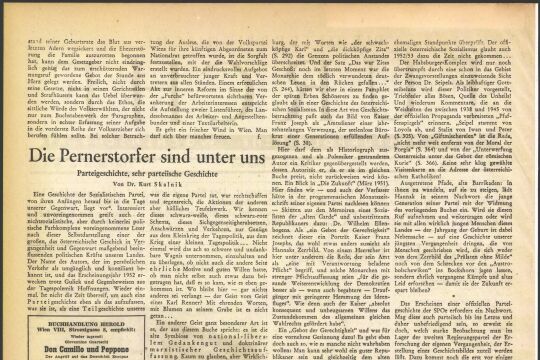Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ein „Salonnazi im Selbstporträt
Der Typ des „Salonkommunisten“ ist international bekannt. Ein Sohn aus gutbürgerlicher, mit Glücksgütern wohl gesegneter Familie verläßt das elterliche Milieu. Von einem fehlgeleiteten Idealismus ebenso wie aus Abenteuerlust oder dem bekannten „Unbehagen an der Kultur“ angetrieben, wird er zum Revolutionär, sucht er sein Glück unter roten Fahnen und verschreibt sich dem „Gott, der keiner war“ (Arthur Köstler). Spät, sehr spät, oft zu spät dämmert diese Erkenntnis. Die Jahrzehnte zwischen den beiden großen Kriegen unseres Jahrhunderts waren reich an solchen Erscheinungen.
Es gab aber auch andere Zeitgenossen. Von denselben oder ähnlichen Motiven inspiriert, fanden diese früh zum „nationalen Sozialismus“, folgten sie ebenfalls roten Fahnentüchern, in denen allerdings das Hakenkreuz auf weißem Grund eingenäht war. Ihr „Idealismus“ und ihre lang durchgehaltene blinde „Führergläubigkeit“ machten sie zu Wegbereitern des Unheils für viele ihrer Generation und letzten Endes auch für jenes „Reich“, das sie aus Wolkenhöhen auf die Erde herabholen wollten.
Reinhard Spitzy (Jahrgang 1912), Sohn des bekannten Wiener Universitätsprofessors Hans Spitzy, war einer von diesen. Im Buch „So haben wir das Reich verspielt“, das rasch eine gewisse Popularität erreichte, berichtet er über seinen Lebensweg. Dieser Bericht ist aus mehr als einer Hinsicht interessant. Er verlangt jedoch kritische Leser.
Fürs erste bekommen wir in diesem Selbstporträt den Typus eines Nationalsozialisten vorgestellt, der sich von dem heute vielfach vergröbert gezeichneten Klischee unterscheidet. Keinen dumpfen Rabauken oder gar KZ-Schergen, sondern einen hochintelligenten, wohlgebildeten Typ, der als Angehöriger der Wiener Jeunesse doree der dreißiger Jahre auch in den Salons von Rom und Paris einst ein gern gesehener Gast war.
Als Zeitzeuge hält Spitzy Rückschau auf ein bewegtes Leben, das den österreichischen Großbürgersohn (der Vater schwarz-gelb bis in die Knochen) in die Reihen der legalen und später illegalen SS sowie über den Umweg eines persönlichen Sekretärs von Joachim von Ribbentrop in dessen Zeit als Botschafter in England in den Dunstkreis der Großen des Dritten Reiches, j a zeitweise in die engere Umgebung Adolf Hitlers geführt hatte. Dessen Willen zum Krieg läßt auch einem treuen Gefolgsmann wie Spitzy aufdämmern, daß der Führer jenes REICH (der Autor schreibt es wie andere den Namen Gottes auch heute noch in Versalien), dem der Glaube seiner Jugend gehört hatte, ins Verderben führen wird.
Als nunmehriger „Frondeur“ wird er im „Canarisladen“ als Mitarbeiter General Hans Osters in verschiedenen Missionen eingesetzt, wobei es sogar zu einer persönlichen Begegnung in Bern mit Allen Welsh Dulles kam, bevor er unter dem Schutzschild des vom SS-Brigadeführer Walter Schellenberg geleiteten „Amtes IV Ausland“ des Reichssicherheitsdienstes im sicheren Spanien das Kriegsende erlebt.
Auf einem der sogenannten „Rattenwege“ gelingt die Flucht nach Argentinien. Jahrzehnte später kehrt der „alte Kämpfer“ in sein von ihm nicht zu allen Zeiten hochgeschätztes und in seiner
Bedeutung für den europäischen Frieden nicht erkanntes österreichisches Vaterland zurück, um sich hier einen behaglichen, finanziell wohlabgesicherten Lebensabend zu gönnen.
Hier ist gleich eine Ergänzung fällig: Reinhard Spitzy war nicht nur ein „Salonnazi“, ein Mann des Savoir vi vre, der den Umgang in höheren gesellschaftlichen Kreisen zu schätzen wußte. Seit früher Jugend übte auch das zwielichtige Spiel der geheimen Dienste eine besondere Anziehungskraft auf ihn aus. Deshalb ließ er sich bereits als Student für das sogenannte „Forschungsamt“ - eine Spionageorganisation Hermann Görings — anwerben.
Sein „Gesellenstück“ liefert er dann in Rom, als er in der Zeit der Vorbereitung des Juli-Putsches 1934 in der wenig rühmlichen Rolle als Verbindungsmann seiner NS-Gesinnungsfreunde zu dem damals als österreichischer Gesandter in Rom wirkenden Anton Rintelen fungiert. Dieser ehemalige steirische Landeshauptmann und christlichsoziale Minister mit deutschnationaler Schlagseite war nicht nur eine der schillerndsten Figuren der Ersten Republik, sondern auch bekanntlich als Ga-lionsfigur nach einem für die Nationalsozialisten positiven Ausgang des Juli-Putsches 1934 vorgesehen.
Zeitgeschichtlich von Bedeutung ist Spitzys Aussage, daß Rintelen nicht nur bereit war, den Putschisten als Bundeskanzler zur Verfügung zu stehen, sondern daß dieser in den Wochen vor dem 25. Juli aus gekränkter Eitelkeit und aus Haß gegen seinen ehemaligen Parteifreund Engelbert Dollfuß, der ihn als trojanisches Pferd erkannt und deshalb nach Rom abgeschoben hatte, sich immer aktiver und drängender in die Putschvorbereitungen eingeschaltet hatte.
Nach dem Dollfuß-Mord war Spitzy eine Rückkehr nach Österreich nicht zu empfehlen. Umso stärker integriert er sich in die NS-Führungskader. Zum Sekretär Ribbentrops berufen, erkennt er rasch dessen persönliche Hohlheit und angemaßte diplomatische Fähigkeiten sowie dessen verhängnisvolle Verkennung der Bereitschaft Englands, mit der Politik des Appeasements eines Tages doch Schluß zu machen.
Das Kapitel über Spitzys Londoner Erlebnisse und Erkenntnisse in der Umgebung Ribbentrops liest man nicht ohne Amüsement. Zurückhaltender wird man allerdings, sobald Spitzy sich dem Jahr 1938 nähert. Dieses sieht ihn nicht nur bei der Begegnung Kurt Schuschniggs mit Hitler am Obersalzberg auf der anderen Seite der Barrikade, sondern auch im Troß des triumphierenden „Führers“ bei dessen Einzug in Österreich.
Es ist naheliegend, daß ein ehemaliger Nationalsozialist andere Gefühle mit der Erinnerung an diesen Tag verbindet als ein österreichischer Patriot. Aber daß bei einem Rückblick von der Höhe der Jahre die Eierschalen seiner Jugend so merklich wieder zutage treten, stimmt doch bedenklich. „In Sack und Asche zu gehen“, verlangt von Spitzy heute niemand. Jedoch vermissen wir jede Einsicht, daß der österreichische Abwehrkampf der Jahre vor 1938 gegen die nationalsozialistische Infütration und Okkupation letzten Endes auf die Erkenntnis zurückzuführen war, welch namenloses Unglück hier nicht nur für Österreich, sondern für die Welt heranreifte.
Dabei bekennt Spitzy an anderer Stelle oft, daß I litler schon im Herbst 1937 den kriegerisch gestimmten Ribbentrop vertröstete: „Noch nicht, jetzt noch nicht!“. Wenig sympathisch ist die Kaltschnäuzigkeit, mit welcher der im Troß des „Führers“ in seine Heimat Zurückkehrende über die Verfolgung der Gegner urteilt: „Natürlich gab es während des Anschlusses Tragödien, Verfolgungen und Verhaftungen, doch merkten wir nicht viel davon.“ (Seite 257.)
Von wenig chevaleresker Art zeugt auch die Beurteilung der Person und der Politik des Bundeskanzlers Schuschnigg, während gleichzeitig ein nobles versöhnliches Schreiben des Altkanzlers aus dem Jahr 1967 an den einstigen harten Gegner gleichsam als „Generalpardon“ in Faksimile zu veröffentlichen sich Spitzy nicht scheute.
Noch etwas: Vom „Reich“ zu träumen, ist eine Sache. Für dieses in irgendwelchen geheimen Diensten zu werken, etwas anderes. Ein drittes ist es, für dieses an der Front seinen Kopf hinzuhalten. Pulver hat der Autor nie gerochen. Das konnten andere tun, harmlose Gefolgsleute, aber auch solche, die Hitlers Krieg im tiefsten Inneren verabscheuten. Für Spitzy kam — wie gerufen — zur guten Stunde eine Krankheit, die ihn frontdienstuntauglich machte. Auch das wirft einen nicht wegzuwischenden Schatten auf den Autor, dessen Insider-Story mit den gebotenen Abstrichen und den angemerkten Vorbehalten ohne Zweifel eine interessante Lektüre bietet.
SO HABEN WIR DAS REICH VERSPIELT. Von Reinhard Spitzy. Langen Müller Verlag, München 1986. SU Seiten, Ln., öS 343,20.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!