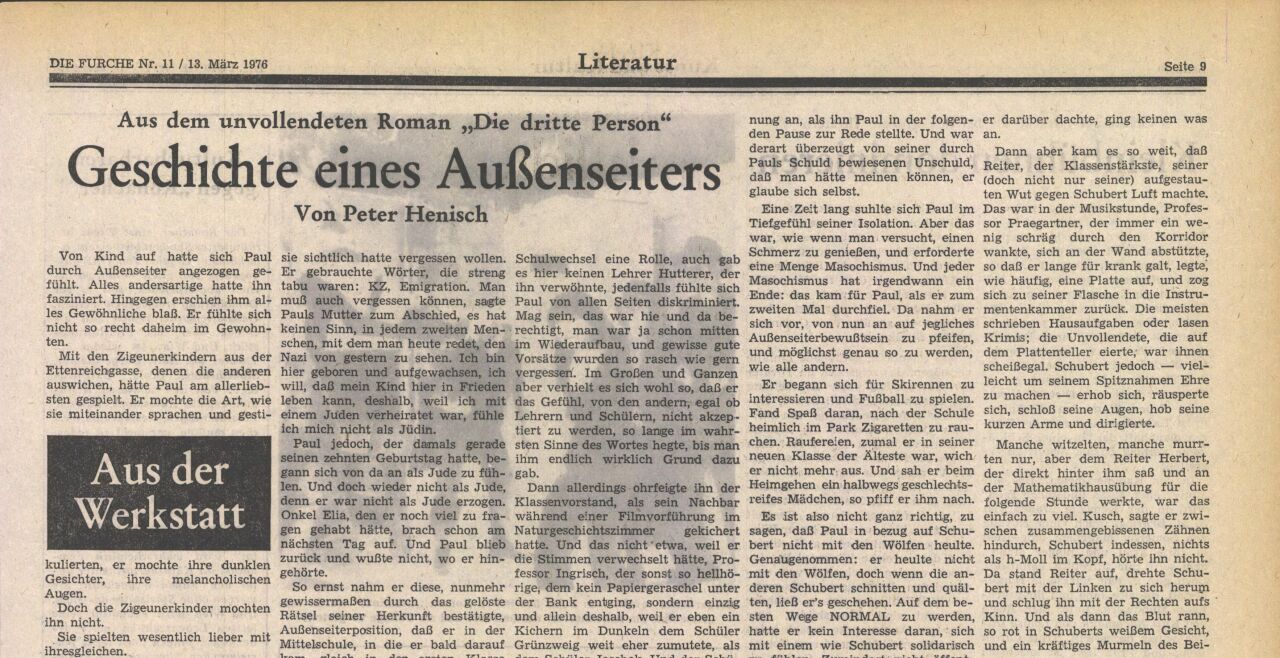
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Geschichte eines Außenseiters
Von Kind auf hatte sich Paul durch Außenseiter angezogen gefühlt. Alles andersartige hatte ihn fasziniert. Hingegen erschien ihm alles Gewöhnliche blaß. Er fühlte sich nicht so recht daheim im Gewohnten.
Mit den Zigeunerkindern aus der Ettenreichgasse, denen die anderen auswichen, hätte Paul am allerliebsten gespielt. Er mochte die Art, wie sie miteinander sprachen und gesti-
kulierten, er mochte ihre dunklen Gesichter, ihre melancholischen Augen.
Doch die Zigeunerkinder mochten ihn nicht.
Sie spielten wesentlich lieber mit ihresgleichen.
Um die Russenkaserne in der Gußriegelstraße, vor der seine Mutter ihn warnte (dort seien schon Kinder verschwunden und nimmermehr aufgetaucht) streunte er trotzdem immer wieder herum. Er mochte die Lieder, welche die Russen sangen, wenn sie aus der Kaserne marschierten, er mochte die Weise, wie sie dazu die Arme schwenkten, die Beine warfen.
Manchmal versuchte er, mit den Wachsoldaten zu reden.
Aber die Wachsoldaten verstanden ihn nicht.
Von je her hatte er das Gefühl gehabt, nicht wie die anderen zu sein. Das machte ihm einerseits Angst, aber anderseits erfüllte es ihn mit Stolz. Es war ein Gefühl zwischen Ausgestoßenheit und Erwähltheit. Die Stimmungen seiner Kindheit schwankten zwischen diesen Extremen.
Nichtsdestoweniger hatte Paul in der Volksschule keinerlei Schwierigkeiten. Eher im Gegenteil: sein Klassenlehrer, Hutterer hieß er, behandelte ihn wie ein rohes Ei. Er versäumte keine Gelegenheit, um auf Pauls besondere Talente hinzuweisen, das Rechentalent speziell. Und daß der kleine Grünzweig im Turnen eher zaghaft war, nahm er für selbstverständlich.
Dem geriet das sonderbare Verhalten der Umwelt seiner Mutter und ihm gegenüber auch anderswo bis auf weiteres nicht zum Nachteil. Herr Dvofak, sonst wenig kinderfreundlich, schenkte ihm Kaugummibilder, und der Gneist Fritzi wurde'sein bester Spielkamerad. Es war, als wollte man etwas, das man in einer Vergangenheit, die Paul nur dunkel ahnte, falsch gemacht hatte, an ihm wieder gut machen. Doch über allem, was man mit diesem Vorsatz tat, lag ein gewisser Krampf, und in allem, was man mit dieser Absicht sprach, schwang ein unechter Ton.
Besonders, wenn die Rede auf Pauls Vater kam, verliehen die Leute ihren Stimmen ein eigenartiges Timbre. Pauls Mutter sprach selten von seinem Vater und nie konkret: sein Vater war im Krieg geblieben. Und doch mußte er auf andere Weise im Krieg geblieben sein, als die Väter anderer Kinder. Denn bei Paul zu Hause hing kein Soldatenphoto und von Stalingrad war in diesem Zusammenhang nie die Rede.
Paul ahnte nur und wußte nichts, bis zu dem Tag, an dem, völlig unerwartet, der Onkel Elia aus Israel eintraf. Paul hatte nie zuvor von einem Onkel Elia und nur überaus vage von einem Land namens Israel gehört. Seiner Mutter war der Besuch, wie es schien, nicht besonders angenehm, obwohl der Onkel Elia ein freundlicher Mann mit einem schönen, graumelierten Bart war. Und als er von Dingen zu reden anfing, die sie offenbar nicht hören mochte, fragte sie ihn auf den Kopf zu, wann er wieder reise.
Der Onkel Elia nämlich beschwor mit nahezu jedem Satz eine Zeit, die
sie sichtlich hatte vergessen wollen. Er gebrauchte Wörter, die streng tabu waren: KZ, Emigration. Man muß auch vergessen können, sagte Pauls Mutter zum Abschied, es hat keinen Sinn, in jedem zweiten Menschen, mit dem man heute redet, den Nazi von gestern zu sehen. Ich bin hier geboren und aufgewachsen, ich will, daß mein Kind hier in Frieden leben kann, deshalb, weil ich mit einem Juden verheiratet war, fühle ich mich nicht als Jüdin.
Paul jedoch, der damals gerade seinen zehnten Geburtstag hatte, begann sich von da an als Jude zu fühlen. Und doch wieder nicht als Jude, denn er war nicht als Jude erzogen. Onkel Elia, den er noch viel zu fragen gehabt hätte, brach schon am nächsten Tag auf. Und Paul blieb zurück und wußte nicht, wo er hingehörte.
So ernst nahm er diese, nunmehr gewissermaßen durch das gelöste Rätsel seiner Herkunft bestätigte, Außenseiterposition, daß er in der Mittelschule, in die er bald darauf kam, gleich in der ersten Klasse durchfiel. Vielleicht spielte der
Schulwechsel eine Rolle, auch gab es hier keinen Lehrer Hutterer, der ihn verwöhnte, jedenfalls fühlte sich Paul von allen Seiten diskriminiert. Mag sein, das war hie und da berechtigt, man war ja schon mitten im Wiederaufbau, und gewisse gute Vorsätze wurden so rasch wie gern vergessen. Im Großen und Ganzen aber verhielt es sich wohl so, daß er das Gefühl, von den andern, egal ob Lehrern und Schülern, nicht akzeptiert zu werden, so lange im wahrsten Sinne des Wortes hegte, bis man ihm endlich wirklich Grund dazu gab.
Dann allerdings ohrfeigte ihn der Klassenvorstand, als sein Nachbar während einer Filmvorführung im Naturgeschichtszimmer gekichert hatte. Und das nicht' etwa, weil er die Stimmen verwechselt hätte, Professor Ingrisch, der sonst so hellhörige, dem kein Papiergeraschel unter der Bank entging, sondern einzig und allein deshalb, weil er eben ein Kichern im Dunkeln dem Schüler Grünzweig weit eher zumutete, als dem Schüler Jeschek. Und der Schüler Jeschek schloß sich dieser Mei-
nung an, als ihn Paul in der folgenden Pause zur Rede stellte. Und war derart überzeugt von seiner durch Pauls Schuld bewiesenen Unschuld, daß man hätte meinen können, er glaube sich selbst.
Eine Zeit lang suhlte sich Paul im Tiefgefühl seiner Isolation. Aber das war, wie wenn man versucht, einen Schmerz zu genießen, und erforderte eine Menge Masochismus. Und jeder Masochismus hat irgendwann ein Ende: das kam für Paul, als er zum zweiten Mal durchfiel. Da nahm er sich vor, von nun an auf jegliches Außenseiterbewußtsein zu pfeifen, und möglichst genau so zu werden, wie alle andern.
Er begann sich für Skirennen zu interessieren und Fußball zu spielen. Fand Spaß daran, nach der Schule heimlich im Park Zigaretten zu rauchen. Raufereien, zumal er in seiner neuen Klasse der Älteste war, wich er nicht mehr aus. Und sah er beim Heimgehen ein halbwegs geschlechtsreifes Mädchen, so pfiff er ihm nach.
Es ist also nicht ganz richtig, zu sagen, daß Paul in bezug auf Schubert nicht mit den Wölfen heulte. Genaugenommen: er heulte nicht mit den Wölfen, doch wenn die anderen Schubert schnitten und quälten, ließ er's geschehen. Auf dem besten Wage NORMAL zu werden, hatte er kein Interesse daran, sich mit einem wie Schubert solidarisch zu fühlen. Zumindest nicht öffentlich, zumindest nicht lauthals — was
er darüber dachte, ging keinen was an.
Dann aber kam es so weit, daß Reiter, der Klassenstärkste, seiner (doch nicht nur seiner) aufgestauten Wut gegen Schubert Luft machte. Das war in der Musikstunde, Professor Praegartner, der immer ein wenig schräg durch den Korridor wankte, sich an der Wand abstützte, so daß er lange für krank galt, legtet wie häufig, eine Platte auf, und zog sich zu seiner Flasche in die Instrumentenkammer zurück. Die meisten schrieben Hausaufgaben oder lasen Krimis; die Unvollendete, die auf dem Plattenteller eierte,- war ihnen scheißegal. Schubert jedoch — vielleicht um seinem Spitznahmen Ehre zu machen — erhob sich, räusperte sich, schloß seine Augen, hob seine kurzen Arme und dirigierte.
Manche witzelten, manche murrten nur, aber dem Reiter Herbert, der direkt hinter ihm saß und an der Mathematikhausübung für die folgende Stunde werkte, war das einfach zu viel. Kusch, sagte er zwischen zusammengebissenen Zähnen hindurch, Schubert indessen, nichts als h-Moll im Kopf, hörte ihn nicht. Da stand Reiter auf, drehte Schubert mit der Linken zu sich herum und schlug ihn mit der Rechten aufs Kinn. Und als dann das Blut rann, so rot in Schuberts weißem Gesicht, und ein kräftiges Murmeln des Bei-
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!




































































































