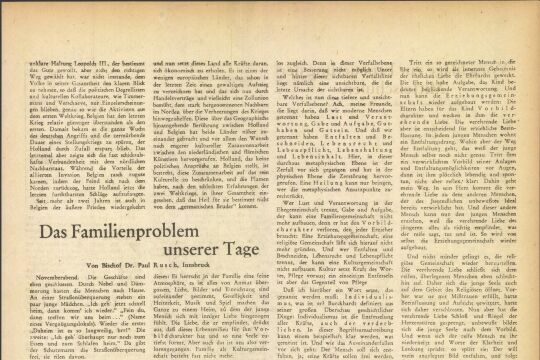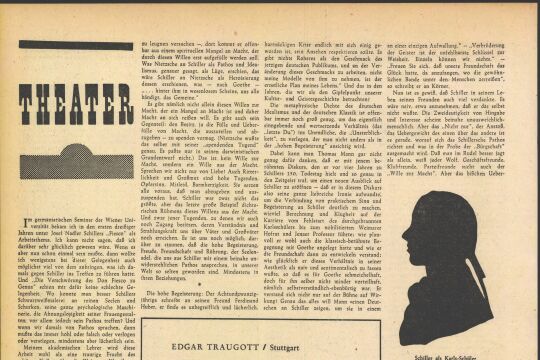Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Herrn Meiers Frage
Es war einmal, da ging der Herr Meier über die Wiener Kärntner Straße und traf den Herrn Müller. Sagt der Müller: „Wie geht’s dir, Meier? Habe dich lange nicht gesehen. Ich habe gehört, du hast Pech gehabt in der letzten Zeit.“ Sägt der Meier: „Was heißt Pech? In Konkurs bin ich gegangen, gepfändet hat man mich, den letzten Knopf hat man mir weggenommen. Ich bin am Bettelstab.“ Sagt der Müller: „Schrecklich. Aber man hat mir erzählt, die Familie hilft dir. Der eine gibt dir zu wohnen, der andere gibt dir zu essen, der dritte gibt dir dich zu bekleiden, der vierte gibt dir zu rauchen.“ Darauf der Meier: „Ja, aber wovon soll ich leben?!“
• Dieser Witz, dessen „alttestamentarische“ Urform leicht zu erraten ist, hat mir immer wieder zu denken gegeben, seit ich ihn vor rund fünfzig Jahren zum ersten Mal hörte. So alt ist er und wahrscheinlich noch viel, viel älter. Man ahnt, daß sich in ihm eine tiefe Lebenserfahrung und Lebensweisheit verbirgt. Was ist es nur, das dem Herrn Meier „zum Leben“ fehlt, obwohl er alles be kommt, was er „zum Leben“ braucht? Offenbar das Geld. Aber wozu das Geld, da er doch alles hat, was man für Geld kaufen kann? Alles - wirklich?
Schon im alten Rom forderten die Volksmassen nicht nur Brot, sondern auch Spiele - panem et circenses. Hat es die Verwandtschaft des Herrn Meier lediglich verabsäumt, ihm auch noch Eintrittskarten für Theater-, Konzert- und Sportveranstaltungen zur Verfügung zu stellen? Ich zweifle, daß er sich dadurch viel glücklicher gefühlt hätte.
Genau besehen ist dieser Witz die knappste, pointierteste, sarkastischeste Kritik am sogenannten Versorgungsstaat und überhaupt an so mancher alten und neuen gesellschaftlichen Utopie. Man kann, ohne etwas zu tun, durch eine reiche Erbschaft zu Geld kommen oder durch einen Lotteriegewinn. Was aber der offenbar stockkonservativ, stockkapitalistisch denkende Herr Meier unter „von etwas leben“ versteht, ist wohl eine Erwerbstätigkeit, die ihm das nötige Geld einträgt.
Die Frage des Reichtums und der Armut hat die Religionsstifter, die Philosophen und Moralisten schon seit al- tersher immer wieder beschäftigt. Ich bin kein Freund der Armut, dazu habe ich in meinem Leben viel zu oft und zu lange an Geldmangel gelitten. Ich habe noch die böse, satirische, demaskierende Karikatur vor Augen, die der
Meistergraphiker und Maler George Grosz vor vielen Jahrzehnten zu Rilkes Vers „denn Armut ist ein großer Glanz von innen“ gezeichnet hat. Und ich stimme durchaus dem französischen Moralisten Marquis de Vauvenargues bei, der den Satz geprägt hat: „Es ist nicht wahr, daß die Menschen in der Armut besser sind als im Reichtum.“ Auch bin ich der Ansicht, daß der Mensch, der in diese Welt gesetzt wurde, ohne vorher gefragt worden zu sein, Anspruch auf die Sicherung seiner physischen Existenz durch die menschliche Gemeinschaft hat. Es handelt sich hier um eine Frage der Menschenwürde.
Wenn jedoch das Versorgungs- und Verteilungsprinzip zum gesellschaftlichen beziehungsweise staatlichen Prinzip erhoben wird, so führt das unweigerlich früher oder später zu dem verzweifelten Ausruf des Herrn Meier: „Wovon soll ich leben?!“ Denn es ist eine Tatsache, daß Leben mehr ist als Versorgtsein mit den für die physische Existenz des Menschen notwendigen Gütern.
Die materialistischen sozialen Utopien - die, wo ihre Verwirklichung versucht wurde, nicht einmal dieses Versorgtsein zu sichern vermögen - gehen von der in Bert Brechts „Dreigroschenoper“ verkündeten These aus: „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.“ Einen Schmarren. Das Fressen bringt gar keine Moral hervor, zumindest keine „moralische“. Weder dialektisch, noch undialektisch. Sonst müßten die Satten die moralistische- sten Menschen sein. Der Mensch ist eben nicht bloß das Produkt äußerer, sprich gesellschaftlicher Verhältnisse. Anders gesagt: Die Freiheit beginnt dort, wo der Mensch mehr ist als ein gesellschaftliches Wesen.
Aus dieser Freiheit ergibt sich für ihn die Möglichkeit zu einer ganz anderen Alternative. Er hat die Möglichkeit des Verzichts, der Entsagung, der Askese, kurz der freiwillig gewählten Armut. Diese Armut meinte Rilke offenbar, wenn er von ihr dichtete, sie sei „ein großer Glanz von innen“. Es gab und gibt die franziskanische Armut, es gab und gibt die Bettelmönche, und sogar immer noch die Eremiten, die sich durch milde Gaben oder durch den Genuß von rohem Wurzelwerk erhalten. Es ist, unter Abtötung der physischen Bedürfnisse, der extreme Weg aus den Zwängen der Materie, den Zwängen der „Gesellschaft“ zur inneren Sammlung, zur Kontemplation, ein Weg zur inneren Freiheit, der keine Tyrannei etwas anzuhaben vermag.
Es ist, das muß wohl nicht erst gesagt werden, nicht der Weg des Herrn Meier. Denn er ist kein Heiliger und kein Asket, sondern ein ganz gewöhnlicher, normaler Mensch. Und wenn so ein ganz gewöhnlicher, normaler Mensch, der, was seine physischen Existenzbedingungen betrifft, „versorgt“ ist, plötzlich verzweifelt ausruft: „Wovon soll ich leben?!“, so ist das der revolutionärste Ausruf, der sich denken läßt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!