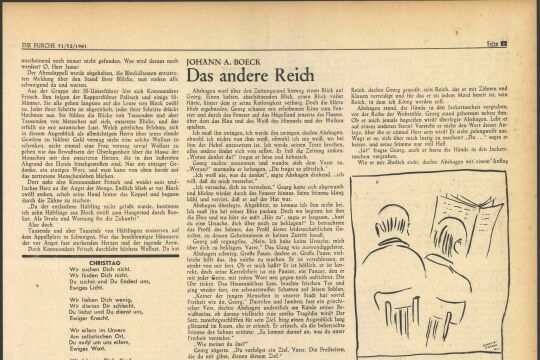Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Lachen mit einigem Schmerz
Die Villa Veneziani in Servola, einem Industrieviertel Briests, steht heute nicht mehr. Fliegerbomben haben sie kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges zerstört. Hier wohnte bis zu seinem Tod vor fünfzig Jahren Italo Svevo, der „Italienische Schwabe“, eine der geheimnisvollsten Dichterpersönlichkeiten der neueren Literatur. In jenen Jahren aber kannten ihn nur wenige als Italo Svevo, er war schlicht der Signor Et-tore Schmitz, ein angesehener und beliebter Geschäftsmann in den Industrie- und Handelskreisen der Hafenstadt.
Eines Abends, im Frühjahr 1927, brachte mich ein Freund zu ihm. Signor Ettore Schmitz war um diese Zeit bereits fünfundsechzig Jahre alt. Die Villa gehörte seinem Schwiegervater Gioachino Veneziani. Der hatte einen seefesten Schiffsanstrich erfunden, für den sich vor dem Ersten Weltkrieg besonders die englische Kriegsmarine interessierte. Ettore Schmitz war beauftragt worden, eine Zweigstelle der Firma Veneziani in England zu errichten, hatte einen Englischlehrer gesucht und ihn in James Joyce gefunden. So waren der damals noch von Weltraum weit entfernte irische Dichter James Joyce und Italo Svevo zusammengekommen.
Man führte uns durch einen riesigen, salonartigen Raum, der im Halbdunkel lag. - .Avanti! Avanti!“ erklang es hinter einer Tür - ich glaube, es war eine Tür mit Milchglasscheiben - die sich sogleich öffnete. Wir betraten Svevos abgeschiedenes Arbeitszimmer. Es war klein, einfach, mit altmodischen, dunklen Möbeln betont sachlich eingerichtet. Auch ein Notenpult stand da. Vor ihm auf der Geige kratzend hatte ein Dichter ein halbes Leben lang versucht, sein Genie auszulöschen und mit Tönen, die er dilettantisch dem Instrument entlockte, die Gespenster zu verscheuchen, die ihn bedrängten. „Ich habe diese lächerliche und schädliche Sache, die man Literatur nennt, aus meinem Leben ausgemerzt“, heißt es in einer Tagebuchnotiz aus dem Jahre 1902. Zehn Jahre zuvor war Svevos erster Roman „Una vita“ („Ein Leben“) erschienen, 1898 sein zweiter, „Senüitä“ („Ein Mann wird älter“). Nüchterne Prosa, durchsetzt von feiner Ironie. Rückhaltlose Seelendemaskierungen.
Ettore Schmitz, groß, kräftig, angegraut, englischer Schnurrbart, empfing uns stehend. Er war dunkel gekleidet, unauffällig, solide. Er hatte etwas Kaufmännisches an sich. Was aber vor allem und sofort interessierte, war sein Auge. Seltsam scheu fragend, forschend, suchend, leuchtete es unerwartet lustig auf.
Schmitz-Svevo war gleich herzlich und lebhaft Wir sprachen den saloppen Triestiner Dialekt, der, eine Spielart des Venezianischen, damals mehr noch als heute, selbst in den besten Gesellschaftskreisen der adriati-schen Hafenstadt gang und gäbe war. Svevo kam gerade aus Paris, wo ihn eine literarische Elite entdeckt und gefeiert hatte. Wie es dazu gekommen war, ist heute Literaturgeschichte.
Auch Svevos dritter Roman, der „Zeno“, war in Italien ohne Echo geblieben. Da wandte sich Svevo an den inzwischen berühmt gewordenen Joyce. Der antwortete: „Warum verzweifeln Sie? Ich bin mit großem Genuß dabei, Ihren Roman zu lesen. Seien Sie sicher, Ihr Buch wird geschätzt werden.“ Er leitete es an Va-lery Larbaud und Benjamin Cre-mieux weiter. Und wirklich - über Nacht war Italo Svevo zu einem Uterarischen Begriff geworden.
An jenem Abend stand Svevo noch ganz unter dem Eindruck der Ehrungen, die ihm in Paris zum ersten Mal als Dichter zuteil geworden waren. Er schien davon berührt, daß man in Paris die Literatur so ernst nahm wie in Triest die Handelsgeschäfte. Noch in
einer anderen Hinsicht schien Svevo überrascht: darüber, daß die Ehrung aus Paris gekommen weit - und nicht aus Deutschland. Ich wußte, daß die Famüie Schmitz deutscher Abstammung war. Sie kam aus dem Rheinland. Ettores Großvater war österreichischer Finanzbeamter in Treviso gewesen, als Venedig noch zum Hause Habsburg gehörte. Im übrigen ist die Familiengeschichte eher konfus. Ettores Vater, jüdischer Konfession, fühlte sich schon ganz als Italiener, war aber zugleich germanophil und schickte Ettore in ein Internat nach Deutschland. Die Erinnerung an den Aufenthalt in Deutschland und vor allem die Verehrung für Schopenhauer bestimmte später die Wahl des Pseudonyms Italo Svevo: „Der italienische Schwabe.“
Er wurde sogleich lebhaft, als die Rede auf die Möglichkeit einer deutschen Ausgabe seiner Werke kam. Ich war damals ein blutjunger Jour-
nalist, bei einer Wiener Zeitung beschäftigt und vom ungerechtfertigten Optimismus der Jugend erfüllt Svevo aber schien dies sehr zu gefallen. Nicht ohne Rührung und ohne ein leises Schmunzeln las ich lange nach seinem Tode in einem an Cre-mieux gerichteten Brief die Stelle: „Herr Piero Rismondo... trotz seines Namens von vorwiegend deutscher Bildung... gefiel mir ganz außerordentlich, da er eine aufrichtige Bewunderimg für meine Bücher hegt...“
Svevo lud mich für den nächsten Tag zum Mittagessen ein.
Nach Tisch zogen wir uns zum schwarzen Kaffee in einen der Salons zurück. Ich zündete mir eine Zigarette an. Da begann mir Svevo väterlich besorgt, ja angsterfüllt einen Vortrag über die Gefahren des Nikotins zu halten. Der Kampf mit dem Nikotin, der immer wieder gebrochene Vorsatz, die „letzte Zigarette“ zu rauchen, ist ja eines der Motive, die den „Zeno Cosini“ ironisch durchziehen. Später erfuhr ich, daß Svevo, als er an dem Roman arbeitete, eine Zigarette nach der anderen geraucht hatte. Der Kampf mit dem Nikotin hat für Svevo auch noch im Sterben eine Rolle gespielt. Als man ihn nach dem Autounfall auf der regennassen Straße bei Motta di Livenza, im Venetischen, ins nahe Krankenhaus ge-
bracht hatte, bat er um eine Zigarette. Sie wurde ihm verwehrt. Da sagte er: „Das wäre wirklich die letzte Zigarette gewesen.“ Und noch etwas sagte er, der alle Lebensvorgänge in seinen Büchern mit unbestechlicher Scharfsicht schildert: „Warum weint ihr? Sterben ist gar nichts ... morir no xe niente.“ Zwei Stunden später war er tot. Es war der 13. September 1928.
Die Zigarette nach jenem Mittagessen leitete zur Literatur über. Zu Svevos Werk. Die Sprache, in der es geschrieben ist, wurde damals von der italienischen Kritik immer wieder scharf angegriffen. Der Triestiner Dialekt, in dem wir miteinander sprachen, mit seinen germanischen und slawischen Einflüssen, trocken, unsentimental, plastisch, bestimmt auch den Ton von Svevos „Schriftsprache“. Sie ist die Sprache einer „Randprovinz“ des einstigen Habsburger-Reiches, und der Hauch dieses Reiches - ganz unabhängig vom politischen und nationalen Bekenntnis des Herrn Ettore Schmitz - weht durch Svevos Romane, die alle im Triest des einstigen österreichischen Vielvölkerstaates spielen.
Svevo selbst ahnte - in unserem Gespräch kam es deutlich zum Ausdruck -, daß es nicht seine angeblich „mangelhafte Sprache“, sondern seine ganz auf die Sache, auf die Wahrhaftigkeit des Sehens und Sagens gerichtete Art war, die ihm damals den Weg nach Italien versperrte. In den deutschsprachigen Ländern hoffte er, dafür mehr Verständnis zu finden. Die „schöne“ und „kunstvolle“ sprachliche Formulierung, so erklärte er mir, könne zuweilen die Sache verdunkeln. Und von einem Autor sagte er einmal: „Er schreibt zu gut, um aufrichtig zu sein.“ Inzwischen hat man die lebendige Kraft von Svevos Sprache in Italien längst erkannt.
Wir kamen auf die Psychoanalyse zu sprechen. Die Bekenntnisse des Signor Zeno Cosini werden ja so präsentiert als würden sie von einem psychoanalytischen Arzt, Dr. S., herausgegeben. Svevo wehrte ab. Seine beiden ersten Romane mit ihrer unerbittlichen Seelendurchleuchtung, waren zu einer Zeit erschienen, als der Name Freud der Welt noch unbekannt war. Und was die „Coscienza di Zeno“ betraf- nun, „coscienza“ ist in diesem Fall im Sinn von „Bewußtsein“ gemeint im Gegensatz zum „Unbewußten“, trotzdem: „Es handelt sich um eine Kunstform“, beteuerte Svevo, „so wie man zuweilen einen Roman in die Form eines Tagebuchs kleidet.“ Gleichwohl: Svevo war mit dem italienischen Psychoanalytiker und Mitarbeiter Freuds, Edoardo Weiß, befreundet und übersetzte Freuds Traumlehre.
Das Gespräch war beendet. Meine Aufgabe war es nun, die deutsch-, sprachige Ausgabe des „Zeno Cosini“ vorzubereiten, die in der Schweiz erscheinen sollte. Svevo trieb mich in seinen Briefen zur Eue an: „Ich will das Buch noch erleben, ehe ich sterbe.“ Er erlebte es nicht mehr. Der Tod ereilte ihn, nachdem er die letzten Druckfahnen der deutschen Ausgabe gesehen hatte, die 1929 erstmals erschien. Krieg und Rassenverfolgung drängten Svevos Werk in die Vergessenheit. Erst mit dem Kriegsende begann seine „zweite Entdeckung“.
Ein geheimnisvoller Herr, der Signor Ettore Schmitz, der bescheiden, witzig, liebenswürdig inmitten seiner Familie, seiner vielen Verwandten, Freunde, Geschäftspartner lebte, und der sich als Italo Svevo all dieser Verflechtungen entzog, Distanz zu ihnen gewann, von der aus ihm - mit einigem Schmerz - das Lachen über die sogenannten Gesunden ankam, die sogenannten Normalen und ihren Lebensbetrieb.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!