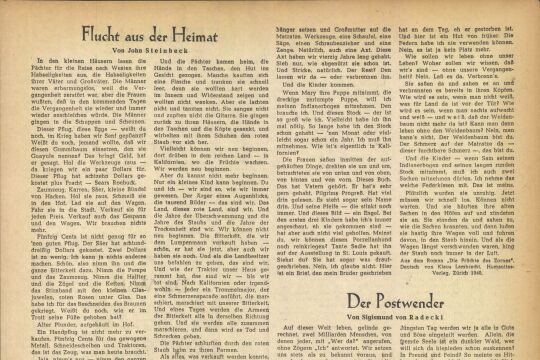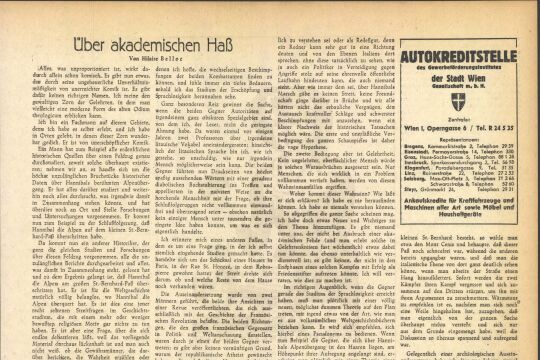Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Osterreich und die Schriftsteller
In Österreich ist der Umgang mit den Schriftstellern sehr äußerlich — das heißt, man wird als Schriftsteller nur dann eine öffentliche Person, wenn auch die Privatperson interessant wird oder sich interessant macht. Und interessant für die österreichische Öffentlichkeit ist man dann nicht als Schreibender, als jemand, der für andere die verdrängten und unterdrückten Wünsche und Befürchtungen seiner Epoche oder auch nur seiner gehüpften wie gesprungenen Tage formuliert, sondern als eines unter vielen bekannten Gesichtern aus Presse und Fernsehen. Für die Öffentlichkeit ist er austauschbar mit einem Kammersänger, einer Skifahrerin, einem Diskussionsleiter und der Schimpansin Judy aus „Daktari“ — man umwieselt ihn als eine Figur aus der Schauwelt, egal, welche Art von Arbeit ihn in diese Schießbudenumgebung ausgesetzt hat, in der er sich fremd fühlt und die er doch ein bißchen auch zu brauchen glaubt, weil er das, was er schreibt, zur öffentlichen Sache machen will. Aber die öffentliche Sache, das ist dann eben nur er und nicht einmal er selber, sondern zum Beispiel seine schmutzigen Fingernägel oder sein offenes Hemd... Der hysterische Patriotismus eines kleinen Landes formalisiert alle verschiedenen einzelnen zu Exportartikeln, zu Botschaftern des Landes draußen in der Welt, ohne sich um irgendeinen Inhalt zu scheren. „Österreicher im Ausland“ heißen die Rubriken in den Zeitungen, und da werden dann, wie in Heimatblättern die Leistungen der heimischen Eisstockschützen im Nachbardorf, die Taten und Untaten des Kulturexports vorquinkeliert. Aber die Schriftsteller als eine Gruppe bestimmter Staatsbürger, an deren Arbeff m&ntdas“:jftgehe'Leben““fflBe-sen, auslegen und anderes sehen könnte, gibt es nicht im österreichischen Bewußtsein. Und auch die verehrten Schriftsteller von früher sind nur noch Zitatfiguren und Reliquien. Man benutzt ihre Namen, um sie gegen die jetzigen, die man nicht kennt, auszuspielen oder um einen der jetzigen, indem man ihn schnell mit ihnen vergleicht, ebenfalls als Reliquie einzufrieren. Das austriaki-sche Gerede von Tradition ist das Gestammel von Geschichtslosen. Geschichte: das selbstverständliche Hineinwirken eines Bewußtseins von früher in meines jetzt, die Neugier, Ferdinand Kürnberger oder Marie von Ebner-Eschenbach so zu lesen, wie man in eine alte Vorstadtstraße kommt, die sich seit langem nicht geändert hat, wo man aber die Kondensstreifen der Düsenflugzeuge am Himmel sieht oder aus den Häusern am hellichten Tag die Fernseher mit einem Messeprogramm laufen hört... Die Tradition dagegen: das Abstauben eines Museumsgegenstands durch einen stumpfsinnigen Museumsdiener. (Lieben Museumsdiener die Bilder, die sie bewachen? Wer hat schon eines mit nach Hause genommen?) Für diese geschichtslose Traditionshuberei ist sicher der Nationalsozialismus verantwortlich, der aus den Gegenständen der Geschichte, an denen man vernünftig sich Selber begreifen konnte, begrifflose, verdinglichte Monumente der Tradition machte. Und schuld daran ist auch die Zirkelhuberei der österreichischen Schriftsteller, wobei immer ein Zirkel einen Poeten für sich in Anspruch nimmt, worauf der andere Zirkel den Poeten auch schon nicht mehr zur Kenntnis nimmt, i
In keinem Land treten die Schriftsteller einander so sehr als Feinde gegenüber wie in Österreich. Und wenn schon einmal ein paar befreundet sind, dann bilden sie, statt ihr Wahrnehmungsvermögen als einzelne freizuhalten, gleich eine Gruppe und treten als Gang mit einem genormten Wahrnehmungsschema auf, das vielleicht für eine politische Partei angemessen ist, nicht aber für Schriftsteller, für die es keine vorgegebene Erkenntnis, nichts Selbstverständliches, nichts in den Mund Gelegtes und bereits zu Ende Gedachtes geben darf. So stellt sich die österreichische Literatur nicht als eine Gruppe freier Schriftsteller dar, die, freundlich und vernünftig, vielleicht auch ein bißchen neidisch — warum nicht? — schreibend eine mögliche Lebensform in der Gesellschaft vorführen, sondern eher als ein animalisches Gewimmel von Erniedrigten und Beleidigten. Fast zu Recht nimmt die Öffentlichkeit dann eben nur das Gewimmel wahr. Es mußte zum Beispiel Franz Nabl, ein wichtiger österreichischer Schriftsteller („Ödhof“, „Die Ort-liebschen Frauen“), nahezu neunzig Jahre alt werden, damit er als Schriftsteller aus der Gruppe heraus, die ihn in raunenden und raunzenden Literaturgeschichten von uns jüngeren Autoren abschirmte, auf uns zutrat und auch einer von uns wurde. Ich selber hielt Nabl, nach dem, was man über ihn schrieb und sagte, für einen, der jemandem wie mir nichts mitzuteilen hatte, vor allem nichts mitteilen wollte. Freilich wirkte das, was ich vor Jahren von ihm gelesen hatte, geheimnisvoll, wie ohne mich, nach und wurde immer stärker. Ich dachte oft an ihn und war bedrückt, daß die, die jemanden verehrten — seine „Anhänger“ —, ihn auch so behüteten, daß sein Werk fast erstickte. In der Erzählung „Der kurze Brief zum langen Abschied“ zitierte ich ihn dann unverschämt aus der Erinnerung, indem ich meine eigene Kindererfahrung beschrieb, die Umwelt würde auf einmal platzen und die Umgebung, das Wetter, die Sonne usw. wären plötzlich ein Ungeheuer — das aber, erinnerte ich mich, war auch das Grunderlebnis Franz Nabls... Vor ein paar Monaten sah ich ihn dann selber, in seinem Haus in Graz mit der schönen, im Lauf der Zeit hell abgeschrubbten Holztreppe. Wir tranken vifci: Vogelbeerschhaps, bis ich'in seinem Garten ins Gras fiel. Auf seinem Balkon las ich die Vorlesungen, die er 1933 in Graz über moderne Literatur gehalten hatte, und staunte über die Freundlichkeit und die Selbstlosigkeit, mit der er auch Autoren, die ihm fremd sein mußten, zu Recht kommen ließ. Ich betrachtete Franz Nabl und wurde lebhaft vor diesem alten Menschen, obwohl ich vorher Angst gehabt hatte, ich könnte nichts sagen. Ich redete sehr viel und wurde eigenartig stolz auf ihn, als ich daran dachte, daß er sein ganzes Leben als Schriftsteller verbracht hatte und daß er jetzt voll Güte und Würde mir zuhörte und mit mir anstieß. Er hatte meinen Freunden und mir die bequemsten Sessel angeboten und saß selber auf einem Hocker ohne Lehne. Zuerst wollte ich ablehnen, aber dann fand ich es recht, ich weiß nicht, ob das jemand versteht. Auf einmal gehörten wir alle zusammen. Wir sollten den PEN-Club usw. vergessen — und nicht nur wir, sondern auch die Rundfunkanstalten und die Ministerien — und uns statt dessen an die einzelnen Schriftsteller halten und an ihre Arbeiten. Auch wenn man das Wiener Geschnörkel abzieht, das oft Literatur mit Getändel verwechselt, gibt es noch viel zu lesen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!