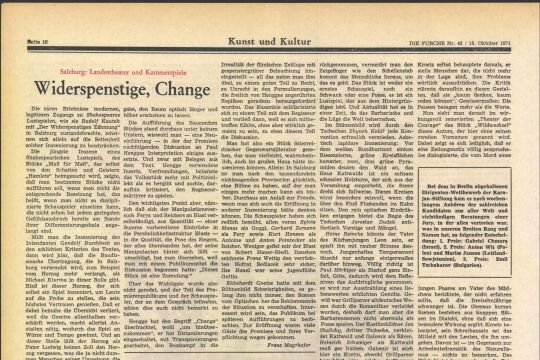Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Rossinis „Barbier“ einmal anders
Daß — was niemand zu hoffen wagte — das Opera-Bufia-Festival im Theater an der Wien doch noch zu einem positiven, erfreulichen, ja brillanten Höhepunkt gelangen würde, verdanken wir dem leider nur zweitägigen Gastspiel der Deutschen Staatsoper Berlin (DDR), die uns eine Buth-Berghaus-Inszenierung von Rossinis „Barbier von Sevilla“ zeigte. Diese hatte im Stammhaus unter den Linden im November 1968 Premiere und wurde seither 61mal gespielt. Also eine Erfolgsproduktion.
Daß — was niemand zu hoffen wagte — das Opera-Bufia-Festival im Theater an der Wien doch noch zu einem positiven, erfreulichen, ja brillanten Höhepunkt gelangen würde, verdanken wir dem leider nur zweitägigen Gastspiel der Deutschen Staatsoper Berlin (DDR), die uns eine Buth-Berghaus-Inszenierung von Rossinis „Barbier von Sevilla“ zeigte. Diese hatte im Stammhaus unter den Linden im November 1968 Premiere und wurde seither 61mal gespielt. Also eine Erfolgsproduktion.
Der unvergleichliche Reiz dieser Inszenierung — und man muß se-cundo loco auch gleich den Gesamtausstatter Achim Frey nennen — besteht in ihrer absoluten Originalität, ihrem Geist, ihrem Esprit und Charme, der auf deutschen Bühnen selten anzutreffen ist. (So etwas kann man, wenn man Glück hat, gelegentlich in einem Pariser Theater, bestimmt aber auf keiner Opernbühne sehen. Doch ja, es gab einmal etwas Ähnliches: bei der römischen Premiere von Henzes „Boulevard soli-tude“.)
Da sind zunächst einmal die in strahlendes Licht getauchten Dekorationen: keine plumpen Kulissen, sondern weiße, zart gestreifte Vorhänge, die von den Schauspielern auf- und zugezogen werden und die, von unsichtbaren Schnüren gerafft und von Windmaschinen bewegt, gelegentlich auch selbst mitspielen. Und da sind die von der Konvention so lustig abweichenden, dafür aber an die Figurinen der Commedia delParte erinnernden Kostüme. Gleich beim Aufzug der Ständchenmusikanten weiß man, was die Uhr geschlagen hat.
Die Sänger gehen nicht, sondern sie trippeln, rennen, tänzeln oder stehen ganz ruhig, immer, wenn man es nicht erwartet. Hat einer etwas Schweres zu singen, so darf er sich auch auf einem Kollegen bequem niederlassen. Manchmal bilden sie Gruppen, lebende Bilder von unvergleichlicher Komik, dann wieder glaubt man sich in einem „Ballet chante“ — was es ja auch einmal gegeben hat. Die Akteure amüsieren sich über sich selbst, über ihre Mitspieler. Alles ist Spiel. Gefühle und Leidenschaften gibt es nur in ironischer Andeutung oder Übertreibung. So wird jeder langweilige Realismus weggefegt.' Als Beispiel: Wenn die Akteure irgendwelche Gegenstände nicht mehr nötig haben, so lassen sie sie fallen oder werfen sie weg. Aber wie das geschieht, mit welcher Anmut und Selbstverständlichkeit — auch wenn Figaro seine Utensilien über die Kulissen feuert —, das muß man gesehen haben.
Und die Musik, die ja, wir wissen es, das Wichtigste bei einer Opernaufführung ist? Das Orchester, die Berliner Staatskapelle, hat unter der Leitung des Tirolers Otmar Suitner mit Präzision und con animo gespielt (Dafür, daß es in der gefürchteten Ouvertüre keinen einzi-
gen ortsüblichen Gickser gab, rief an deren Ende ein besonders törichter Gast „Pfui“.) Großstadtunwürdig war auch die lauthals geäußerte Kritik: „Armer Rossini!“ Aber dieser und seine Musik kamen wahrhaftig nicht zu kurz: Peter Schreier (Almaviva) und Wolfgang Anheisser (Figaro) haben auch diejenigen, die diese Künstler seit langem schätzen, soviel Komödiantik nicht zugetraut. Und Renate Krahmer als Rosine? Eine Virtuosin in jeder Hinsicht. Scharf gezeichnete Gestalten stellten optisch und stimmlich Reiner Süss (Doktor Bartolo) und Siegfried Vogel (Musiklehrer Basilio) auf die Bühne. Gesungen und rezitatorisch gesprochen wurde Deutsch, nur die großen Arien servierte man auf Italienisch — auch dies eine gute Idee, die zum Gesamtstil der genialen Regie von Ruth Berghaus trefflich paßte.
So also hat es kommen müssen: als Eigenproduktion wurde uns eine Donizetti-Oper in gediegenem, aber langweiligem Realismus vorgesetzt — und eine hochverfeinerte, manieri-stische, ästhetische, mit allen plumpen naturalistischen Mitteln aufräumende Inszenierung einer Buffa kam uns aus Ostberlin. Man lernt nie aus...
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!