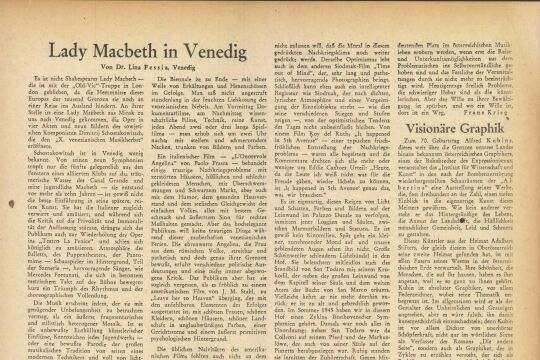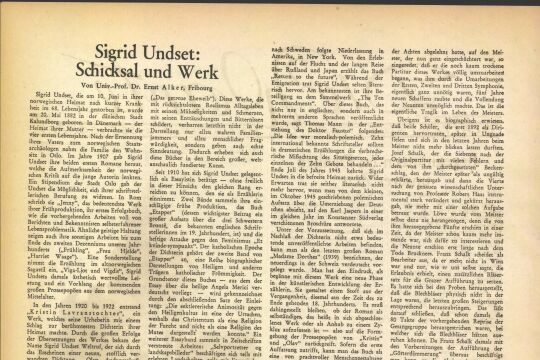Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Viscontis letzter Film
Luchino Visconti: L’innocente - Die Unschuld ist der Verleihtitel für den letzten Film des großen Regisseurs, gleichsam um seine Persönlichkeit schoh auf diese Weise besonders herauszustellen. Der vor etwa einem Jahr verstorbene Italiener hatte diesen Film schon als schwerkranker Mann, an den Rollstuhl gefesselt, zu Ende gedreht. Und trotzdem zeigt sich der Schöpfer von „Ossessione“, „Bellissima“, „La terra trema“, „Senso“, „Weiße Nächte“, „Roeco und seine Brüder“, „Der Leopard“, „Die Verdammten“, „Der Tod in Venedig“, „Ludwig II.“ und „Gewalt und Leidenschaft“ hier voll auf der Höhe seines Könnens. Er hat sich einen 1891 erschienenen Roman von Gabriele d’Annunzio als literarische Vorlage genommen und bewegt sich wieder in jenem Milieu, das er stets mit Vorliebe porträtierte: Adel und Großbürgertum gegen Ende des 19. Jahrhunderts.
Die Geschichte selbst: Ein reicher römischer Aristokrat, der sich selbst alle Freiheiten seines Standes nimmt, kann die Tatsache, daß seine Frau das Kind eines anderen zur Welt gebracht hat, nicht verwinden, verursacht den Tod des Babys, verliert schließlich Gattin und Geliebte und endet durch Selbstmord. Das hört sich in dieser knappen Skizze wie Kolportage an, ist aber psychologisch und soziologisch so richtig empfunden, daß eine plastische Milieustudie mit überzeugendem Zeitkolorit entstanden ist. Hiebei sieht Visconti die Menschen - ausgenommen seinen „Helden“ Tullio, der als ebenso egozentrischer wie freisinniger Atheist die Gesetze seines Handelns selbst bestimmt - vorwiegend als ‘ Produkte ihrer Generation und Konvention. Das schlägt sich dann auch in der Darstellung nieder, wo die Frauen vorwiegend ihre Schönheit zu demonstrieren haben, während sich Giancarlo Giannini mehr um mimischem Ausdruck bemühen muß, dies aber mitunter etwas zu monoton tut.
Eine wesentliche Rolle spielt wie immer bei Visconti die Ausstattung. Er kann hier wieder in prunkvollen Palazzi und kostbaren Gewändern schwelgen. Doch stimmt diese äußere Komponente des Füms mit allen inneren so überein, daß insgesamt ein kostbares Gemälde entstanden ist, ein in sich geschlossenes Kunstwerk, dessen Betrachtung hohen ästhetischen Genuß vermittelt.
Etwa in der gleichen Zeit ist ein anderer Film angesiedelt, der gleichfalls auf ein bedeutendes literarisches Werk zurückgeht. Die Engländer haben Henrik Ibsens „Hedda Gabler“ verfilmt und damit einen gediengenen Beitrag zur Renaissance des norwegischen Dramatikers auch auf der Kinoleinwand geleistet. Das 189Q, entstandene Alterswerk trägt ebenso wie „Nora“ jene Züge, die in den Bereich der fraulichen Emanzipation fallen. Hedda Gabler, Tochter eines Generals, hat in ihrer Ehe mit einem hausbackenen Wissenschaftler keine Erfüllung gefunden, sucht in eitlem Egoismus die Grenzen ihres Milieus zu sprengen, treibt aber ihr Spiel mit Menschen so weit, daß sie daran scheitert und mit einer Waffe ihres Vaters Selbstmord begeht.
Der Film präsentiert praktisch die Aufführung eines Londoner Bühnenensembles und entwickelt darüber hinaus keinen optischen Ehrgeiz. Ihren Glanz bezieht sie außer vom Wort des Dichters von der Hauptdarstellerin Glenda Jackson, von der man ja auch schon im Film etliche profilierte Leistungen ‘ sah. Von ihren Partnern fällt niemand besonders auf, aber auch niemand ab. So ergibt sich insgesamt zwar „nur“ verfilmtes Theater, aber immerhin gutes Theater.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!