Zum Tod von Martin Walser
DISKURS
Zum Tod von Martin Walser: Wege und Abwege
Martin Walser hat als „Großschriftsteller“ die deutsche Nachkriegsliteratur geprägt – und hitzige Kontroversen ausgelöst. Nun ist er 96-jährig gestorben. Ein Nachruf.
Martin Walser hat als „Großschriftsteller“ die deutsche Nachkriegsliteratur geprägt – und hitzige Kontroversen ausgelöst. Nun ist er 96-jährig gestorben. Ein Nachruf.
Deutschland war seine Passion. Mit seinem Land haderte er, er wurde nicht müde, sich einzumischen, die Bürger in die Pflicht zu nehmen, Verantwortung zu übernehmen, sich kritisch mit der Politik auseinanderzusetzen. Wenn er damit provozierte, störte es ihn nicht. Martin Walser war ein homo politicus, der mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln die Öffentlichkeit aufrüttelte, um sie zu wachen Zeitgenossen zu erziehen. Der Schriftsteller als jemand, der Aufmerksamkeit für die wunden Punkte der Gesellschaft erregt, um – wenn schon nicht selbst verändernd eingreifen zu können – Diskussionen auszulösen und eine Streitkultur am Leben zu halten: Das sah er als seine dringende Aufgabe.
Walser konnte sich irren, er vergriff sich auch bisweilen im Ton, Halbherzigkeit war seine Sache nicht. Er nahm eine klare Haltung ein, auch wenn die sich im Lauf des Lebens veränderte. Kein Wunder bei einem, der, 1927 geboren, die Wandlungen der Gesellschaft in der Bundesrepublik mitgestaltete. Als einer der Vertrauten Siegfried Unselds war er wie auch Uwe Johnson oder Hans Magnus Enzensberger für die programmatische Linie des Suhrkamp Verlags verantwortlich, als sich Deutschland unter dem Eindruck der Studentenbewegung zu politisieren begann. Kurzfristig fühlte er sich der DKP nahe, was ihn nicht daran hinderte, die deutsche Teilung als schmerzlich zu empfinden, was ihn unter Linken zur Persona non grata machte. Streiterfahren, wie Walser war, schielte er nicht nach Gefolgschaft, und so nahm er immer wieder Haltungen ein, die ihn zum Singulär im Literaturbetrieb machten.
Eine Wendung im Schreiben
In weit fortgeschrittenem Alter gestand er dem Verfasser dieser Zeilen, der sich mit Walsers Werk seit seiner Dissertation von 1982 beschäftigt hat und den Schriftsteller und seine Spleens persönlich kannte, einmal Folgendes: Er, Walser, habe in einem seiner Romane einen Chauffeur erfunden, der nachts nicht schlafen konnte, weil er an seinen Chef denken musste – im Bewusstsein, dass dieser sehr wohl schlafen konnte, weil er nicht an seinen Chauffeur dachte. So jemand komme ihm nicht mehr ins Buch.
Zu dieser Zeit hatte sein Schreiben eine Wendung genommen, die er in jungen Jahren verhöhnt hätte. Er wandte sich der Religion zu, setzte sich mit katholischen Denkern auseinander, Spiritualität hatte sich seiner neuen Weltzugewandtheit bemächtigt. Der Roman „Statt etwas oder Der letzte Rank“ von 2017 konzentriert sich ganz auf die Innensicht des Erzählers. Des Erzählers? Kein guter Ausdruck für einen, der sich vor allem auf Befindlichkeiten und Seelenzustände kapriziert.
Ein großes Innehalten
Wollte man den Roman nacherzählen, käme man ins Taumeln. Was sich verändert hat, lässt sich allein am Vokabular der zumeist verstörten Rezensenten dingfest machen. Einer empfindet die Stimme als „göttliche Dreifaltigkeit“, „eine ganz eigene Hölle“ durchschreitet jemand anderer mit der Lektüre des Buches, während an anderer Stelle von einer „Seelenbeichte“ die Rede ist. Und was ist „Selbstergründung“ anderes als eine private Form von Beichte?
Diesem Buch fehlt mit Absicht der Zug, der einen Text nach vorne bringt. Er wirkt wie ein großes Innehalten, ein Fest der Stagnation. Man fühlt sich an die Tagebücher von Walser erinnert, in denen häufig Fundstücke für sich stehen, funkelnde Satzgebilde, rätselhaft in ihrer Schönheit und Eleganz, getrieben von einer Wahrheitssucht, die sich auf kleinstem Raum festsetzt. „Mir geht es ein bisschen zu gut“, lautet solch eine Eingebung oder: „Ich leide, also bin ich“ und „Ich bin unmöglich, also bin ich“. Solche Sätze, und Walser ist ein leidenschaftlicher Jäger nach Denk-Sätzen, sind Ritterschlag und Schreckgespenst, je nachdem, wie man sie wendet.
Das sieht vollkommen anders aus als Walsers Werk früher, das von einer Leichtigkeit durchdrungen ist, von lichten, hellen, heiteren Sätzen, sodass man den Eindruck gewinnt, hier schreibt jemand, dem die Worte einfach zufliegen. Noch später, in „Mädchenleben oder Die Heiligsprechung“ (2019), ist Walser überhaupt ins Stadium der Anbetung getreten. Das Mädchen Sirte steht im Mittelpunkt, von dem ein Zauber ausgeht, dem alle erliegen. Und der Erzähler übernimmt die Rolle des Evangelisten, um Taten und die Wirkung von Sirte festzuhalten. Der frühere Walser war der Chronist des Lächerlichen, der späte ist der Chronist des Erhabenen.
Deutsche Spießer als Motiv
Walsers Anfänge stehen noch ganz unter dem Eindruck Kafkas. „Ein Flugzeug über dem Haus“ heißt der Erzählband aus dem Jahr 1955, in dem parabelhaft Menschen auf der Strecke bleiben, die sich gegen unüberwindliche Widerstände, sich ein Stück Freiheit zu erkämpfen, durchzusetzen abmühen. Seit „Ehen in Philippsburg“ von 1957 bewegen sich seine Romane entlang der Geschichte der Bundesrepublik. Der Verfasser ist von der Hoffnung geleitet, „dass seine von der Wirklichkeit ermöglichten Erfindungen den oder jenen wie eigene Erfahrungen anmuten“. Der deutsche Spießer, Macht und Abhängigkeit, die Getriebenheit und die Sehnsucht, etwas darzustellen in der Gesellschaft: Solche Motive brachten Walser zum Schreiben. Dabei wandte er sich bevorzugt den Verlierern zu, die es nicht geschafft haben, im Aufstiegsstreben Schritt zu halten. Ironie war seine starke Waffe, mit all denen, die sich für etwas Besseres halten, abzurechnen. Die Frantzkes aus dem Philippsburg-Roman etwa: Die beiden wollen herausstechen aus dem Kleinstadtmilieu, und so stiftet der Mann einen Preis für den besten Sportler des Jahres. „Frau Frantzke verharrte in Wagnersängerhaltung, um den Beifall derer, die sie als ihre Freunde bezeichnet hatte, entgegenzunehmen.“ Der Mangel, schrieb Walser in einem frühen Essay, sei der innere Antrieb für sein Schreiben. Wem nichts fehle, der sei auch nicht getrieben vom Schreiben. Ebendiese Mangelerfahrung durchleben auch die Figuren seiner Bücher, die dadurch nicht zum Schreiben kommen, aber wie die Frantzkes seltsame Ideen hervorbringen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!


































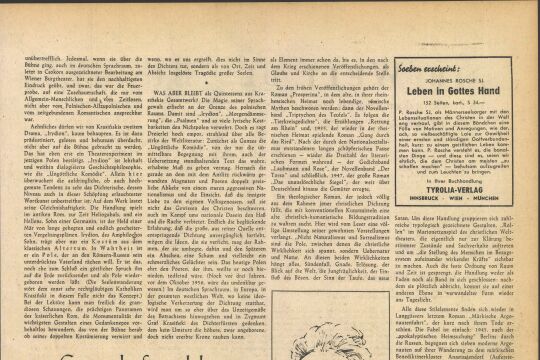




















































.jpg)












