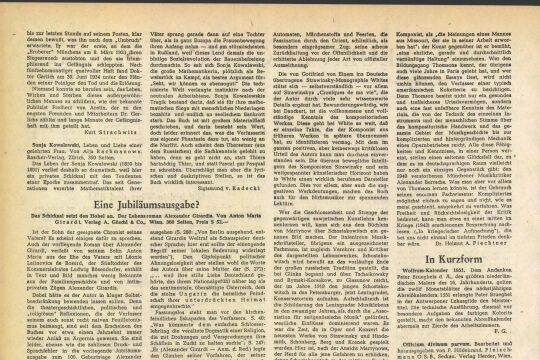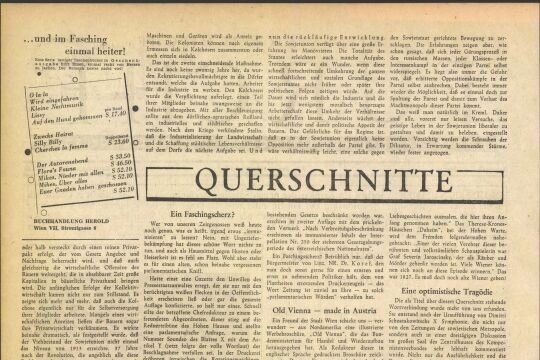Rückblick in Wut und Trauer
Zwei Jahrzehnte nach der umstrittenen Erstausgabe hält auch Maxim Schostakowitsch die Memoiren seines Vaters für echt.
Zwei Jahrzehnte nach der umstrittenen Erstausgabe hält auch Maxim Schostakowitsch die Memoiren seines Vaters für echt.
Ob es wahr ist, dass es die Wachen in Stalins Vorzimmer schon gewöhnt waren, Besucher, die sich aus Angst angemacht hatten, auszuziehen, zu duschen, wieder anzuziehen und in das Zimmer des Diktators zurückzubringen?
Stalins Besucher hatten Angst vor etwas, das "in dieser unvergesslichen heroischen Zeit" ungern beim Namen genannt wurde, wofür es aber eine ganze Reihe von Synonymen gab: Von "zu den Unkosten schreiben" oder "nach links schicken" bis zu "in Duchonins Stab versetzen" und "ablegen", was alles auf dasselbe hinauslief, nämlich auf Erschießen.
Ob es wahr ist, dass Stalin in seinen letzten Lebensjahren Tage um Tage allein in einer seiner zahlreichen Datschen saß, mit niemandem sprach und sich vornehmlich damit vergnügte, Fotos aus alten Zeitschriften auszuschneiden, auf festes Papier zu kleben und aufzuhängen?
Ob es wahr ist, dass er sich, falls er das von Wachposten auf Fahrrädern rund um die Uhr umkreiste Haus einmal verließ, "wie ein Paranoiker ständig argwöhnisch nach allen Seiten" umsah?
Dies alles lesen wir in den Memoiren des Dmitri Schostakowitsch, die nun in einer Neuausgabe wieder zu haben sind. Neu ist dabei vor allem ein umfangreiches Kapitel über die Rezeptionsgeschichte des Buches: "Der lange Weg zur Wahrheit" von Michael Koball. Die gesprochenen Erinnerungen des 1975 verstorbenen Komponisten wurden von Solomon Wolkow 1979 in den USA erstmals herausgegeben. Wolkow war ein in den Westen emigrierter junger Musikwissenschaftler und sein Buch mit dem Originaltitel "Zeugenaussage - Die Memoiren des Dmitri Schostakowitsch, herausgegeben und aufgezeichnet von Solomon Wolkow" hatte die Wirkung eines Paukenschlages. Im Westen war Schostakowitsch bis dahin zwar als Komponist anerkannt, aber als linientreu eingeschätzt worden. Nun wurde er posthum plötzlich zum "heimlichen Dissidenten", der ein menschenverachtendes System, dessen Schergen Millionen Menschen ermordet hatten, mit harten Worten als das bezeichnete, was es war, der Mord Mord nannte und dem Leid von Millionen seine Stimme gab.
Warten auf die Kugel Damals wurden starke Zweifel an der Echtheit geäußert. Von offizieller Moskauer Seite setzte selbstverständlich ein Propaganda-Trommelfeuer ein, in das, ebenso selbstverständlich, Schostakowitschs Schüler eingebunden waren. Aber auch seine junge dritte Frau Irina erklärte die Erinnerungen für gefälscht und Schostakowitschs Sohn Maxim schloss sich ihr an. Allerdings kannten sie den Originaltext nicht und verstanden damals beide noch kein Englisch. Aber auch etliche westliche Musikwissenschaftler hatten starke Zweifel an der Authentizität, so dass bis gegen Ende der achtziger Jahre die Ansicht vorherrschte, es handle sich um "eine mehr oder weniger elegant gemachte Fälschung".
Nachdem 1981 auch Maxim Schostakowitsch in den Westen gegangen war, wechselte er schrittweise die Fronten und erkannte schließlich "alles, was in dem Buch über die Verfolgung meines Vaters und die politischen Umstände gesagt wird", für "voll und ganz der Wahrheit" entsprechend. Auch die Sprache erkenne er "zum größten Teil als die meines Vaters wieder" und dankte Wolkow öffentlich für die Aufzeichnungen, "insbesondere für die Beschreibung der politischen Atmosphäre des Leidens, in der dieser große Künstler lebte". Für ihn sei dies der wichtigste Punkt des ganzen Buches.
Tatsächlich lautet eine der erschütterndsten Passagen: "Warten auf die Exekution ist eines der Themen, die mich mein Leben hindurch gemartert haben. Viele Seiten meiner Musik sprechen davon. Manchmal möchte ich es den Interpreten erklären in der Hoffnung, sie könnten das Werk dann besser verstehen. Doch dann hält mich der Gedanke zurück, dass man einem schlechten Interpreten sowieso nichts erklären kann, und ein guter wird es selber empfinden."
Vorwort-Autor Koball zitiert auch zwei Briefe Schostakowitschs an einen Freund, den Theaterkritiker Glikman, die köstliche Dokumente doppelbödigen Humors und wahre Meisterstücke der Kunst darstellen, kritische Gedanken so zu äußern, dass die Zensur keine Handhabe findet. Etwa wenn er sich 1942 über eine Stalin-Rede äußert ("Mein Freund! Wie traurig bin ich doch, dass wir diese Ansprache gehört haben und dabei so weit voneinander entfernt waren") oder wenn er 1957 einen Absatz lang in einem kleinen Kabinettstück verdeckter Satire zuerst die Namen der Persönlichkeiten aufzählt, deren Porträts anlässlich einer Feierlichkeit in den Straßen von Odessa zu sehen waren, sodann die "Begrüßungsrufe zu Ehren der großen Banner von Marx, Engels, Lenin und Stalin, sowie zu Ehren der Genossen..." (wieder folgt eine ebenso endlose wie komische Litanei) und zuletzt, "nicht imstande, meine Freude zurückzuhalten", ins Hotel zurückgeht, um das Erlebte dem Freund zu beschreiben.
Während man Schostakowitsch im Westen aufgrund seiner Reden und öffentlichen Erklärungen für einen gläubigen Stalinisten hielt, äußerte er im innersten Kreis, "er würde diese Dokumente auch unterzeichnen, wenn man ihm den Text auf dem Kopf stehend vorlegen würde", ein Ausspruch, den man freilich erst 1996 aus den Memoiren seines ehemaligen Sekretärs, des Musikwissenschaftlers Shitomirski, erfuhr. Die satirische Kantate "Rajok" über den Kongreß des Komponistenverbandes, bei dem Schostakowitsch zum zweiten Mal öffentlich gemaßregelt wurde und sich selbst beschuldigen musste, hielt er bis zu seinem Tod unter Verschluss. Er lässt darin unter anderem Stalin selbst als Solosänger "eine zynische und entlarvende Version der offiziellen Tagung" von 1948 von sich geben. ZK-Sekretär Shdanow hatte in seiner Rede behauptet, "eine ganze Reihe Werke zeitgenössischer Komponisten" (gemeint war in erster Reihe Schostakowitsch) erinnere "bald an eine Bohrmaschine, bald an ein musikalisches Mordinstrument". In Schostakowitschs Kantate singt Shdanow, "Musik, die nicht melodisch ist, Musik, die nicht ästhetisch ist, Musik, die ohne Anmut ist", sei wie eine Bohrmaschine, eine "musikalische Gaskammer". Während Stalin zur Melodie seines Lieblingsliedes "Suliko" Parteiphrasen drischt, lässt Schostakowitsch den Chor der Funktionäre süß wegschlummern.
Irinas Zweifel Während Schostakowitschs Vertraute Flora Litwinowa ihn mit einer Bemerkung zitiert, er treffe sich regelmäßig mit Wolkow, erzähle ihm "all meine Erinnerungen über mich und mein Werk" und lese beim nächsten Treffen Korrektur, blieb Irina Schostakowitsch bei ihrer Ablehnung: In Schostakowitschs Tageseinteilung sei gar nicht genug Zeit für diese Treffen gewesen, sie hätte mehr davon merken müssen. So oder so handelt es sich gewiss nur bedingt um Schostakowitschs Memoiren, denn die Stenogramme wurden laut Wolkow in vielen Anläufen aufgenommen und von Wolkow geordnet, angeordnet und bearbeitet. So oder so wirkt das Werk aber überzeugend und authentisch, und vieles, was nach seinem Erscheinen als Verleumdung der Sowjetunion begeifert wurde, gilt längst als historisch gesichert.
"Die Memoiren des Dmitri Schostakowitsch" sind ein eruptives Dokument des Zorns und der Trauer. Die großen Werke seiner Frühzeit, vor allem die Oper "Die Nase" nach der Erzählung von Gogol, waren jahrzehntelang verboten. Zweimal, 1936 und 1948, wurde er nach bekanntem Ritual kaltgestellt: Es begann mit einer kritischen Notiz in der "Prawda", von der jeder wusste, dass sie von Stalin inspiriert war, worauf ihn Bekannte und bisherige Freunde nicht mehr grüßten und ihm aus dem Weg gingen, bis hin zur totalen Isolation des Betroffenen. Zuerst meldeten sich einzelne, später immer mehr Berufskollegen in der "Prawda" mit Anwürfen und Angriffen gegen ihn zu Wort, am Ende protestierte die Belegschaft ganzer Großbetriebe dagegen, "solche Elemente" frei herumlaufen zu lassen. Seine Treue zum Vaterland wurde sogar daran gemessen, wieviele Symphonien er im positiven Dur und wieviele er im defaitistischen Moll geschrieben hatte. Wurden ihm dann die Fensterscheiben eingeworfen, wusste er, dass die Verhaftung und schließlich die Liquidierung bevorstand. Kurz, bevor er selber zum ersten Mal dran war, konnte er die Dramaturgie der Vernichtungsmaschine am Beispiel des Sowjetmarschalls Tuchatschewski beobachten. Dessen Erschießung folgte der Mord an Tausenden Offizieren, darunter sämtliche Raketenfachleute.
"Wäre ich Geiger..."
Sein Vater habe leider kein Geld für eine Geige gehabt, "als Geiger wäre ich jetzt besser dran", sagte Tuchatschewski vor seiner Verhaftung zu Schostakowitsch. Genau dasselbe hörte er vom Schauspieler und Regisseur Wsewolod Meyerhold: "Dann würde ich jetzt in irgendeinem Orchester sitzen und fiedeln" (Meyerhold starb im Lager). Es gibt mehrere Vermutungen, warum Stalin den Tuchatschewski-Freund Schostakowitsch letztlich jedes Mal verschonte. Seine eigene Version ist die nächstliegende: "Unser großer Führer und Lehrer ... entschied: Schostakowitsch kann Filmmusik schreiben. ... In Anbetracht der Umstände wäre es schlicht verrückt gewesen, Aufträge für Filmmusiken abzulehnen."
Der eingeschüchterte Komponist nahm das Verbot seiner wesentlichen Werke hin und schrieb gehorsam die große Musik zu den großen vaterländischen Filmen nach Stalins Geschmack. Und er hatte nach Stalins Tod noch die Kraft, als Komponist bei seinen frühen Arbeiten wie etwa der Oper "Die Nase" anzuknüpfen.
Schostakowitsch nimmt für sich in Anspruch, zwar ein gehorsamer Komponist gewesen, aber niemals über einen anderen hergezogen zu sein und trotz seiner Todesangst keine einzige Denunziation begangen zu haben.
Er nennt Denunzianten beim Namen und bezeichnet Feiglinge als Feiglinge und Speichellecker als Speichellecker. Auch der Gedanke an die Besucher, die auf Stalin hereinfielen und ihm im Westen Loblieder sangen, wie Lion Feuchtwanger, Andre Malraux, Romain Rolland und Bernard Shaw "verursacht mir Brechreiz. Besonders widerlich ist mir, dass einige dieser Humanisten meine Musik loben, Shaw beispielsweise und eben auch Romain Rolland". Shaw zitiert er mit einem Satz von tatsächlich weltgeschichtlicher Blödheit, nämlich, der Hunger in Russland sei dummes Geschwätz, "nirgends habe ich so gut gespeist wie in Russland".
Wahrhaftig, das ist ein ein Buch der Wut und Trauer über millionenfaches Leid ohne jenseitigen Trost und höheren Sinn: "Ich dachte an meine Bekannten. Und ich sah nur Tote, Berge von Toten. Ich übertreibe nicht: Berge von Toten. Und dieses Bild erfüllt mich mit abgrundtiefer Trauer."
Die Memoiren des Dmitri Schostakowitsch. Herausgegeben von Solomon Wolkow. Propyläen Verlag, Berlin 2000. 440 Seiten, geb., Fotos, öS 350,- /e 25,44