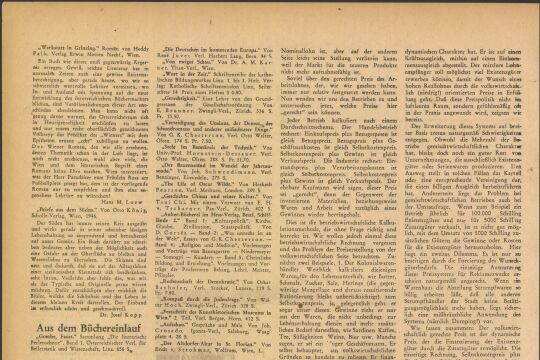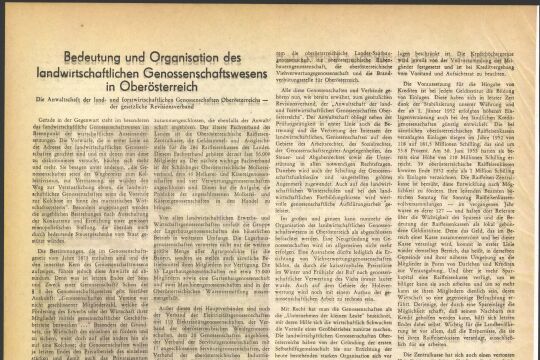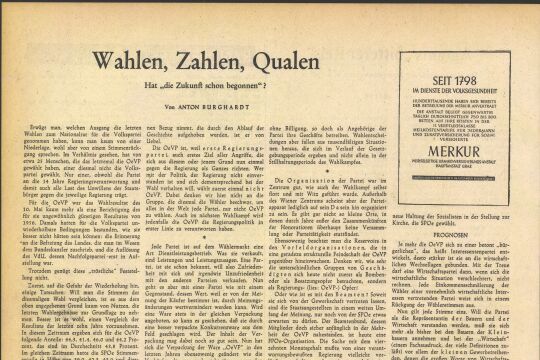Angeblich geringes Risiko und Renditen jenseits der zwanzig Prozent klingen verlockend - aber das vermeintlich sichere Geschäft entpuppt sich meist als billiger Schmäh.
Die Zinsen auf Sparbücher sind gering, mit der Börse hat man sich noch nie befasst - und dann ruft jemand an und bietet ein Geschäft mit sagenhafter Rendite, bei dem angeblich nichts schiefgehen kann. Bis zu 40 Prozent Ertrag werden zugesichert, und trotzdem klingt für das spätere Opfer alles "irgendwie seriös". Nicht so jedoch für Rudolf Unterköfler, Leiter des Büros für Wirtschafts- und Finanzermittlungen im Bundeskriminalamt. "Finanzexperten sagen, bei einer versprochenen Rendite über fünf Prozent könne etwas nicht stimmen."
Schnelles Geld, schnell weg
Das Geld wird freilich nicht über eine Bank, eine Fondsgesellschaft, eine Versicherung oder Sparkasse angelegt, sondern auf dem "grauen Kapitalmarkt", auf dem nicht konzessionspflichtige Firmen ohne Kontrolle der Finanzmarktaufsicht an sich legal Anlageprodukte anbieten. Aber nach Schätzung der Internationalen Handelskammer in Wien sollen in Österreich jährlich drei bis vier Milliarden Euro Schaden entstehen, weil sich Betrüger diesen grauen Kapitalmarkt und die Hoffnung vieler Menschen auf das schnelle Geld zu Nutze machen. Genauere Angaben zur Schadenssumme sind nicht möglich, weil oft Schwarzgeld investiert wird - und die Opfer sich davor hüten, zur Polizei zu gehen.
Anlagemöglichkeiten, auf die man hereinfallen kann, gibt es zuhauf: Zum Beispiel wird per Telefon, E-Mail oder bei einem persönlichen Besuch ein Immobilienfonds angepriesen. "Man macht den Leuten Angst, dass ihre Pensionen nicht gesichert seien und dass sie mit einer Investition in wertbeständige Immobilien gut beraten seien", erklärt Unterköfler. Nur gibt es die Immobilie entweder nicht oder sie ist wesentlich weniger wert als behauptet. Und die angeblichen Verwaltungskosten sind so hoch, dass bald nichts mehr von dem veranlagten Geld übrig ist. Auch die Timesharing-Masche funktioniert noch immer, allerdings in weiterentwickelter Form. Denn mittlerweile kauft fast niemand mehr dieses Recht, ein paar Wochen im Jahr in einer oft miserabel gelegenen Ferienanlage seinen Urlaub verbringen zu dürfen. Im Gegenteil: Die meisten Inhaber solcher Anteile wollen diese wieder loswerden, finden aber keinen Käufer. Und dann meldet sich plötzlich ein Anwalt, der einen solche aufgetrieben haben will. Vorher müssen nur noch ein paar tausend Euro Spesen und Verwaltungsgebühren bezahlt werden ...
Fantastische Firmen
Einen großen Teil des Anlagebetruges macht der Handel mit Anteilen an Firmen aus, die angeblich in wenigen Jahren an die Börse gehen. Das Versprechen: Mit dem Börsegang vervielfache sich der Wert dieser Anteile. Nur taucht das Unternehmen an der Börse nie auf, in Wahrheit besteht es nur für wenige Monate oder überhaupt nur im Internet auf einer eigens für den Betrug programmierten Homepage. Dort wiederum finden sich Verweise auf angebliche offizielle Stellen, die die Glaubwürdigkeit der Homepage untermauern sollen. Ein ganzes Netz an Bürgen wird inszeniert. In einem derzeit anhängigen Fall wurden sogar elf offizielle Stellen erfunden - samt professionellen Internetseiten, auf denen man sich über die Redlichkeit der angeblich börsereifen Firma informieren konnte. In Österreich sind im besagten Fall sechs, in 32 anderen Ländern auf der ganzen Welt mehr als tausend Geschädigte bekannt. Mehr als 40 Firmen waren involviert, die alle nur ein paar Wochen existiert hatten. "Einen Fall mit solchen Dimensionen zu untersuchen und wirklich zu durchschauen, dauert Jahre", befürchtet Unterköfler.
Eine weitere Möglichkeit, bei Anlegern abzukassieren, ist das Versprechen, in angeblich todsichere Aktien oder Waren zu investieren. Oft wird der Geldgeber mit kleinen Gewinnen geködert, aber sobald er mehr investiert, ist die Gewinnphase zu Ende. Die Begründung, die dem Opfer genannt wird: Die Spesen seien so hoch, dass trotz erfolgreicher Investitionen kein Gewinn übrig bleibe. "Da wird an einem Tag in Schweinebäuche investiert", erzählt der Kriminalbeamte, "um am nächsten Tag das Geld wieder herauszunehmen und in etwas anderes zu investieren. Und jedesmal fallen 40 Prozent Spesen an."
Die Beute aus den Betrügereien ist häufig unauffindbar. Wurde das Geld auf ein Konto überwiesen, ist dieses meist leer geräumt, bevor die Polizei von der Tat erfährt. Wurde die Investition per Scheck getätigt, hat diesen zum Beispiel "ein Obdachloser in London eingelöst, der dafür von einem Unbekannten 50 Pfund bekommen hat." Die Ermittlungen sind entsprechend schwierig. Dazu kommt, dass oft gar nicht klar ist, in welchem Land sich die Täter befinden. Häufig gibt es eine Kontaktadresse samt Telefonnummer in Europa, die nicht mehr ist als ein Büroservice mit automatischer Rufumleitung zu einer anderen Telefonnummer in einem anderen Land, vielleicht auf einem anderen Kontinent. Wo der Geschäftspartner, den man oft nur vom Telefon kennt, tatsächlich sitzt, lässt sich dann kaum nachvollziehen. Im schlimmsten Fall gehört die Nummer zu einer Firma mit Sitz irgendwo in der Südsee, die Adresse ist nicht mehr als ein schäbiger Briefkasten und das dortige Recht verlangt weder einen Geschäftsführer noch Aufzeichnungen über die Geschäftsvorgänge: Endstation für die Polizei.
Aber auch innerhalb von Europa "ist die Polizeizusammenarbeit stark verbesserungswürdig", ärgert sich Unterköfler und erzählt von einer Interpol-Anfrage "an einen westeuropäischen Staat, den ich lieber nicht nennen will." Es ging um einen der seit mehr als 16 Jahren bekannten Nigeria-Briefe, in dem meist ein Afrikaner per E-Mail finanzielle Unterstützung sucht: Ein naher Verwandter - reicher Politiker oder Geschäftsmann - sei ums Leben gekommen, und um dessen Millionenvermögen außer Landes zu schaffen, sei eine gewisse Vorleistung an Bestechungs- und Verwaltungsgeldern nötig. Wer so freundlich ist, das nötige Geld zur Verfügung zu stellen, werde am losgeeisten Vermögen mit bis zu 50 Prozent beteiligt. Natürlich sieht der edle Sponsor sein Geld nie wieder. Obwohl seit Jahren vor diesen Briefen gewarnt wird, entsteht allein in Österreich jedes Jahr ein Schaden von mindestens 200.000 Euro. In dem Fall, den Unterköfler schildert, wurde der Täter nicht in Afrika, sondern in Europa vermutet, eine Interpol-Anfrage an des betreffende Land geschickt. Die Antwort: Der Justizminister habe entschieden, dass Ermittlungen erst ab einer Schadenshöhe von 75.000 Euro einzuleiten sind. Da der Schaden in dem angefragten Fall geringer war, wurde die Zusammenarbeit verweigert. "Der Schaden wird einfach als Deppensteuer abgetan", schimpft der Kriminalbeamte.
Opfer überschätzen sich
"Die Täter wirken seriös und kompetent", erzählt er, "sie sind psychologisch geschult und bieten oft beglaubigte Urkunden von Notaren oder Rechtsanwälten, die in Wahrheit aber gar nichts aussagen." Dazu führen sie Firmennamen, die ähnlich klingen wie beispielsweise große Versicherungs- oder Bankkonzerne - mit denen sie in Wahrheit freilich nichts zu tun haben.
Und die Opfer? Die stammen laut Unterköfler aus allen sozialen Schichten - "vom einfachen Arbeiter bis zum sonst geschickten Unternehmer" und seien meist männlich, "weil die Männer eher ihre Finanzkompetenz überschätzen und unvorsichtiger sind".
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!