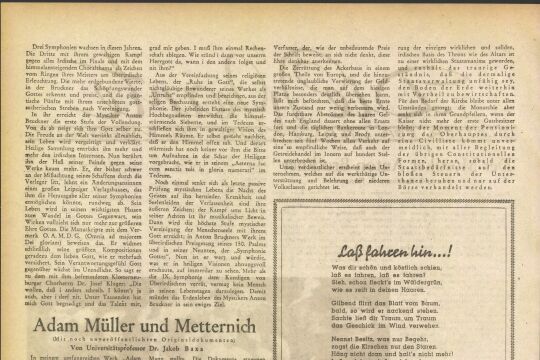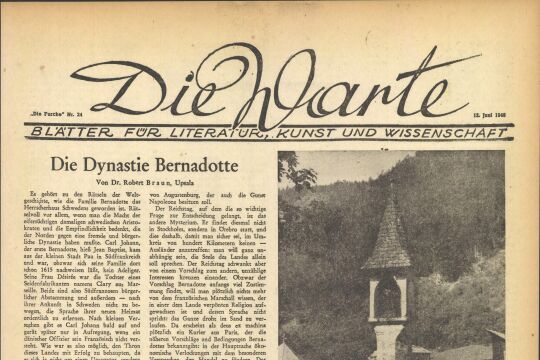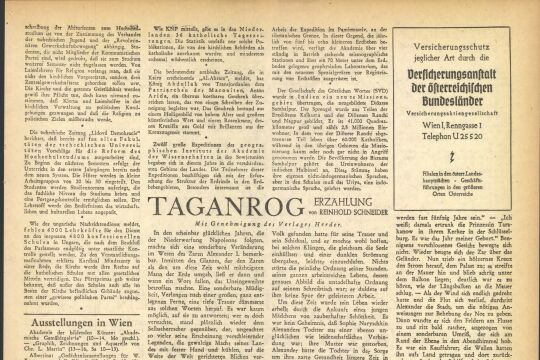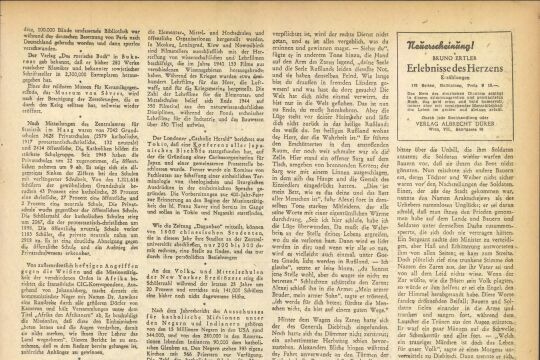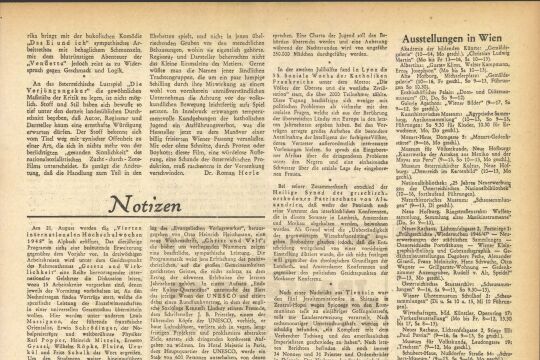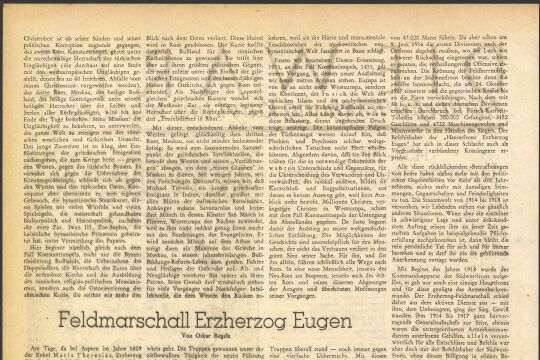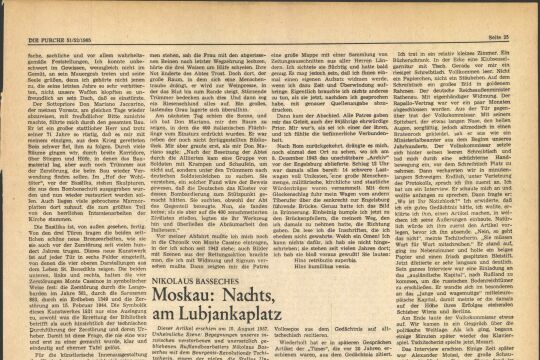Die Trottes waren ein junges Geschlecht. Ihr Ahnherr hatte in der Schlacht bei Solferino den Adel bekommen. Er war Slowene. Sipolje — der Name des Dorfes, aus dem er stammte — wurde sein Adelsprädikat. Zu einer besonderen Tat hatte ihn das Schicksal ausersehen. Er aber sorgte dafür, daß ihn die späteren Zeiten aus dem Gedächtnis verloren.
In der Schlacht bei Solferino befehligte er als Leutnant der Infanterie einen Zug. Seit einer halben Stunde war das Gefecht im Gange. Drei Schritte vor sich sah er die weißen Röcke seiner Soldaten. Die erste Reihe seines Zuges kniete, die zweite stand. Heiter waren alle und sicher des Sieges. Da erschien zwischen dem Leutnant und den Rücken der Soldaten der Kaiser mit zwei Offizieren des Generalstabes. Er wollte gerade einen Feldstecher, den ihm einer der Begleiter reichte, an die Augen führen. Trotta wußte, was das bedeutete: wer einen Feldstecher hob, gab zu erkennen, daß er ein Ziel sei, würdig, getroffen zu werden. Und es war der junge Kaiser. Trotta fühlte sein Herz im Halse. Seine Knie zitterten. Und der ewige Groll des subalternen Frontoffiziers gegen die hohen Herren des Generalstabes diktierte dem Leutnant jene Handlung, die seinen Namen unauslöschlich in die Geschichte seines Regiments einprägte. Er griff mit beiden Händen nach den Schultern des Monarchen, um ihn niederzudrücken. Der Kaiser fiel sofort um. Die Begleiter stürzten auf den Fallenden. In diesem Augenblick durchbohrte ein Schuß die linke Schulter des Leutnants, jener Schuß eben, der dem Herzen des Kaisers gegolten hatte. Während er sich erhob, sank der Leutnant nieder. Der Kaiser, ungeduldig von seinen Begleitern gemahnt, die gefährliche Stelle zu verlassen, beugte sich dennoch über den liegenden Leutnant und fragte, eingedenk seiner kaiserlichen Pflicht, den Ohnmächtigen, der nichts mehr hörte, wie er denn heiße. Ein Sanitätsunteroffizier und zwei Mann mit einer Tragbahre galoppierten herbei, die Rük- ken geduckt und die Köpfe gesenkt und trugen den Leutnant zum nächsten Verbandzelt.
Das linke Schlüsselbein Trottas war zerschmettert. Das Geschoß, unmittelbar unter dem linken Schulterblatt steckengeblieben, entfernte man unter dem unmenschlichen Gebrüll des Verwundeten, den der Schmerz aus der Ohnmacht geweckt hatte.
Trotta wurde nach vier Wochen gesund. Als er in seine südungarische Garnison zurückkehrte, besaß er den Rang eiens Hauptmannes, die höchste aller Auszeichnungen: den Maria-Theresien- Orden und die Baronie. Er hieß von nun ab: Hauptmann Joseph Trotta Freiherr von Sipolje.
Als hätte man sein eigenes Leben gegen ein fremdes vertauscht, wiederholte er sich jede Nacht vor dem Einschlafen und jeden Morgen nach seinem Erwachen seinen neuen Rang und seinen neuen Stand. Zwischen der linkischen Vertraulichkeit, mit der seine Kameraden den Abstand zu überwinden versuchten, den das unbegreifliche Schicksal plötzlich zwischen ihn und sie gelegt hatte, und seinen eigenen Bemühungen, aller Welt mit der gewohnten Unbefangenheit entgegenzutreten, schien der geadelte Hauptmann das Gleichgewicht zu verlieren. Sein Großvater noch war ein kleiner Bauer gewesen, sein Vater Rechnungsunteroffizier, später Gendarmeriewachtmeister im südlichen Grenzgebiet der Monarchie. Seitdem er im Kampf mit bosnischen Schmugglern ein Auge verloren batte, lebte er als Militärinvalide und Parkwächter des Schlosses Laxenburg. Natürlich und angemessen schien der Rang eines gewöhnlichen Leutnants der Infanterie dem Sohn des Unteroffiziers. Dem adeligen und ausgezeichneten Hauptmann aber war der leibliche Vater plötzlich ferngerückt. Seit fünf Jahren hatte der Hauptmann seinen Vater nicht gesehen; wohl aber jede zweite Woche, wenn er nach dem unveränderlichen Turnus in den Stationsdienst kam, dem Alten einen kurzen Bftef geschrieben, im Wacht- zimmer, beim kärglichen und unruhigen Schein der Dienstkerze. Wie Dienstzettel glichen die Briefe einander, geschrieben auf gelblichem und holzfaserigem Oktavpapier, beginnend mit Lieber Vater!“ links, vier Finger Abstand vom oberen Rand, und zwei vom seitlichen, und endend mit der Wendung: „In Ehrfurcht Ihr treuer und dankbarer Sohn Joseph Trotta, Leutnant.“ Wie aber sollte man jetzt, zumal man dank dem neuen Rang nicht mehr den alten Turnus mitmachte, die gesetzmäßige, für ein ganzes Soldatenleben be- I rechnete Form der Briefe ändern und zwischen die normierten Sätze ungewöhnliche Mitteilungen von ungewöhnlich gewordenen Verhältnissen rücken, die man selbst noch kaum begriffen hatte? An jenem Abend, an dem sich der Hauptmann Trotta zum erstenmal nach seiner Genesung an den Tisch setzte, um die Pflicht der Korrespondenz zu erfüllen, sah er ein, daß er über die Anrede „Lieber Vater!“ nie hinauskommen würde. Nach langem überlegen erhob er sich endlich mit dem Entschluß, den Vater in der nächsten Woche zu besuchen, nach vorgeschriebener Audienz beim Kaiser, zu der man ihn in einigen Tagen abkommandieren sollte.
Eine Woche später fuhr er unmittelbar von der Audienz im Fiaker zu seinem Vater nach Laxenburg. Er traf den Alten in der Küche seiner Dienstwohnung, in Hemdärmeln. Hauptmann Joseph Trotta Freiherr von Sipolje stand inmitten dieser ärmlichen ärarischen Umgebung wie ein militärischer Gott, von der überirdischen Macht des Maria-Theresien-Ordens gesegnet. Hauptmann Trotta küßte die Hand seines Vaters, beugte den Kopf tiefer und empfing einen Kuß auf die Stirn und auf die Wange. „Setz dich!’ sagte der Alte. „Ich gratuliere dir“, fuhr er fort, im harten Deutsch der Armeeslawen. „Gratuliere, gratuliere!“ wiederholte der Wachtmeister. „Zu meiner Zeit ist es nie so schnell gegangen! Zu meiner Zeit hat uns noch der Radetzky gezwiebelt!“ Es ist tatsächlich aus! dachte der Hauptmann Trotta. Getrennt von ihm war der Vater durch einen schweren Berg militärischer Grade. „Haben Sie noch Ra- kija, Herr Vater?“ frag er, um den letzten Rest der familiären Gemeinsamkeit zu bestätigen. Sie tranken, stießen an, tranken wieder, der Alte begann Allerweltsgeschichten aus der eigenen Militärzeit zu erzählen, mit der unbezweifelbaren Absicht, die Karriere des Sohnes geringer erscheinen zu lassen. Schließlich erhob sich der Hauptmann, küßte die väterliche Hand und ging, mit dem sicheren Bewußtsein, daß er den Vater zum letztenmal in diesem Leben gesehen hatte.
Es war das letztemal gewesen. Der Sohn schrieb dem Alten die gewohnten Briefe, es gab keine andere sichtbare Beziehung mehr zwischen beiden — losgelöst war der Hauptmann Trotta von dem langen Zug seiner bäuerlichen slawischen Vorfahren. Ein neues Geschlecht brach mit ihm an. Die runden Jahre rollten nacheinander ab. Standesgemäß heiratete Trotta die nicht mehr ganz junge, begüterte Nichte seines Obersten, bekam einen Sohn, genoß das Gleichmaß seiner gesunden militärischen Existenz in der kleinen Garnison, wurde heimisch in seinem Rang, seinem Stand, seiner Würde und seinem Ruhm.
Er las keine Bücher, der Hauptmann Trotta, und bemitleidete im stillen seinen heranwachsenden Sohn, auf den die unvermeidlichen Lesebücher bereits warteten. Noch war der Hauptmann überzeugt, daß auch sein Sohn Soldat werden müsse. Bis er eines Tages das Lesebuch seines Sohnes mit lässiger Neugier in die Hand nahm. Er schlug das Inhaltsverzeichnis auf und fand den Titel eines Lesestückes, das ihn selbst zu betreffen schien, denn es hieß: „Franz Joseph I. in der Schlacht bei Solferino“; las und mußte sich setzen. „In der Schlacht bei Solferino“ — so begann der Abschnitt — „geriet unser Kaiser in große Gefahr. Der Monarch hatte sich im Eifer zu weit vorgewagt, daß er sich plötzlich von feindlichen Reitern umdrängt sah. In diesfem Augenblick der höchsten Not sprengte ein blutjunger Leutnant auf schweißbedecktem Fuchs herbei, den Säbel schwingend. Eine feindliche Lanze durchbohrte die Brust des jungen Helden, aber die Mehrzahl der Feinde war bereits durch ihn gefallen. Den blanken Degen in der Hand, konnte sich der junge Monarch der immer schwalchet werdenden Angriffe entziehen. Damals geriet die ganze feindliche Reiterei in Gefangenschaft. Der junge Leutnant aber — Joseph Trotta war sein Name — bekam die höchste Auszeichnung, die unser Vaterland seinen Heldensöhnen zu vergeben hat: den Maria-Theresien-Or- den.“ Hauptmann Trotta ging, das Lesebuch in der Hand, in den kleinen Obstgarten hinter das Haus, wo sich seine Frau beschäftigte, Die Lippen blaß, mit ganz leiser Stimme fragte er sie, ob ihr das infame Lesestück bekannt sei. Sie nickte lächelnd. „Es ist eine Lüge!“ schrie der Hauptmann. „Es ist für Kinder“, antwortete sanft seine Frau. Der Hauptmann kehrte ihr den Rücken. Der Zorn schüttelte ihn.
Den nächsten Morgen, beim Offiziersrapport, brachte er knapp und klingend seine Beschwerde vor den Obersten. Sie wurde weitergeleitet. Und nun begann das Martyrium des Hauptmanns Trotta Es dauerte Wochen, bis vom Kriegsministerium die Antwort kam, daß die Beschwerde an das Kultusministerium weitergeleitet worden sei. Und abermals vergingen Wochen, bis eines Tages die Antwort des Kultusministers eintraf. Sie war negativ. Der Oberst übergab dem Hauptmann das Schriftstück mit den väterlichen Worten: „Laß die Geschichte!
Trotta nahm es entgegen und schwieg Eine Woche später ersuchte er auf dem vörgeschriebenen Dienstweg um eine Audienz bei Seiner Majestät, und drei Wochen später stand er an einem Vormittag in der Burg, gegenüber seinem Allerhöchsten Kriegsherrn.
„Sehen Sie, lieber Trotta!“ sagte der Kaiser. „Die Sache ist recht unangenehm.
Aber schlecht kommen wir beide dabei nicht weg. Lassen S’ die Geschieht’.“
„Majestät“, erwiderte der Hauptmann, „es ist einp Lüge.“
„Es wird viel gelogen“, bestätigte der Kaiser.
„Ich kann nicht Majestät“, würgte der Hauptmann.
Der Kaiser trat nahe an den Hauptmann. „Meine Minister“, begann Franz Joseph, „müssen selber wissen, was sie tun. Ich muß mich auf sie verlassen. Verstehen Sie, lieber Hauptmann Trotta?“ Und, nach einer Weile: „Wir wollen’s besser machen. Sie sollen es sehen.“
Die Audienz war zu Ende. Trotta kehrte in die Garnison zurück und bat um Entlassung aus der Armee. Er wurde als Major entlassen. Er übersiedelte nach Böhmen, auf das kleine Gut seines Schwiegervaters. Die kaiserliche Gnade verließ ihn nicht. Ein paar Wochen später erhielt er die Mitteilung, daß der Kaiser geruht habe, dem Sohn seines Lebensretters aus seiner Privatschatulle fünftausend Gulden für Studienzwecke zuzuweisen.
Trotta wurde rasch alt. Vertrieben war er aus dem Paradies der einfachen Gläubigkeit an Kaiser und Tugend, Wahrheit und Recht. Dank dem gelegentlich geäußerten Wunsch des Kaisers, verschwand das ominöse Lesestück aus den Schulbüchern der Monarchie. Der Name Trotta verblieb nur in den anonymen Annalen des Regiments. Der Major lebte dahin auf dem Gut seines Schwiegervaters und wurde wieder ein kleiner slowenischer Bauer, der zweimal in der Woche seinem Vater schrieb, am späten Abend, bei flackernder Kerze, auf gelblichen Oktavpapier, Sehr selten erhielt er eine Antwort. Einmal, es war ein heller Tag im März, brachte ihm der Knecht einen Brief von der Schloßverwaltung Laxenburg. Der Alte war tot, schmerzlos entschlafen im Alter von einundachtzig Jahren. Der Baron Trotta sagte nur: „Geh zur Frau Baronin, mein Koffer soll gepackt werden, ich fahre abends nach Wien“. Beim Essen aß er hastig die Suppe und das Fleisch. Dann sagte er zur Frau: „Ich kann nicht weiter. Mein Vater war ein guter Mann. Du hast ihn nie gesehn!“ War’s ein Nachruf, war’s eine Klage?
Man begrub den Invaliden auf dem kleinen Friedhof in Laxenburg, Militärabteilung. Sechs dunkelblaue Kameraden trugen den Sarg von der Kapelle zum Grab.
Der Baron fuhr nach dem Begräbnis gleich wieder zurück. Und ging wieder seinem gewohnten Tagewerk nach. Und die Jahre rollten dahin .wie gleichmäßige, friedliche, dunkle, stumme Räder. Der Wachtmeister war nicht die letzte Leiche, die der Baron zu bestatten hatte. Er begrub zuerst seinen Schwiegervater, ein paar Jahre später seine Frau- Er gab seinen Sohn in ein Pensionat nach Wien und verfügte, daß der Sohn niemals aktiver Soldat werden dürfe. Er blieb allein auf dem Gut, in dem weißen, geräumigen Haus, durch das “noch der Atem der Verstorbenen ging, sprach nur mit dem Förster, dem Verwalter, dem Knecht und dem Kutscher. Zweimal im Monat empfing er gehorsame Briefe seines Kindes, einmal im Monat antwortete er in kurzen Sätzen. Am 18. August, dem Geburtstag des Kaisers, fuhr er in Uniform in die nächste Garnisonsstadt. Zweimal im Jahr kam der Sohn zu Besuch.
Der Sohn wurde Jurist, wurde politischer Beamter, Bezirkskommissär in Schlesien. War der Name Trotta auch aus den autorisierten Schulbüchern verschwunden, so dosh nicht aus den geheimen Akten der hohen politischen Behörden. Er avancierte schnell. Zwei Jahre vor seiner Ernennung zum Bezirkshauptmann starb der Major.
Er hinterließ ein überraschendes Testament. Da er sicher sei des Umstandes, daß ein Sohn kein guter Landwirt wäre, und da er hoffe, daß die Trottas dem Kaiser dankbar für seine währende Huld im Staatsdienst zu Rang und Würden kommen und glücklicher als er, der Verfasser des Testaments, im Leben werden könne, habe er sich entschlossen, im Andenken an seinen seligen Vater, das Gut dem Militärinvalidenfonds zu vermachen, wohingegen die Nutznießer das Testaments keine andere Verpflichtung hätten, als die, den Erblasser in möglichster Bescheidenheit auf jenem Friedhof zu bestatten, auf dem sein Vater beigesetzt worden ei, ginge es leicht, dann in der Nähe des Verstorbenen. Er, der Erblasser, bitte, von jedem Pomp abzusehen. Das vorhandene Bargeld und der Schmuck gehören dem einzigen Sohn des Erblassers.
Eine Wiener Militärkapelle, eine Kompanie Infanterie, ein Vertreter des Maria- Theresien-Ordens, Vertreter des südungarischen Regiments, dessen bescheidener Held der Major gewesen war, alle marschfähigen Invaliden, zwei Beamte der Kabinettskanzlei, ein Unteroffizier mit dem Maria-Theresien-Orden auf dem Kissen: sie bildeten das offizielle Leichen- begnängnis. Franz, der Sohn, ging schwarz, schmal und allein. Er weinte nicht. Niemand weinte um den Toten. Alles blieb feierlich und trocken. Niemand sprach am Grab. In der Nähe des Gendarmeriewachtmeisters lag Major Freiherr von Trotta und Sipolje, der Ritter der Wahrheit. Man setzte ihn einen einfachen militärischen Grabstein, auf den in schwarzen, schmalen Buchstaben neben Namen, Rang und Regiment, der stolze Beinamen eingegraben war: „Der Held von Solferino.“
Aui „Radetzkymarsch“, Verlag G. Kiepenheuer, Köln.,