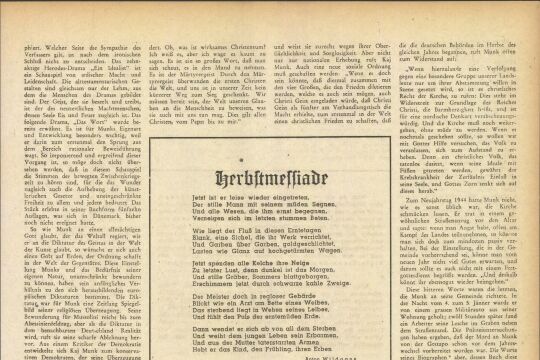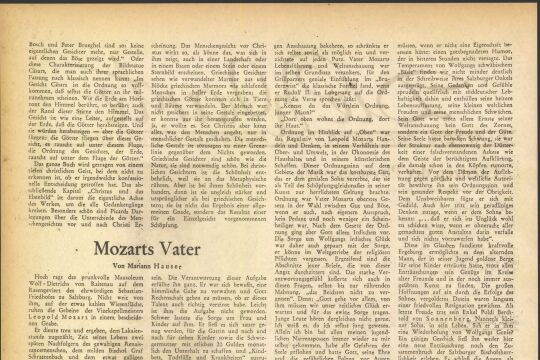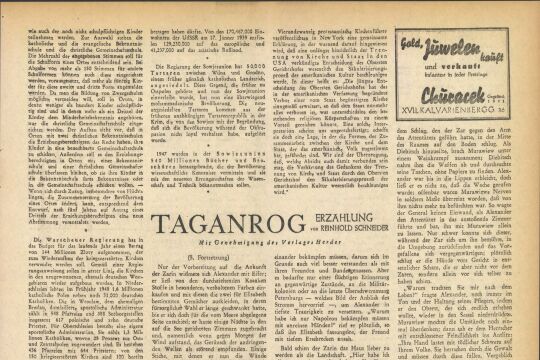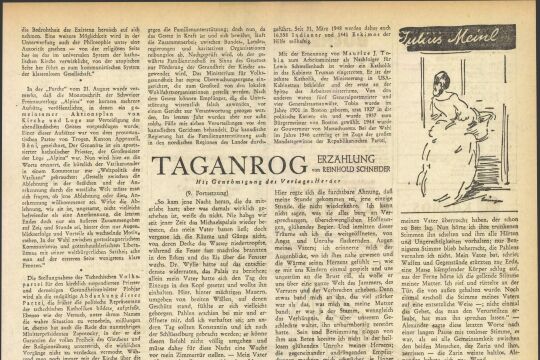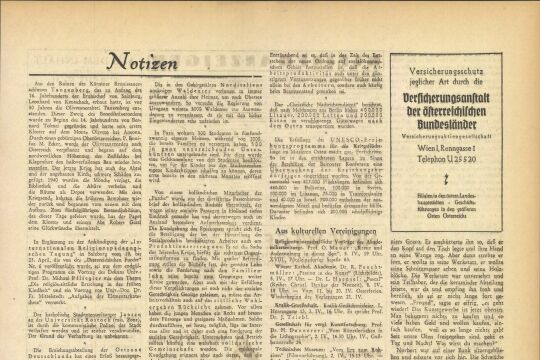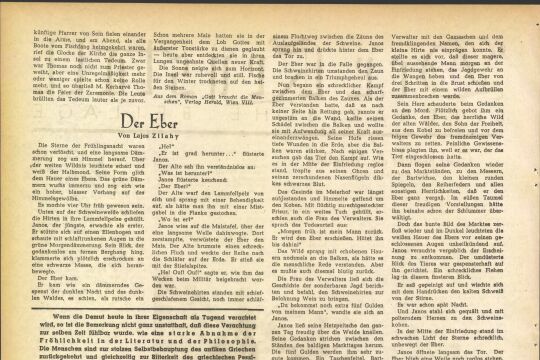In den Tagen, da Karl, erst neunzehnjährig, König von Spanien war, schlug ein Sohn seinen Vater auf offener Straße. Die Ursache des Streites schien belanglos. Der Vater, Graf Ruiz de Turillas, ging mit seinen zwei Söhnen Alvar und Carlos durch die Stadt. Herzliches Verständnis hatte nie zwischen den beiden Brüdern geherrscht. Daß sie aber auf öffentlichem Platz in heftigem Wortwechsel entbrannten und inmitten der Gasse und der Leute den Degen zogen, geschah zum erstenmal. Der Vater befahl Alvar, dem einen der Söhne, seinen Degen einzustecken. Da dieser nicht sogleich gehorchte, drohte ihm der Graf mit dem Stock, worauf Don Alvar in jähem Zorn den Alten zu Boden schlug. Don Alvar versuchte zu fliehen, ward jedoch ergriffen und der. Haft überliefert.
Anderntags meldete sich der Kanzler zur üblichen Stunde der Berichterstattung beim König, um ihn über die jüngsten Vorfälle zu unterrichten. Ohne allzu lebhafte Teilnahme hörte der König die Mitteilungen an.
Erst als der Kanzler die Untat eines Sohnes gegen seinen Vater schilderte, horchte der König ernstlich auf. Daß ein Sohn seinen Vater schlagen konnte, erfüllte ihn mit Entsetzen.
Der Kanzler versuchte, die Majestät zu beruhigen: die Welt habe schon weit Schlimmeres gesehen.
Der König faßte es nicht, daß der Kanzler die Schwere des Verbrechens herabmindern wollte.
„Messire“, sagte er, „Spanien ist nicht nur einem König Untertan; über Spanien herrscht Gott. Spaniens Gesetze stellte nicht ein König auf,- Gottes Gesetze sind Spaniens. Sie wissen, was dies bedeutet, Messire: Wem Macht gegeben ist in Spanien — dem König über sein Reich, dem Konnetable über seine Länder, dem Vater über seine Kinder —, der weiß, daß sie ein Lehen ist von Gott. Es gibt keine Menschenmacht in Spanien, gegen die man ungestraft die Hand erheben dürfte. Wer seinen Vater schlägt, schlägt Gott. Messire, hier wurde Gott geschlagen. Schaudert Ihnen nicht vor der Größe dieses Verbrechens?“
Der Kanzler erwiderte erst nach einem tiefen Atemzug: Majestät haben einen guten und schönen Glauben, aber Majestät sei noch jung; sie könne noch kaum wissen, wie sehr verwickelt das Leben sei; man dürfe nicht die starren Regeln eines einfachen Glaubens an das Leben herantragen, sonst vermöge man nicht, der Fülle des Lebens gerecht zu werden, und Majestät wolle doch gerecht sein.
Der junge König blieb den Worten des Kanzlers unzugänglich, seine Meinung war: nur die Hinrichtung dieses verbrecherischen Sohnes könne die Heiligung der verletzten Vaterwürde wieder herbeiführen.
Der Kanzler hatte die erhitzte Rede des jungen Königs kühl angehört. Als der König schwieg, fragte er, ob Majestät nicht ein besonderes Gericht zur Beurteilung dieses Verbrechens einsetzen möchte. Der Kanzler erinnerte den König an Don Inigo de Velasco, den Konnetable von Kastilien. Dieser sei ein gerechter und gerader Mann, seine höchste Ehre sei immer treue Pflichterfüllung und unbestechliche Gerechtigkeit gewesen.
Der Rat gefiel dem König. De Velasco, mit Kolumbus auf der großen Entdeckungsreise gewesen, hatte seit seiner Rückkehr durch wohlüberlegten, auf i eicher Erfahrung und reifer Klugheit be-tuhenden Richtspruch der Sache des Rechts in Spanien schon manchen guten Dienst erwiesen. Der König wünschte, durch einen dermaßen vertrauenswürdigen und angesehenen Richter sein Todesurteil über den verbrecherischen Sohn bestätigt zu hören. Er trug dem Kanzler auf, diesen Entschluß dem Konnetable zu überbringen. In drei Tagen solle über den Fall zu Gericht gesessen werden.
Am andern Morgen begab sich der Kanzler zum Konnetable. Im Hause de Velascos angelangt, ließ er sich durch einen Bediensteten melden.
Als der Besuch des königlichen Kanzlers dem Konnetable angezeigt wurde, verspürte de Velasco kaum Neugier. Auch die überbürdung des Richteramtes nahm er mit der Beherrschtheit und Selbstverständlichkeit eines Mannes entgegen, der nicht zum erstenmal einen königlichen Auftrag erfährt.
Erst als der Kanzler den Namen des Vaters nannte, an dem sich ein Sohn vergangen hatte, wich das Ruhige merklich aus dem Gesicht de Velascos und das Harte in seinem Antlitz trat um einiges deutlicher hervor.
De Velascos Gedanken, die bis anhin beim Bericht des Kanzlers geweilt hatten, schienen sich mit einemmal an entferntem Ort und in vergangener Zeit zu bewegen. Es fiel dem Kanzler auf, daß der Konnetable seine Zustimmung zum königlichen Auftrag aus tiefer Versonnenheit heraus gab.
Und in diesem Nachsinnen blieb de Velasco auch noch einige Zeit befangen, nachdem ihn der Kanzler wieder verlassen hatte. Dann rief er sich seine richterliche Aufgabe ins Bewußtsein, befahl sein Pferd und ritt zum Untersuchungsgefängnis, in welchem der schuldige Sohn festgehalten wurde.
Don Alvar zählte nicht ganz dreißig Jahre. Er war von schlankem Wuchs, sein Antlitz schmal, und schwarzglänzend sein Haar.
Den Richter überraschte diese Erscheinung des Verklagten. Er war gefaßt gewesen, einen grobknochigen, derben Haudegen anzutreffen. Statt dessen stand ein junger Mann vor ihm, der wohl von sehniger, in Kraft geübter Gestalt war, aber doch schier mädchenhafte Züge an sich hatte. Dieser Umstand erstaunte den Richter: wenn des Vaters Drohung mit dem Stock der einzige Grund zu dem Verbrechen dieses Sohnes gewesen, dann mußte Don Alvar ein jäher Feuerkopf sein, ein verkommener Raufbold war er nicht.
De Velasco hatte schon eine Reihe von Fragen an den Schuldigen gerichet, mehr als seinen Namen, Don Alvar, Graf de
Majo, und den Namen seines Vaters, Graf Ruiz de Turillas, jedoch nicht erfahren. Andern Fragen gegenüber schwieg der Angeklagte sich aus.
Ehe der Richter sich damit abfand, unternahm er einen letzten Versuch, das Vertrauen des Gefangenen zu gewinnen. „Ich kannte einst Eure Mutter, Don Alvar, vor Jahren, als sie noch ein Mädchen war“, sagte de Velasco. .
überraschend war für ihn die Wirkung dieser vertraulichen Mitteilung. Alvar drehte sich erst schroff vom Konnetable ab, dann schwand unversehens seine starre Haltung. Mit gefaßter Stimme sagte er: „Sie ist der einzige Mensch, Konnetable, der mich liebt.“ Aber ihre Liebe sei immer heimlich und traurig gewesen. Wenn sie ihn geküßt, habe sie geweint, und zärtlich sei sie nur zu ihm gewesen, wenn es Don Ruiz nicht sah.
De Velasco hielt den Augenblick für gekommen, eine weitere Frage beantwortet zu hören: „Und Euer Vater, Don Alvar?“ fragte er.
Da trat ein gefährlicher Schatten auf Alvars Stirn, und in seinen Augen entzündete sich ein bedrohlicher Glanz, als er sagte: „Ich habe meinen Vater nie geliebt, weil ich erst spürte und später wußte, daß er mich nicht liebt.“
Der Richter erachtete es für ratsam, die Rede vom Vater ab und auf den Grund zu bringen, der zum Streit mit dem Bruder geführt hatte.
Carlos, der jüngere Bruder, sei seit der Geburt des Vaters Liebling gewesen, sagte der Angeklagte. Ihn habe seit jeher der Vater mit Zärtlichkeiten überschüttet. Ohne auch nur einen einzigen freundlichen Blick zu erhalten, lebte Alvar neben ihm. So wuchs Mißgunst zwischen den beiden Brüdern groß. Alvar galt als gesetzmäßiger Erbe der Güter, worüber sich Carlos aus Neid entrüstete. Der Vater schürte diesen Neid, indem er Alvar Geschick und Fähigkeit zum Verwalten der Güter absprach, Carlos' gute Eigenschaften hingegen bei jeder geringsten Gelegenheit aufs lauteste rühmte. Streitigkeiten zwischen den Brüdern wurden immer häufiger. Und einmal gerieten sie dermaßen heftig aneinander, daß sie zu den Waffen griffen. Die Mutter weinte über dieses Vorkommnis und nannte ihre beiden Söhne Kain und Abel. Die streiterfüllten Tage wiederholten sich, und die Stunden voll kränkender Worte lösten sich ab. Der neuliche Streit auf offener Straße war nur eine wilde Auseinandersetzung unter vielen gewesen. Wieder einmal hatte Carlos mit spitzer Rede, die er trefflich zu führen verstand, Alvars Ehre verletzt. Hierauf verlor Alvar seine Beherrschung, welche zu wahren er sich immer von neuem bemüht hatte, und langte nach dem Degen. Carlos tat dasselbe. Don Ruiz, der zwischen den Söhnen ging, erkannte die Gefahr und wollte einen öffentlichen Kampf verhüten, indem er Alvar mit dem Stock drohte und ihn aufforderte, die Waffe einzustecken. „Was dann geschah, soll mein Verbrechen sein“, schloß der Angeklagte sein Geständnis.
Es fiel de Velasco nach dem Gehörten schwer, seinerseits die Rede aufzunehmen. Er schwieg und ließ sich die Erzählung Alvars wieder und wieder durchs Gedächtnis gehen. „Ihr hattet wenig Freude in Eurer Jugend“, sagte, er endlich.
Der Richter zweifelte indes nicht, daß das Gesetz zugunsten der Ankläger lauten werde, und er wußte, daß dieses Gesetz, nicht bloß wie es in den Büchern stand, auch wie es ungeschrieben in den Herzen des Volkes lebte, die strengste Strafe für den Schuldigen verlangte. Bereits hatte sich der König für das Todesurteil entschieden.
Als de Velasco dem jungen Mann dies eröffnete, blieb Don Alvar gefaßt und unerschrocken. Am Leben, sagte er, hange ihn nicht viel, es sei nicht schön genug gewesen, es zu lieben. Den Richter berührte dieses Geständnis sehr, und er verließ gepreßteren Herzens die Zelle, als er sie betreten hatte.
Er begab sich nach Hause und wollte durch einen Diener den jüngeren Bruder Carlos ins Verhör fordern, als ihm der Besuch des Grafen Ruiz de Turillas angekündet wurde. Hierauf hielt der Richter seinen Befehl zurück und ließ vorerst den Grafen zu sich bitten.
Der Graf hatte etwas Drohendes an sich. Den Richter überkam eine eigentümliche Unsicherheit, die er zu verweisen suchte, indem er als erster das Wort nahm: „Wir sind alt geworden, Don Ruiz, seit wir uns zuletzt gesehen haben“, sagte er zögernd. Der Graf hielt diese Feststellung keiner Antwort würdig. Der Richter merkte, daß er ein Selbstgespräch führte und daß der Graf nicht gesonnen war, den angeschlagenen vertrauten Ton aufzunehmen. Er wies auch die Einladung des Riehters, sich zu setzen, mit einer Handbewegung ab.
Dann endlich begann der Graf zu sprechen. Und der Richter spürte das Drohende auch hjnter seiner stockenden, mühsam verhaltenen Redeweise.
Er erinrlere sich sehr wohl an die Zeit, da sie sich zuletzt gesehen, sagte der der Graf. Es sei wenige Wochen vor seiner Vermählung mit Dolores gewesen, als sich de Velasco mit Kolumbus nach Amerika eingeschifft hatte.
Hier hielt der Graf inne. Es schien, er sammle seine Gedanken, um nun vom eigentlichen Grund seines Herkommens zu reden. Es sei wegen Alvar, wegen des Sohnes, der ihn jüngst auf offener Straße geschlagen. „Ihr seid sein Richter“, sagte der Graf, „Dolores hat mich zu Euch geschickt; damit ich bei Euch für ihn bitte.“
Der Richter hatte diese Erklärungen des Grafen mit einiger Genugtuung vernommen. Sie machten ihm offenbar, daß der Graf als ein Bittender vor ihm stehe. Und diese Einsicht gab ihm einen Teil seiner geschwundenen Sicherheit zurück. Die Antwort an den Grafen fiel sehr bestimmt aus. Er ließ ihn wissen, daß er nicht mächtig genug sei, die Härte des Gesetzes zu lindern. Und das Gesetz verurteile Alvar.
Der Richter fühlte sich innerlich wieder dermaßen gefestigt, daß er gar einen Vorwurf gegen den Grafen zu erheben wagte. „Ihr seid am Vergehen Eures Sohnes nicht ganz schuldlos, Don Ruiz“, sagte er, „Ihr habt Euren älteren Sohn seit seiner frühesten Jugend zurückgestoßen und seine Liebe Zeit seines Lebens verschmäht.“
Auf diese Anschuldigung hin verlor der Graf mit einemmal seine Fassung. Wütend stieß er seinen Degen auf den Boden. „Meinen Sohn?“ rief er, „meinen Sohn, sagt Ihr?“ Er rief es derart laut, daß sich seine. Stimme dabei überschlug.
In angstvoller Beklemmung starrte der Richter den Grafen an. Ein eiskaltes Grauen überlief ihn, als sich die Erbitterung des Grafen in höhnisches Gelächter kehrte.
„Meinen Sohnl wiederholte dieser und fuhr gräßlich spottend fort: bei Gott, es werde ein schönes Schauspiel geben, wenn der Vater den Sohn zum Tod verurteile, weil der Sohn den Gatten der Mutter geschlagen.
Der Graf indes gewahrte den verwirrten Richter vor sich, dem es die Rede verschlagen, und er faßte sich wieder und schickte sich an, seine Andeutungen aufzuklären.
Als vor siebenundzwanzig Jahren Don Inigo de Velasco sich von Dolores de Fuentes trennte, um Kolumbus auf seine Fahrt zu folgen, ließ er Dolores als Mutter zurück. Damit das unglückliche Mädchen nicht in Elend und Schande zugrunde gehe, nahm Don Ruiz de Turillas, der Dolores schon immer nahegestanden war, sie zur Frau. Nur wenige Monate nach der Heirat gebar ihm die Gattin einen Sohn, den er nie liebte, ja, den er haßte. Es war ein fremder Sohn, der den Namen de Turillas trug. „Alvar sollte mein Erbe sein, mein Geschlecht fortpflanzen“, sagte der Graf, „während ihm Carlos, mein einziger Sohn, als der Jüngere nachstehen mußte.“
Nun erst begriff der Richter ganz den Sinn hinter den geheimnisvollen Anspielungen des Grafen. Die Enthüllungen des Grafen brachten Erlösung über den Richter. Der angeschuldigte Sohn war gerettet. Seine Tat war verzeihlich. Es war nicht der Vater, den er geschlagen.
Solcherart waren des Richters vorderste Gedanken, die er dem Grafen nicht verhehlte. Von neuem erzürnte dieser hierauf, wenn auch minder heftig als zum erstenmal: Er habe de Velascos Sohn groß gezogen, und zum Dank dafür wolle nun der Richter das Wappen der Turillas beflecken und die bis zum Tage, wenigstens nach außen hin, rein erhaltene Frauenehre der Gräfin Dolores schänden. „Nein, de Velasco, Ihr müßt schweigen!“ sagte sehr entschieden der Graf.
Entsetzt und verzweifelnd wehrte sich der Richter gegen die Zumutung des Grafen, daß er sein eigenes Kind verurteile. Aber der Graf, der den Richter in seiner früheren heillosen Verwirrung sah, blieb fühllos, kehrte sich vom Richter ab und verließ das Haus.
Es war noch früh am Morgen als die Gräfin bat, zum König geführt zu werden. Der junge König wies ihr den breit ausladenden Sessel an, und sie ließ sich darin nieder und wartete, daß der König die Rede aufnehme.
„Ich kann vermuten, Gräfin, was Sie zu mir führt“, begann der König.
„Es ist die Sache Ihres Sohnes“, sprach der König nach kurzem Zögern, „es ist die Bitte um Milderung des richterlichen Spruches, der über ihn gefällt wird! Ich weiß. Der Graf wollte schon gestern um dessentwillen bei mir vorsprechen. Ich mußte den Grafen abweisen. Seine Bitte verlangt vor mir, daß ich das Recht verletze. Es ist aber mein Amt, Gräfin, das Recht vor der Schwäche der Menschen zu schützen. Der Graf ist ein Mann. Ich mußte von ihm fordern, daß er Verständnis für das Gerechte und Notwendige des harten Richtspruchs zeige. Sie sind eine Frau. Und Sie sind die Mutter des Angeklagten. Ich weiß, Sie haben ein Recht, von mir angehört zu werden, und ich habe die Pflicht, Sie von der Unerbittlichkeit des Gesetzes zu überzeugen.
Ihr Sohn, Gräfin, hat seinen Vater geschlagen“, sagte er, und er wollte auf diese grundlegende Feststellung seine Erklärungen bauen.
Aber die Gräfin verbot der Majestät weiterzusprechen. Sie richtete sich auf. Und mit einer dunklen Stimme sagte sie:
„Nein, Majestät, mein Sohn schlug keinen Vater. Den er schlug, ist einzig mein Gatte.
Ich bin gekommen“, fuhr sie fort, „Ihnen mein Geheimstes offenkundig zu machen, damit Sie der Gnade das Vorrecht geben, Majestät.“
Es war der Art des jungen Königs gemäß, daß nur ungeteilte Wahrheit die Härte seiner buchstäblichen Gesetzestreue zu erweichen vermochte. Da die Gräfin diese Art erkannt hatte, überwand sie alle Angst und Scham und brach ein jahrelanges Verschweigen: „Der Vater, Majestät, ist der Richter meines Sohnes.“
Der König bewahrte bei' dieser Enthüllung eine Ruhe, wie sie ihm noch vor Stunden und Tagen beinahe unerreichbar fern gelegen. Leidenschaftslos forderte er die Gräfin auf, zu enthüllen, was an Verborgenem hinter ihrem Geständnis liege. Sie erwies sich hiezu bereit. Und der König folgte aufmerksam ihrer Erzählung:
„In unserer Jugend waren wir Nachbarskinder, Ruiz, Inigo und ich. Unsere Eltern ließen es gerne zu, daß wir Kinder miteinander spielten.
Mit den Jahren wuchsen meine Gespielen heran zu Jünglingen. Und was einst freundliche Verbundenheit unter Kindern war, wurde zur ersten Liebe zweier junger Männer zu einem jungen Mädchen. Unentschlossen stand ich zwischen zwei Jünglingen, die mich liebten und denen auch ich von Herzen zugetan war. Obwohl ich mich Inigo näher fühlte, gab ich doch den Anschein, als wäre ich beiden gleichermaßen geneigt.
Zur Zeit des Krieges gegen Granada waren die beiden Freunde waffenfähig. Sie gingen zum Heer und zogen in den Kampf. Ich zitterte um beide, betete jedoch öfter für Inigo. Als Granada gefallen, kehrten beide unversehrt heim. Inigo war geschmückt mit Ehrenzeichen und schien mir begehrenswert wie nie zuvor.
Während der Zeit unserer Trennung hatte sich Entscheidendes in uns zugetragen. Bei unserem Wiedersehen trat es zutage. Die Freude des Begegnens nach langem Getrenntsein, meine Sehnsucht nach Liebe, seine lang verhaltene Leidenschaft vereinigten sich in diesen Stunden. Die Liebe war ihren Weg gegangen. Am nächsten Tag wollte Inigo meinen Vater aufsuchen, um dessen Einverständnis zu unserer Heirat, das ihm zum voraus sicher sein konnte, zu erbitten.
Aber am nächsten Tag blieb Inigo aus. Und auch die folgenden Tage kam er nicht. Statt seiner kam Ruiz und brachte Nachricht von ihm. Inigo habe dem
Genuesen Kolumbus seine Mithilfe zur Entdeckungsfahrt zugesagt.
Meine“ Empörung war groß, und meine Verzweiflung nicht minder: eines hergelaufenen Fremden wegen ließ mich Inigo allein, allein in meiner Angst und Bang-nis. Ohne ein Wort der Erklärung war er von mir gegangen. Da schrieb ich ihm und machte ihm Vorwürfe. In meiner Not fand ich harte Worte. Seine Erwiderung aber vermehrte meine Ratlosigkeit noch: er sei geflohen, weil am Morgen nach unserer nächtlichen Gemeinschaft ein großes Entsetzen ihn überfallen habe. Unserer voreiligen Vereinigung könne nie mehr der Segen vergönnt sein, den Mann und Weib nötig hätten, wenn ihrer Verbindung Beständigkeit und wachsendes Glück beschieden sein sollten. Er wolle sein Verbrechen sühnen, indem er nie mehr ein Weib begehre. Er achte sein Leben nicht höher als das eines Verbrechers. Darum werde er es dem Genuesen für seine abenteuerlichen Pläne zur Verfügung stellen, ob diese Entdeckungsfahrt auch eine Reise in den Tod werde. Es war das letzte Zeichen, das ich von ihm erhielt. Auf meine Briefe erwiderte er nicht mehr. Er überließ mich meiner trostlosen Einsamkeit.
Als sich meine dunklen Stunden mit fortschreitender Zeit etwas zu lichten begannen, bemerkte ich, wie Ruiz voll rührenden Mitleids um mich besorgt war. Und da klammerte ich mich in meiner Verlassenheit an ihn. Ich gestand ihm alles. Er redete mir zu, nicht alle Hoffnung fahren zu lassen. Es schien, er liebe mich noch immer sehr.
Eines Tages brächte mir Ruiz die Nachricht, Inigo sei mit Kolumbus abgesegelt zur Todesfahrt, von der er nie mehr zurückkehren würde. Und zugleich bot mir Ruiz seine Hand an. Inigos Liebe mußte mir für immer verloren gelten. Ruiz fühlte ich mich für seinen selbstlosen Beistand in meinen schweren Tagen zu Dank verpflichtet — und ich nahm seine Hand an. Wir heirateten. Und als meine Stunde kam und ich einen Sohn gebar, bekannte Ruiz seine Vaterschaft.“
Hier hatte die Gräfin ihre Erzählung beendet. Nun lag alles Verborgene entdeckt vor dem König, und er konnte sein vorgefaßtes Urteil noch einmal überdenken.
Da der König zu sprechen anhob, erwartete sie das Gnadenwort für ihren Sohn. Jedoch sie mußte eine große Enttäuschung erfahren.
Mit keiner Silbe bekundete der König eine gewandelte Denkart. Einzig im milderen Tonfall seiner Stimme hätte der aufmerksame Hörer eine Veränderung feststellen können, als die Majestät sagte: Die Schuld bleibe bestehen. Der Sohn habe nicht gewußt, daß er keinen Vater schlage.
Mit ihrer Erzählung habe die Gräfin nur verraten, daß auch sie mitschuldig sei. Ihr Stolz habe sie zu falschem Spiel ihrem Sohn gegenüber verleitet. Nun müsse sie mitleiden unter der Strafe, die den schuldigen Sohn treffen werde. Noch auf diesen Tag habe er das Gericht angesetzt. Und de Velasco werde das Richteramt ausüben müssen. Dies sei des Richters Strafteil für seine Mitschuld an diesem allgemeinen Vergehen.
Mit der. Eröffnung dieses Entschlusses entließ der König die Gräfin.
Die Verhandlungen des Gerichts dauerten bis in den frühen Abend hinein. Man hatte Zeugen den Hergang des Verbrechens schildern lassen.
Die Zeugen hatten den Gerichtshof wieder geräumt. Das Urteil zu vernehmen, waren nur der Graf, die Gräfin und der schuldige Sohn anwesend.
Die königliche Majestät hatte befohlen, daß man sie rufe, wenn der Spruch gefällt werde. Und nun war der junge König in Begleitung des greisen Kanzlers gekommen, hatte sich nahe dem Richter niedergelassen.
De Velasco erhob sich. Er schien unter einer großen Müdigkeit stark zu leiden. Seine Stimme klang stockend: „Graf de Majo. Eure Schuld ist bewiesen. Ihr habt einen Granden von Kastilien geschlagen. Vor Gott und seinen Heiligen Sprech ich dieses Urteil über Euch: Frei geht Ihr von hier. Doch Eures Adels und Eurer Würden erklär ich Euch verlustig. Arm und bloß sollt Ihr sein. Und verbannt aus Spanien auf Lebenszeit. Im Namen des Königs.“
Während der Verkündung des Richtspruches hatten sich alle Blicke dem König zugewandt. Und nun hafteten sie auf seinem Antlitz, hafteten an seinem Mund und an seinen Augen.
In fast geheimnisvoll anmutender Gelassenheit erhob sich der junge König und ließ seinen Blick von einem der Anwesenden zum andern gleiten.
Es sei ein Urteil im Namen des Königs gesprochen worden, sagte die Majestät, ein Urteil wider jegliches Recht und Gesetz, ein falsches Urteil, das den königlichen Namen zu Unrecht trage. Ein Mann habe dieses Urteil verfaßt, dessen unbeugsame Gerechtigkeit in hohem Rufe gestanden sei. Aber der Richter verdiene dieses Vertrauen, das ihm der König entgegengebracht habe, nicht. Denn der Richter habe offenbar nicht nach den klar und deutlich vorliegenden Beweisen geurteilt, sondern gemäß einem verheimlichten Wissen um unsichtbare Hintergründe und Zusammenhänge. Ein Richter, sprach der König, dürfe nur nach den offen zutage liegenden Beweisstücken urteilen. Ja, er könne wohl nicht anders. Wenn er außerdem im Stande eines geheimen Wissens wäre, so müßte er solches im Gericht aufdecken, damit keine Zweifel über die Richtigkeit und Gerechtigkeit seines Urteils groß werden könnten. Der Richter habe dies unterlassen und ein unverständliches Urteil mit dem Namen der Majestät verbunden. Der König wäre verpflichtet, seinen Namen hievon zurückzuziehen und dem Richtspruch keine Gültigkeit zuzuerkennen. Der König habe aber gute Gründe, dies nicht luii und dem Urteil durch seinen Namen Wirkkraft zu verleihen. Nichts wolle er vom gefällten Spruch wegnehmen, hingegen füge er noch einiges an:
„Euch, Konnetable de Velasco, entziehe ich den Richterstab für dauernde Zeit.“ Und wie von starker Hand geschoben, bewegte sich der Richter von seinem Platz und blieb gebeugt beiseite stehen.
Da wandte sich die Majestät an den Grafen de Turillas: „Euer älterer Sohn, Graf, hat Adel und Würden verloren. Es hindert nichts mehr Euern Jüngern Sohn, daß er Euch in Rang und Namen folge und Euer einziger Erbe sei.“ Der alte Graf verneigte sich.
Und der König richtete sich an den Verklagten und sprach? „Euch, Don Alvar, hat der Richtspruch alles genommen. Arm und nackt seid Ihr aus Spanien verjagt. Ihr zeiget Euch geschickt im Gebrauche des Degens. Scharfe und kühne Klingen sind in meinem Dienst willkommen. Der Feind droht im Norden und Süden. Ihr sollt als Hauptmann in meinem Heere dienen.“
Hierauf kehrte sich der König abermals an de Velasco und sagte: „Konnetable, durch Euer Urteil habt Ihr dem Angeklagten Adel und Würden abgesprochen. Und seinen Vater habt Ihr ihm genommen und seine Mutter auf Lebenszeit. Beide sollt Ihr ihm ersetzen. Ich befehle Euch: Euren Namen sollt Ihr ihm geben und Euren eigenen Adel. Zu Eurem Sohn sollt Ihr ihn annehmen und mit ihm mir folgen nach Deutschland. Dort warten auf uns viele Geschäfte. Denn —“ Hier unterbrach sich der König, streckte seine Rechte gegen den Kanzler aus und erbat sich schweigend die Schrift, die dieser in Händen hielt. Der König entfaltete das Schreiben und fuhr fort: „Heute ist mir die Botschaft überkommen, daß mich die Kurfürsten von Frankfurt zum Kaiser erkoren haben. Als solcher werde ich der fünfte meines Namens sein.“
Da erhoben sich alle und verneigten sich tief, die als erste diese Nachricht vernommen, und verharrten auch in dieser stummen Ehrbezeigung, als der Kaiser schloß: „Königliche Gerechtigkeit ist zu wenig. Am Anfang meines kaiserlichen Herrschens soll mehr als die Gerechtigkeit stehen. Denn ich weiß nun, daß Gerechtigkeit allein dem Menschen und der Fülle des Lebens nicht gerecht zu werden vermag, es sei denn, sie eine' sich mit der Liebe. Gott hat es wunderbar gefügt, daß mein erstes Kaiserwort gesegnet und daß mein Kaisertum von Anbeginn kein gnadenloses sei.“ Hierauf stand der Kaiser eine Weile schweigend und verließ dann ruhigen Schrittes den Saal, einzig gefolgt vom greisen Kanzler. (Mit Bewilligung des Autors aus der Novelle „Das Gericht“, erschienen im Pflugverlag Thal, St. Gallen)