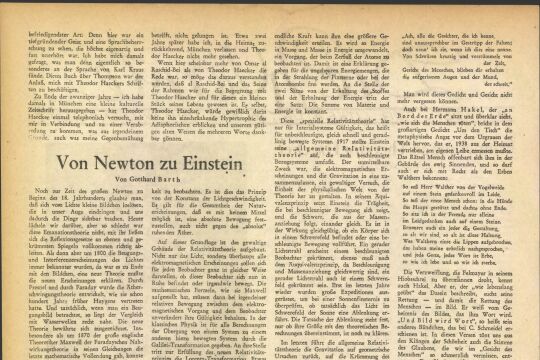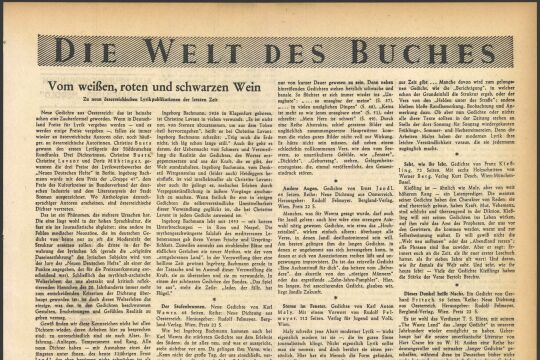Christine Lavant Preis 2023 geht an Yevgeniy Breyger
Am 8. Oktober wurde Yevgeniy Breyger mit dem diesjährigen Christine Lavant Preis ausgezeichnet. Er bedankte sich mit folgender Rede.
Am 8. Oktober wurde Yevgeniy Breyger mit dem diesjährigen Christine Lavant Preis ausgezeichnet. Er bedankte sich mit folgender Rede.
Weil die Welt unfair ist, grausam und komplex – versuchen wir, Gegengewichte zu setzen. Lebensaufgaben gewinnen Konturen, ein Kampf will geführt werden, für Klarheit, für Aufmerksamkeit, für die Schönheit der Wahrhaftigkeit. Es ist ein politischer Kampf. Jemand führt ihn mit der Gesellschaft, jemand mit der Sprache, jemand mit sich. Autor(in) scheitert, fällt, putzt Fell und Federn und steht, so hoffen wir, von neuem auf, mit neuer Kraft, neuen Mitteln.
Alle Kunst ist Widerstand, alle Poesie politisch. Stimmt das? Ist es nicht eher so, dass ein Gedicht zumeist Ausdruck innerer Bewegungen zu sein vermag, ohne selbst die wundersame Wandlung von Sprache zu Energie zu vollziehen? Ohne Ambition. Und dann gibt es jene Gedichte, die lediglich Gebilde sind, Imitationen anderer Gedichte, Schatten von Formen von Bewegungen, anstandslos, faul. Gedichte, deren Strukturen Gitter sind, opake Prismen ohne Mut zur Opazität. Es ist langweilig in der Poesie, es ist stumpf in der Poesie. Doch ja, einige sind aufgestanden, putzten Federn und Fell und begeben sich in Arbeit, harte Arbeit.
Gedicht muss Widerstand sein
Dort, wo ein Gedicht die Notwendigkeit erkennt, nicht bloß Spiegel der Gesellschaft zu sein, verzaubertes Kästchen, Trillerpfeife, Gummihandschuh zum Einmalnutzen und weg damit, sondern sich aufmacht, die Zusammensetzung der Welt zu verstehen, übertritt seine Substanz die Grenze von Gas zu Flüssigkeit, es gerinnt und gerät in – reale – Bewegung. Es wird also lebenstüchtig, lebendig. Es ist keine Kunst, Text zu einem Körper zu formen. Kunst ist, diesen Körper zu erfüllen und ihn auf eine Reise zu schicken gegen Empathielosigkeit, gegen Dummheit, gegen Gewalt, stellvertretend für sich selbst immer und immer, verletzlich als Text, Rüstung und zugleich als Gefährt. Nur einmal vorgestellt, Christine Lavant sitzt an folgendem Gedicht. Sie ist außer sich, durchfahren von allen guten und bösen Geistern, im Wortsinn durchgeistert.
UM MITTERNACHT habe ich Sterne zerkaut,
es war bei der Rast an dem Milchstraßenrand,
die Mondtulpe blühte aus meinem Verstand,
doch eine Nonne hat höher geschaut
mit beiden Hälften der Sonne.
Ich grub nach dem Herzen der Nonne,
ich wollte es essen und fand einen Pfeil,
ließ ab von der Rast, doch der Aufstieg war steil
und belastet von Tulpe und Waffe.
Ich sagte zum Pfeil: „Nun beschaffe
aus meinem Blut dir den Bogen und flieg,
ich überlasse dort oben den Sieg
dir gänzlich allein, in der Mitte des Herrn,
nur diesen einen gar heilsamen Stern,
den abgesparten vom hungrigen Mund,
den nimm mit hinauf, doch erhalt ihn gesund,
du darfst ihn mir ja nicht durchbohren …“
Dann hab ich die Tulpe verloren
und die Milchstraße war wieder oben und fern.
Das Türkenstroh rauschte, ich schlief nimmer ein,
doch sah ich noch immer den dankbaren Schein
von dem heimgekommenen Stern.
(Aus: „Spindel im Mond“, Christine Lavant, Otto Müller, 1959)
Durchgeistert, rhizomatisch durchzogen von Materie, dabei aber einer strikten Denkbewegung folgend – Außen zu Innen. Von Sternen zum Milchstraßenrand, zu Sonne, Mond und Nonne. Schließlich zum Kern, zum Herzen der Nonne, der gegessen sein will und selbst dem Kern weist Lavant eine Essenz zu – die Waffe Pfeil. Ist die Essenz erst benannt, folgt solgleich das Gespräch mit ihr: Die Aufforderung an den Pfeil, aus eigenem Blut einen Bogen zu formen und zu treffen, zu siegen gegen die Sterne, nur den einen zu verschonen – und das ist fraglos von größter Wichtigkeit – den vom hungrigen Mund abgesparten. Ebenjener Stern scheint am Ende dankbar zurück, denn er ist heimgekommen. Es geht im Gedicht nicht um Katholizismus, es geht um keine geistige Armut, es geht um Hunger, weltlichen Hunger, weltliches Leid. Sie sei „in ihrer Existenz durch sich selbst gepeinigt und in ihrem christlich-katholischen Glauben zerstört und verraten“, schreibt Thomas Bernhard im Nachwort zu seiner Lavant-Gedichtauswahl, erschienen in der Bibliothek Suhrkamp. Das Gedicht droht dem Gott, da oben kann siegen wer will, aber das wahre Leben findet statt, wo gehungert wird. Deswegen vielleicht haften die aus dem Verstand blühende Mondtulpe und der hungrige Mund nicht im Gedächtnis, sondern im Knochenmark. Und das, obwohl Christine Lavant nichts egaler sein könnte als das Finden der eingängigen, schönen Wendung. Sie findet sie dennoch, bricht sie und verleiht ihr Autonomie, lässt sie frei, wie man nur etwas freilassen kann, was man ungeheuer, ehrlich, aufrichtig liebt und macht es dadurch liebenswert. Nicht auf dem einfachen Weg, bei dem ein Gedanke dem anderen folgt und ein Wort das nächste vorwegnimmt. Auf dem verschlungenen, holprigen, dessen Fortgang sie mit jedem Schritt erst konstituieren muss, einem eigenen Weg.
Sicher ist – Gedicht muss Widerstand sein, widerspenstig gegen eine Macht, die darauf einwirkt, die Macht kann dabei Gott sein, Gesellschaft, ein Freund, ein Feind, das eig’ne Aug’ im Spiegel, der eigene Mund, wie das Wort, das diesen verlässt. Wir leben in einer Welt, in der Mut und Widerstand viele Gesichter haben, ebenso viele haben der Opportunismus und die Feigheit. Von Zeit zu Zeit werden wir nicht umhinkommen, Gedichte zu lesen, wie diejenigen von Christine Lavant, die den Mut aufbringen, gegen alles anzukämpfen, woran die Dichterin glauben will.
Mit dem Panzer im Herzen
Wenn ich mir also immer und immer die eine leidige Frage stelle, die sich mir in die Eingeweide gebrannt hat: „Was ist meine innerste Wahrheit?“ und damit: „Was ist die innere Wahrheit des Gedichts?“, kann ich heute nur eine unzufriedenstellende Antwort geben – Die innere Wahrheit des Gedichts, meine innerste Wahrheit ist der Kampf meiner besten, meiner zartesten Teile gegen meine schlimmsten, gröbsten. Und da sich die einen wie die anderen in der Gesellschaft spiegeln, soll gelernt sein – das ist durchaus ein politischer Kampf und es geht darin um das Überleben, im Kleinen wie im Großen, im Individuellen wie im Sozialen. Ich habe keine Antwort darauf, ob der Kampf auf einer Straßenbarrikade beginnen muss oder allein vor dem Spiegel nach einer durchwachten Nacht. Ich weiß lediglich, es besteht bloß dann Aussicht auf Hoffnung, wenn er zugleich geführt wird mit dem Panzer im Herzen der Nonne und mit dem Herzen der Nonne im Turm des Panzers. Nicht umsonst verschmelzen Welt und Geist im Weltgeist und in der Geisterwelt von Christine Lavant. Ich kann Ihnen heute keine zufriedenstellende Antwort geben, aber Sie wissen ja, der Zustimmung folgt kein Denken, Zustimmung ist das Ende der Kunst, Zustimmung ist Tod, Widerstand ist Leben.
Versprechen Sie es mir auch, denn ich verspreche Ihnen, ich werde bis zum letzten Atemzug kämpfen, für die Sache, für Sie und für mich. Am Ende des Kampfs steht für alle zwar Dunkelheit, aber was ist Dunkelheit anderes als ein unendlicher Raum für den Einfall von Licht?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!