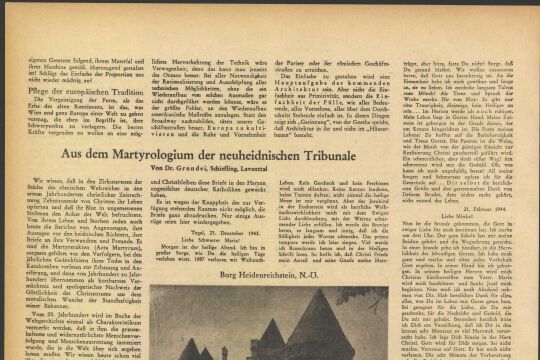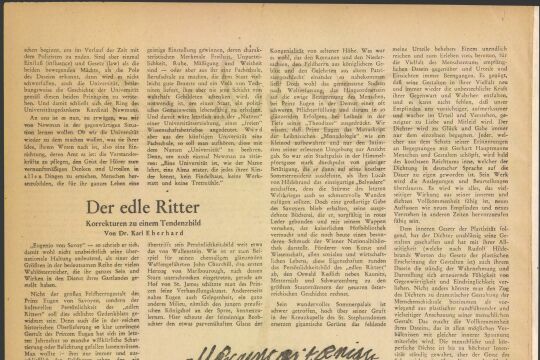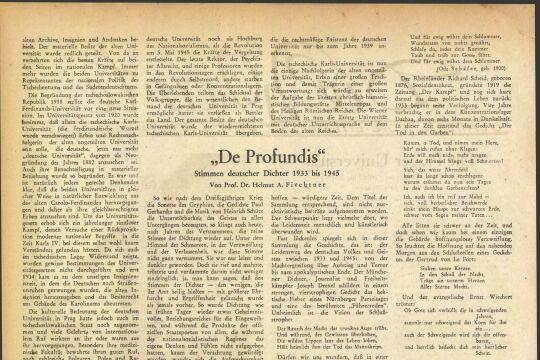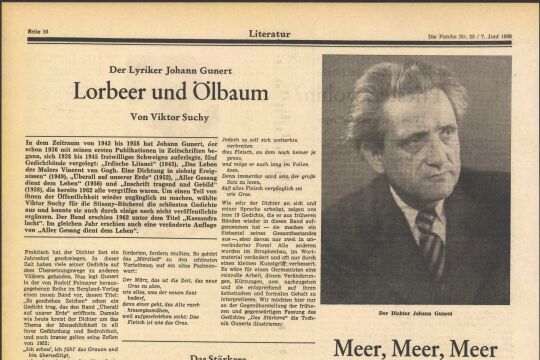Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Lyrische Anthropologie
Es wäre einmal aufschlußreich, eine Geistesgeschichte der Gedankenlyrik zu schreiben. Dem aufmerksamen Beobachter der Schaffensprozesse seit dem Ende des Idealismus dürfte es nicht entgangen sein, daß ein großer Teil der wesentlichen Aussagen nicht von der Philosophie gemacht wurde, sondern von der philosophischen Dichtung.
Im Verlage Erwin Müller sind nun in kurzen Abständen drei Versbücher erschienen, die besonders die Frage nach dem Wesen des Menschen stellen. Zwei — Rudolf Felmayers „Gesicht des Menschen” und Hermann’ Hakels „An Bord der Erde”, tun dies ausschließlich, in Emst Schönwieses „Ausfahrt und Wiederkehr” ist die Frage eingeschlossen.
Rudolf Felmayer, der Julius-Reich- Preisträger des Jahres 1935, der heute Fünfzigjährige, versucht nicht mehr und nicht weniger als eine Anthropologie im Gedicht zu erstellen. Er und, wie wir später sehen werden, auch Hakel nehmen damit eine Thematik wieder auf, die aus der Sozialethik Theodor Kramers in der Lyrik schon bekannt ist. Es ist die Schau des entrechteten, zum Maschinenbestandteil gewordenen Menschen, dessen Dasein scheinbar sinnlos geworden ist. Indem Felmayer das Leben in dieser Zeit realistisch bis zur Mitleidlosigkeit schildert, sucht er hinter all den verlarvten Existenzen seiner Umwelt, den „Masken des Man”, um einen Ausdruck Heideggers zu gebrauchen, das wahre „Gesicht des Mensche n”. Denn diese Zeit ist ihm — gleich vielen anderen — zur „unvorstellbaren Zeit” geworden, deren „Rinde birst” und deren Boden „eine Haut nur war”. Der neue Weltentag wird ihm zum Weltgericht des Menschen. Es ist die Zeit der entgeisteten Lemuren, der frei gewordenen Dämonen der Unterwelt, die den Menschen zur Gliederpuppe gemacht haben und ihn an den zuckenden Drähten seiner entfesselten Triebe regieren, den reduzierten Menschen, das Reflexbündel einer materialistisch determinierten Welt ohne Seele. Höllenvisionen Dantes bedrängen den Dichter, der in dieser vom Grauen erfüllten Zeit, die wir alle erlebt haben, fast selbst sein Herz verlor. „Sucht ihr mein Herz in meinen fremden Zügen?” so klagt er in einem seiner Selbstbildnisse. Selbst der’Tod ward ihm „wie Wasser, farblos, ungestalt.. Die Existenz des Menschen ist in Gefahr! Diese Erkenntnis prägt die Dichtungen Rudolf Felmayers. Und wie sich Heideggers pessimistische Existentialphilosophie folgerichtig mit der östlichen Philosophie trifft, so wandelt auch der Geist unseres Dichters zurück in die uralten Kulturen des Ostens, um dort Heilung für che wunde abendländische Seele zu suchen. Ein altsumerischer Statuenkopf wird ihm zum Symbol des menschlichen Antlitzes jener Zeit:
„Ach, alle die Gesichter, die ich kenne, sind unaussprechbar im Gestrüpp der Falten; doch nenn’ ich sie, wenn ich dies eine nenne. Von Schwären krustig und verstümmelt von der Zeit, Gesicht des Menschen, blieben dir erhalten die aufgerissnen Augen und der Mund, der schreit.”
Man wird dieses Gedicht und Gesicht nicht mehr vergessen können.
Auch bei Hermann Hakel, der „a n Bord derErde” sitzt und überklar sieht, „wie sich die Menschen töten”, bricht in dem großartigen Gedicht „Um den Tisch” die metaphysische Angst vor dem Urgrauen der Welt hervor, das er, 1938 aus der Heimat vertrieben, am eigenen Leibe ermessen mußte. Das Rätsel Mensch offenbart sich ihm in der Gebärde des ewig Sinnenden, und so darf auch er sich mit Recht als den Erben Walthers bekennen:
So saß Herr Walther von der Vogelweide auf einem Stein gedankenvoll im Leide.
So saß der erste Mensch schon: in die Hände das Haupt gestützt und dachte ohne Ende.
So sitz ich in der Fremde nur alleine im Leidgedanken auch auf einem Steine. Erneuert auch ein jeder die Gestaltung, so alt wir sind, so alt ist diese Haltung.
Was Walthern einst die Lippen aufgebrochen, das haben meine tröstlich nachgesprochen, ‘ und jede Geste, jedes Wort ist Erbe, so wie ich lebe und so wie ich sterbe.
Die Verzweiflung, die Felmayer in seinem Hiobsschrei zu übermännen droht, kennt auch Hakel. Aber er, der „wie lebenslang geübt” das Dasein beschreibt, sucht seine Rettung — und damit die Rettung des Menschen — im Bild. Er weiß vom Geheimnis des Bildes, das ihm Won wird. „Und Bild wird Wort”, so heißt sein anderes Bändchen, das bei C. Schmeidel erschienen ist. In diesen Versen tönt uns aus den Klängen der Schönheit auch die Stimme des Glaubens, die wir im „Gesicht des Menschen” so schmerzlich vermissen, entgegen: „Der Glaube weiß, was keiner noch gedacht.” Vielleicht hat Hakel unserer glaubenslosen und zweifelvollen Zeit mit dieser Zeile die tiefste menschliche Weisheit gegeben.
Nimmt man nun die zuchtvollen und formschönen Verse Ernst Schönwieses — „A usfahrt und Wiederkehr” — zur Hand, so will es einem fast scheinen, daß sie zu glatt, zu schön sind gegenüber den leidschweren Aussagen Felmayers und Hakels, die darum nicht der Gesetzlichkeit der Sprachkunst widersprechen. Man fragt aber unwillkürlich nach dem Menschenbild und der geistigen Haltung, die hinter den Versen Schönwieses stehen. Zweifellos ein solches des Ebenmaßes und der aristokratischen Haltung. Ein Pantheismus erscheint hier in vielen verschiedenen Masken und regiert diese Gedanken, und die entsagungsvolle Trauer einer klassischen Humanitas nährt den „amor fati” dieses Dichters. Eine Schönheit, die uns fast wie eine Flucht vor der harten Wirklichkeit anmutet, in der es wahrlich nichts mehr zu rühmen gibt. Denn der Mensch erscheint uns, dies beweisen diese jüngsten lyrischen Dichtungen aus Österreich, heute zwisdien Rühmung und Klage gestellt, zwischen Hoffnung und Verzweiflung in der Immanenz der Welt. Das Menschenbild, das seinerzeit Kramer und heute im verstärkten Maße Felmayer vor unsere Augen hinstellt, damit wir endlich unserer Verantwortung inne würden, ist ein tief pessimistisches. Ist es aber auch richtig? Es ist — wie Felmayers ganzer Gedichtband, der zu den bedeutendsten dichterischen Aussagen unserer Gegenwart gehört — symptomatisch für eine Zeit, die in ihrer angemaßten Autonomie vergessen hat, daß der Mensch sich nicht selbst konstituiert, sondern in der Ebenbildlichkeit Gottes. Dieses leidvolle Gesicht, dessen Züge uns so realistisch gezeichnet werden, trug der unerlöste Mensch. Diese Züge wird die arme Kreatur tragen müssen, solange sie gleich einem gefangenen Tier im selbsterbauten Gefängnis der Weltimmanenz ohnmächtig an die Mauern rennt.
Weder die Flucht nach dem Osten zu den leidlosen stillen Göttern noch die Flucht in die reine Gestalt vermögen das heile Wesen des Menschen wiederherzustellen. Dem Gesicht des Menschen dieser unvorstellbaren Zeit möchten wir daher ein anderes Gedicht als Spiegel entgegenhalten, das Suso Waldeck tief ergriffen geschaut hat:
„Antlitz, trunken vor Schmerz in die Schulter geneigt unter dem Kranz, der blutiges Haar durchzweigt, didi laß midi grüßen, dir singen weh und zart, laß midi sinken in deine Gegenwart.”
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!