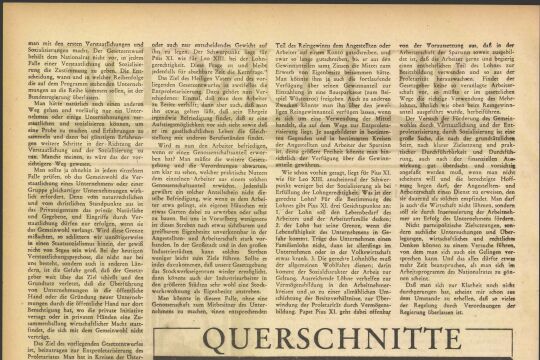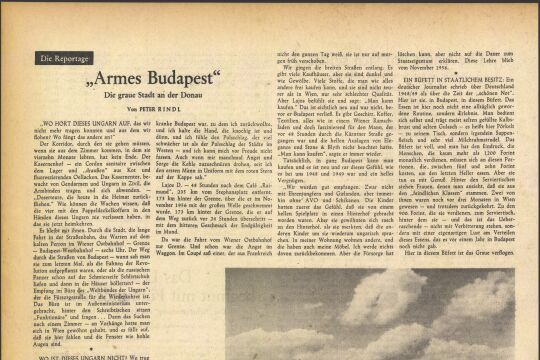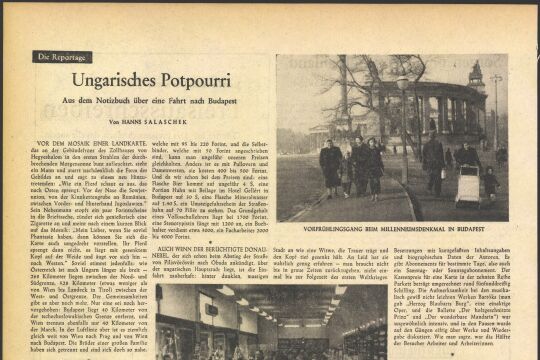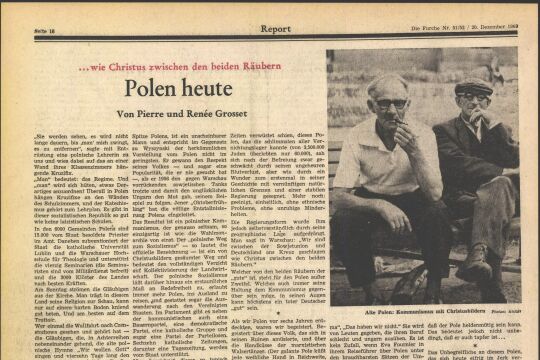Zahlreich waren die Verbindungen zwischen Wien und der Ukraine. Der Wiener jüdische Chor war auf Spurensuche in Lemberg und Czernowitz.
Galizien war immer Treffpunkt der Kulturen. Die ersten Juden kamen im 13. Jahrhundert, später erreichten viele Armenier unsere Stadt, die von der Halbinsel Krim vor den Türken flohen, und dann ganz viele Italiener. In Lemberg waren vor dem Zweiten Weltkrieg dreißig Prozent der Bevölkerung jüdisch." Die Universitätslektorin Larissa Cimbenko schwenkt bei der Führung durch die Altstadt des ukrainischen Lviv (auf deutsch Lemberg) mit den dekorativen Häusern im florentinischen Stil ihre Sonnenbrille, um einzelne Sätze zu unterstreichen. "Die Armenier teilten ein ähnliches Schicksal wie die Juden. Sie wurden immer verfolgt." Eine beharrliche Roma-Frau mit einem stämmigen, tief schlafenden Baby in hellblauem Strampelanzug und weißem Mützchen auf dem Arm verfolgt die Reisegruppe des Wiener Jüdischen Chors bettelnd quer durch die Stadt. "Da, das ist doch das gleiche Baby - bei dem Mädchen vor der armenischen Kirche", behauptet jemand. "Ja genau, und du glaubst wohl, die bleiben lieber so arm, damit sie immer weiter betteln können", lacht Tom Soxberger, Tenor des Chors. Die Heiligenbilder in der armenischen Kirche haben schwarze Gesichter.
Lembergs Synagogen
Der Wiener Jüdische Chor besucht auf einer Konzertreise die Ukraine, Moldawien und Rumänien. Für Lemberg sind nur ein paar Stunden eingeplant. Der Fluss durch die Altstadt verläuft heute unterirdisch, denn einige österreichische Baumeister "überwölbten den Fluss, der die Wasserscheide zwischen Schwarzem Meer und Ostsee darstellte" (Cimbenko).
Franz Xaver Mozart, Chor- und Musikakademiebegründer in Lemberg und der Sohn von Wolfgang, schrieb über das Städtchen: "Hier kann man klaustrophobisch werden." Nach Rede-Exkursen über polonisierte Namen (Larissa Cimbenko ist eindeutig Fan der deutschen Sprache) und die "Mentalitätsänderung" durch die orangene Revolution nähert sich die Gruppe an allen möglichen Kirchen verschiedener Konfessionen vorbei endlich dem altjüdischen Viertel. "Hier auf dem leeren Steinplatten-Platz stand die große Stadtsynagoge, nur zwei Durchgänge sind von ihr geblieben. Daneben gab es eine zweite Synagoge, die "Goldene Rose" genannt wurde, der Legende nach die Tochter des Rabbis, die das Grundstück den Jesuiten wegschnappte. Die Nazis zerstörten schon in der ersten Woche beide Synagogen. Zwischen 1941 und 44 wurden alle galizischen Juden auf immer vernichtet, hinter der Eisenbahnbrücke war das Ghetto", erklärt Larissa Cimbenko. "Viele suchen hier wirklich nur die Spuren der galizischen Juden. Später kamen nur noch russisch sprechende Juden nach Lemberg." Inzwischen sind nur mehr 0,6 Prozent der Bevölkerung jüdisch. Der Rabbi kommt aus den usa und ist vierzig Jahre alt. Er legt gerade Protest bei der Stadtverwaltung ein, weil auf dem alten Friedhof ein Bauernmarkt abgehalten wird.
Die Spuren der Großmutter
"Ich will sehen, dass dort nichts mehr ist. Ich will es einfach nur sehen", ruft die Wienerin Miriam, die schon zu Hause die Stadtpläne von Lemberg studiert hat und eifrig die übriggebliebenen Steine der Synagogen in der Sonne fotografiert. Dann läuft sie in ihren Schlapfen der davoneilenden Gruppe hinterher. Der letzte Brief der Tante und des Großvaters (die Großmutter starb bereits 1939) an Miriams Mann Theo Lieder und seine Familie stammt von hier. In diesem Brief schrieb die Tante noch: "Du könntest dir nicht vorstellen, wie schnell sich der Vater verstecken kann." Berisch Lieder, Arciszenskiego 8/4/55, Levow, ist die letzte Wohnadresse, von der die beiden ausgehen. "Schwierig zu finden war es nur deswegen, weil die Straßen immer ihren Namen geändert hatten. Einmal war der Name deutsch, dann polnisch und jetzt auch russisch. Von da kam unser Problem", erklärt Miriam. "Wohin wurden der Großvater und die Tante deportiert? Sie sind von der Bildfläche verschwunden. D.h. niemand weiß etwas - nie mehr hat man ihre Namen irgendwo gefunden. Wir nehmen daher an, wie es in dieser Gegend üblich war, dass sie einfach in einer Grube gelandet sind, in einem Massengrab, wo man die Leute hineingeschossen hat, nachdem sie sich ihr Grab selbst schaufeln durften. Die Massenvernichtung in den Konzentrationslagern ist erst später so richtig in Gang gekommen. Wo die Leute nicht mehr registriert wurden, sondern gleich vergast und daher auf keinen Listen zu finden sind. Meine Theorie geht auf gleich erschlagen oder erschossen oder so ähnlich. Fantasie hatten diese Mörder ja genug." Sie fotografiert im Haus die Ausbuchtungen auf der Steintreppe ("Da ist sicher schon Theos Opa gelaufen") und die dunkelblauen metallenen Briefkästen, die eventuell schon damals vorhanden waren. Ihr Mann unterhält sich derweil mit allen Leuten über achtzig Jahren, die er vor und in dem Haus finden kann.
Die nationale Frage ...
Der Historiker Sergij Osatschuk spricht ein lustiges Deutsch. "Können Sie rechts biegen?", sagt er zum Busfahrer Karli, der den Wiener Jüdischen Chor praktisch Tag und Nacht herumkutschiert. "Bitte, biegen Sie." Karli biegt und hält vor dem jüdischen Nationalhaus. Heute leben um die 1.300 Juden in Czernowitz (Chernivtsi), 14.000 sind in den letzten 15 Jahren, großteils auf Arbeitssuche, ausgewandert. Die Stadt Czernowitz war um die Jahrhundertwende eine deutsch sprechende Metropole. Die Nationalitätenpolitik in der Bukowina galt als sehr liberal. "Niemand konnte sagen, ich bin hier die wichtigste Nation. In der ethnischen Kulturenkommunikation konnte keine Gruppe dominieren. Es gab einen gewissen Zwang zum Kompromiss zwischen den Polen, Ruthenen, Rumänen, Juden und Deutschen. Man hat sich ertragen", analysiert Osatschuk.
... und die Juden
Nach dem Ersten Weltkrieg umfasste die jüdische Gemeinde 40.000 Mitglieder. Es gab verschiedene politische Gruppierungen. Beim Ersten Weltkongress für Jiddisch 1908, einer Sprachkonferenz, die der Wiener Schriftsteller Nathan Birnbaum einberief, verschloss eine Gruppierung die Türen vor der anderen. Die eine, die nicht assimilatorisch eingestellt war, trat für die Anerkennung des Jiddischen als Sprache ein, eine andere trat gegen alles Nationale auf.
"Später wollte man alle Hinweise auf das Nationale aus dem Nationalhaus raus haben, in der Sowjetzeit sägte man sogar den Davidsternen im Treppenhaus zwei Zacken weg", sagt der blonde Osatschuk - der mit seinem Haarschnitt wie das Klischeebild eines Deutschen aussieht - und zeigt das Treppenhaus her. Einen Stern hat man als Beispiel in der seltsamen viereckigen Form belassen. Den anderen wurden Mitte der 90er Jahre die fehlenden Zacken wieder angeschweißt. "Inzwischen gibt es wieder nationale jüdische Vereine und auch Davidsterne. Die Vereinsmeierei war damals überhaupt sehr groß. Im Jahr 1913 gab es 1.340 jüdische Vereine. Es gab sogar einen Verein zur Bekämpfung der Sklaverei in Afrika!", schmunzelt Osatschuk. Auf dem Weg zum Friedhof weist er auf die Straßenlaternen hin, an deren Dekoration ebenfalls manipuliert wurde: Die Zacken der ehemals rot leuchtenden Sterne wurden ebenfalls abgesägt. "Die Sägemeister sind nach wie vor am Werk", sagt er. "So wird Geschichte geschrieben", kommentiert ein weibliches Chormitglied. Vor kurzem hat man eine vergrabene Maria Theresien-Statue in der Erde entdeckt. Die Denkmäler wechselten ständig, kein einziges altes Denkmal blieb. "Die Leute können nicht glauben, dass die Denkmäler so schnell verschwinden - genauso wie die Monarchie, das faschistische Großrumänien oder die Sowjetunion", sagt der etwa dreißigjährige Osatschuk und klingt, als ob er von einem entfernten Planeten aus die Erde betrachtet. Dann steigt der Herr Doktor in seinen bmw und braust davon.
Denkmäler retten
Rumänien war Verbündeter des Dritten Reiches und die Bukowina bis Odessa besetzt. 50.000 Juden wurden in Czernowitz in das Ghetto eingesperrt. Nach zwei Monaten wurden 35.000 in Arbeitslager nach Transnistrien verbannt. Dort gab es keine Konzentrationslager, aber auf dem freien Feld kaum eine Möglichkeit zu überleben. 15.000 jüdische Menschen durften bleiben, weil sonst das öffentliche und geschäftliche Leben zusammengebrochen wäre. Heute gibt es eine Wiener Initiative, um die Totenhalle am mit Brennnesseln überwucherten Friedhof zu renovieren. Die us-Organisation Or Avner hat das Haus des chassidischen Wunderrabbis von Sada Gora für 49 Jahre gepachtet, um es wiederherzustellen. Die Eltern der Schriftstellerin Rose Ausländer lebten da. Beim Konzert des Chors und der Wiener Klezmer Band "Scholem Alejchem" im vollen Theatersaal in der Schepetivska Straße übergibt ein dicker Opa im karierten Hemd einen weißen Korb mit roten Rosen. Er erzählt, wie er Wien vor sechzig Jahren im April von den Nationalsozialisten befreit hat. Der Herr bewahrte auch einige architektonische Wiener Sehenswürdigkeiten vor der Sprengung. Die Nazis hatten Minen hinterlassen.
Die Autorin ist freie Journalistin in Wien.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!