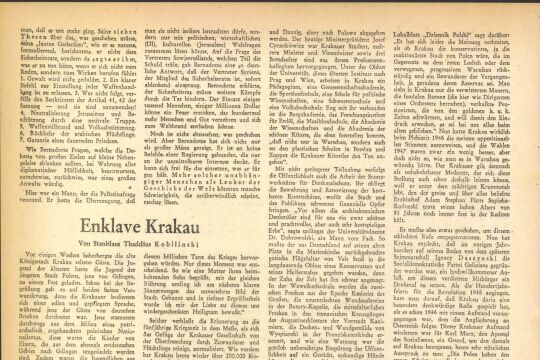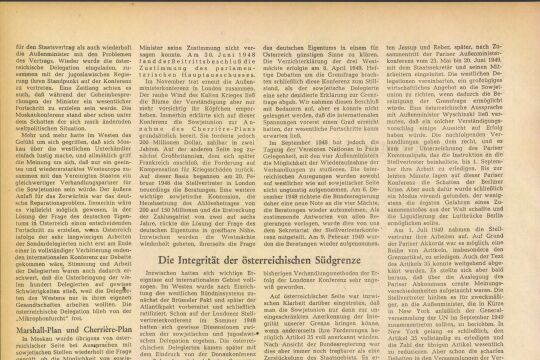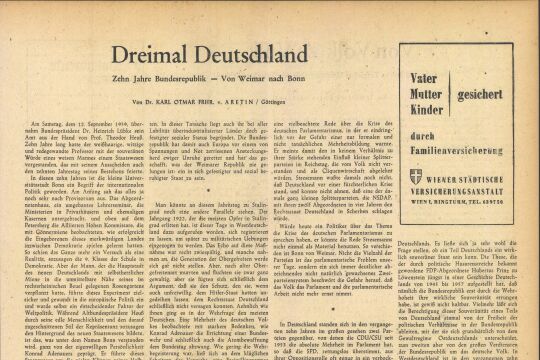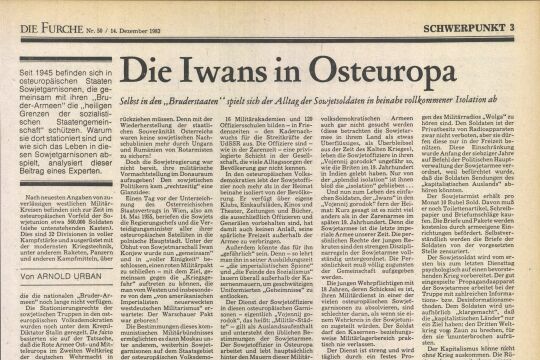Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Erst die Truppe, dann das Volk?
Über die Frage, wer eigentlich daran schuld sei, daß sich heute beide Teile Deutschlands mit einer Armee gegenüberstehen, gehen die Ansichten auseinander. Während man in Bonn behauptet, der Aufbau der kasernierten Volkspolizei habe Westdeutschland dazu gezwungen, auf seine Sicherheit bedacht zu sein, hat man im Osten eine andere Version. Dort wird behauptet, und diese Behauptung wird auch von Amerikanern nicht ernstlich bestritten, mit der amerikanischen Garantie der westdeutschen Grenzen 1949 sei eine Wiederbewaffnung Westdeutschlands unvermeidlich gewesen, die auch viel früher, als offiziell zugegeben, begonnen habe. Dabei übersieht der Osten geflissentlich, daß drüben sehr viel rascher als herüben kampfkräftige Divisionen standen. Der Streit ist müßig, denn von der anfangs auf beiden Seiten gebrachten Version, die bewaffnete Streitmacht sei nur ein leider notwendiges Übel, hat man inzwischen auf beiden Seiten aufgehört zu argumentieren. Sie sind auf beiden Seiten ein wesentlicher Bestandteil des Staates geworden. Ja, im Westen gibt es sogar einige, wie den FDP-Abgeordneten Hubertus Prinz zu Löwenstein oder den äußerst rechts stehenden CDU-Ideologen Winfried Martini, die behaupten, die westdeutsche Bundesrepublik sei sozusagen erst richtig souverän geworden, seit sie wieder Soldaten besitze. Die beiden Genannten sind allerdings nicht bereit, dasselbe auch für Ostdeutschland anzunehmen.
Aber selbst, wenn diese Inkonsequenz nicht bestünde, melden sich dagegen doch berechtigte Zweifel an. Es mag sein, daß zu den verschiedenen deutschen Staatsgründungen der Vergangenheit das Militär einen wesentlichen Beitrag geleistet hat. Zu einer aber ganz bestimmt nicht, nämlich zu der vom Jahre 1949. Damals wurde noch jeder Deutsche bestraft, der sich militärisch betätigen wollte. Dagegen erinnert sich der deutsche Bürger noch sehr genau an den Beitrag der deutschen Militärs vom Jahre 1945. Damals betätigten sich Offiziere der deutschen Wehrmacht recht erfolgreich, das eigene Vaterland durch Brückensprengen, Kin-der-in-den-Kampf-Schicken und ähnliches in einen Trümmerhaufen zu verwandeln, wobei mitunter Erwachsene, die ihren Durchhalteparolen den Glauben versagten, kurzerhand umgelegt wurden. Diese bittere Erfahrung spielt heute in Deutschland immer mit, wenn das Gespräch auf das Militär kommt. Es ist eine völlig andere Situation als 1935, als in Deutschland die allgemeine Wehrpflicht wiedereingeführt wurde. Damals lag der letzte auf deutschem Boden ausgetragene Krieg mehr als 120 Jahre zurück, das heißt in einer Zeit, in der man die Kanonen noch von vorne lud. Heute weiß man in Deutschland sehr genau, daß Verteidigung die Zerstörung des verteidigten Objekts bedeutet, und so ist denn auf der einen Seite der westdeutsche Bundesbürger etwas mißtrauisch, wenn er jene Kriegsgeräte bewundern soll, die er noch in recht unguter Erinnerung hat. Auf der anderen aber werden Westdeutschlands Militärs sichtlich nervös, wenn sie gefragt werden, wieviel Tote in der Zivilbevölkerung die im Manöver eingeplanten taktischen Atomwaffen wohl gekostet hätten.
Vor diesem Hintergrund erhielten drei Ereignisse eine ganz besonderes Gewicht, in denen in diesem Jahr die Bundeswehr mit der Politik in Berührung kam. Das geschah einmal in der Gestalt von Überläufern im ostdeutschen Fernsehen, die von Angriffsvorbereitungen der Bundeswehr zu erzählen wußten, zum zweiten, als im Juli ein aktiver General der Bundeswehr in einem Prozeß eine recht eigentümliche neue Dolchstoßlegende auftischte, und zum dritten, als der Führungsstab der Bundeswehr in diesem Sommer in einer Denkschrift die Ausrüstung der Bundeswehr mit taktischen Atomwaffen forderte. In allen drei Fällen war es kein bewußtes politisches Eingreifen, es war vielmehr ein Ausgleiten auf dem politischen Parkett, das aber besser als vieles andere die Situation der westdeutschen Bundeswehr beleuchtet.
Nun wird gewiß keiner die Bundeswehr verdächtigen wollen, einen Angriff gegen Ostdeutschland zu planen. Erschütternder war schon die Vorstellung, daß jener stotternde Gernegroß, der sich im ostdeutschen Fernsehen vorstellte, einmal der Adjutant des Befehlshabers der deutschen Luftwaffe gewesen war und als solcher Einblick in die geheimsten Dinge erhalten hatte. Denn hier lag das eigentlich Peinliche an dem Vorfall. Wie sollen die Alliierten zu Westdeutschlands Wehrmacht volles Vertrauen gewinnen, wenn man genau weiß, daß persönliche Bindungen zu Ostdeutschland einen sonst harmlosen Bürger zum Verräter machen können? Hier tut sich die ganze Problematik des zweigeteilten und doppeltbewaffneten Deutschlands auf.
Nicht weniger problematisch sind Prozesse, wie der von Brettheim im heurigen Sommer; in ihnen wurden Verbrechen abgeurteilt, die von Offizieren in der letzten Phase des Krieges begangen wurden. In Brettheim waren drei Bürger hingerichtet worden. Zwei, weil sie Hitlerjungen April 1945 die Panzerfäuste weggenommen haben, einer, weil er sich geweigert hat, das Todesurteil gegen die beiden anderen zu unterschreiben. Der Prozeß zeigte gleich zwei bedenkliche Seiten. Einmal verteidigten sich die zum drittenmal vor dem Richter Stehenden nicht mehr wie früher, sie hätten die Mordurteile unter Zwang unterschrieben, sondern sie kamen, Morgenluft witternd, mit der selbstbewußt vorgetragenen Behauptung, sie hätten ganz recht gehabt. Der als Sachverständiger vernommene aktive Bundeswehrgeneral von Hobe steuerte noch den Beitrag dazu, die Zivilbevölkerung habe 1945 den — wie jedes Kind wußte — völlig sinnlosen Kampf der Wehrmacht behindert. Und weil das noch nicht deutlich genug war, meinte er auch noch, „die Zivilbevölkerung kommt erst an zweiter Stelle, erst kommt das Instrument der Truppe“.
Was dem einen der Rettungsanker, das war dem anderen, zu seiner Ehre sei es angenommen, ein unangenehmes Eingeständnis. Denn dieses Eintreten für die „Kameraden aus dem zweiten Weltkrieg“ hat ja als Hintergrund die mögliche Verteidigung Westdeutschlands in einem sogenannten „Ernstfall“. Es war daher eine unbegreifliche Torheit des Bundesverteidigungsministeriums, Hobes Ausspruch dadurch zu verteidigen, daß es darauf hinwies, die Frau des Generals sei mit Verfolgten des 20. Juli verwandt. Denn ausgerechnet jene Männer des 20. Juli waren es ja gewesen, die das Schicksal des deutschen Volkes über das Instrument der Truppe gestellt hatten, ganz abgesehen davon, daß Verwandtschaft nur wenig von der Überzeugung aussagt, auf die es hierbei angekommen wäre. Der deutsche Bürger hätte lieber etwas erfahren, wie sich die Herren Generale ihre Vollmachten im Falle der Verteidigung denken.
Wenn man hier nicht einen klaren Trennungsstrich zur Praxis des Jahres 1945 zieht, wird man das Mißtrauen eines Großteils der deutschen Zivilbevölkerung kaum ausräumen können. Es ist ja ein Unterschied, ob die Man-steins und die Kesselrings, die den Makel tragen, Hitlers Feldmarschälle gewesen zu sein, ihren Kameraden, koste es, was es wolle, beispringen, oder ob das Leute der heutigen Bundeswehr tun. Es ist daher ein nicht minder bedenkliches Zeichen, wenn nunmehr der Soldatenbund, Morgenluft witternd, mit der Forderung hervortritt, alle (Un-)Taten der letzten Kriegswochen zu amnestieren. Denn es geht um das Vertrauen in der deutschen Bevölkerung, das man heute nicht mehr durch Standkonzerte gewinnen kann. In diesem Sinn war auch die Veröffentl'chung der Denkschrift über die Ausrüstung der Bundeswehr mit strategischen Atomwaffen ein Mißgriff. Denn in der eigenartigen Situation, in der wir uns befinden und in der eine Verteidigung unseres Territoriums ohne Bundesgenossen unmöglich ist, sind das alles politische Fragen, die von Militärs bestenfalls verdorben werden können.
Der zivile Charakter des westdeutschen Bundesheeres zeigt sich nirgends so klar wie in ihrem Verhältnis zur Generalität. Es war in früheren Zeiten nicht sehr schwer, General zu sein. Es ist, oder besser gesagt, es sollte, heute aber außerordentlich schwer sein. Denn die Bundeswehr ist heute kein selbständiger Faktor. Nach außen nicht, weil sie nur im Rahmen der NATO auftritt, und nach innen nicht, weil sie keine Vorrechte besitzt, die sie als geschlossenen Körper im Staat verankern. Jeder Soldat ist in erster Linie der freie Bürger eines freien Staates. Das Schlagwort des ersten Reformers der Bundeswehr, des Grafen Baudissin, vom Bürger in Uniform muß daher die wichtigste Maxime sein, wenn die Bundeswehr nicht ein gefährlicher Fremdkörper in der Bundesrepublik sein soll. Das Wort Hobes, erst komme das Instrument der Truppe und dann erst das Volk, war so ziemlich das Ärgste, was ein deutscher General sagen konnte. D;nn in einer iDenokratie darf es dieses Hintereinander nicht geben: Hier sind im Ideal Volk und Truppe dasselbe, jedenfalls aber erst das Volk und dann die Truppe. Erst wenn die Bundeswehr, wofür ermutigende Anzeichen vorliegen, ganz dienende Kraft seiner Bürger wird, wird sie das Mißtrauen überwinden können, das man in Westdeutschland so gerne wegdiskutieren möchte. Deshalb sind aber Verfügungen des Bundesverteidigungsministeriums über die Ausdehnung der Grußpflicht nach altem Wehrmachtschema erschreckende Zeichen politischer Instinktlosigkeit. Dies war sozusagen die vierte Torheit des heurigen Sommers. Sie ist jetzt, vom Parlament gerügt, sang- und klanglos verschwunden, was den Fehlgriff, so etwas in den Parlamentsferien zu erlassen, aber nicht ungeschehen macht. Zeichen erwachenden Wehrmachtungeistes haben sich in diesem Jahr gehäuft. Erinnert sei an dje arrogant-belehrende Ablehnung des von dem Wehrbeauftragten des Bundestages, des ehemaligen Generals G r o 1-m a n erstellten Gutachtens über seine Tätigkeit durch Herren des Bundesverteidigungsministeriums in diesem Frühjahr. Sollte der sich allmählich festigende Eindruck zurecht bestehen, daß der bullig-ehrgeizige Bundesverteidigungsminister Strauß diesem Geist in seinem Ministerium allzusehr nachgibt, um in der Bundeswehr einen innenpolitischen Machtfaktor für seine ehrgeizigen Pläne zu schaffen, so wäre die Situation gar nicht ernst genug zu nehmen. Denn die Wehrmacht einer Demokratie darf ebensowenig Einfluß auf die Politik gewinnen, wie die Interessenverbände sie bestimmen dürfen. Es kann ja nicht übersehen werden, daß in dem einen Jahr Militärdienst wahrscheinlich die Entscheidung fällt, welches Verhältnis die Jugend zur demokratischen Ordnung findet. Das Verhältnis der alten Reichswehr zur Republik kann hier nur als warnendes Beispiel genannt werden. Gewiß ist es nicht die erste Aufgabe der Truppe, ihre Soldaten im demokratischen Geist zu erziehen. Aber wenn in der Bundeswehr der Ungeist der Wehrmacht herrschen sollte, ist der Schaden unübersehbar. Die Voraussetzungen sind grundsätzlich für beide Entwicklungen da. Denn neben den beunruhigenden Symptomen steht eine erstaunlich nüchterne und ohne lauten Jubel, aber mit echtem Pflichtbewußtsein zu den Waffenübungen eilende Jugend.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!