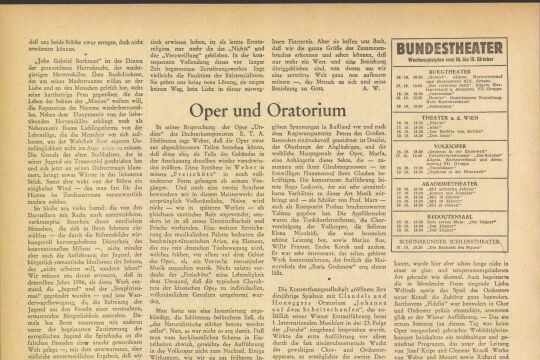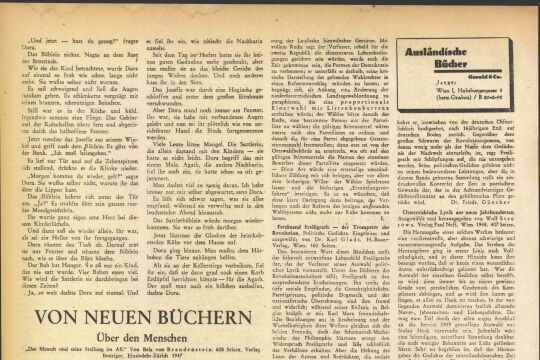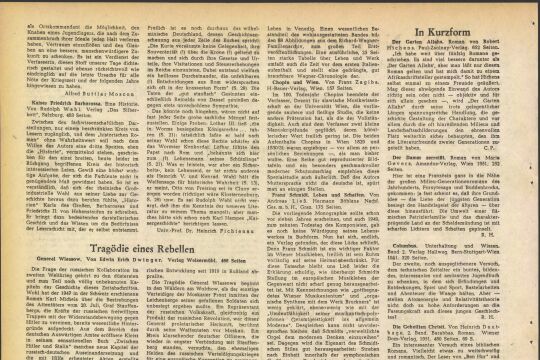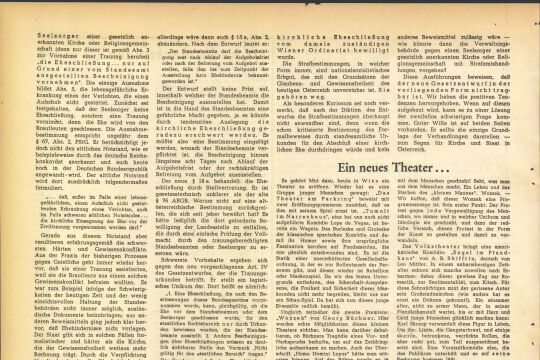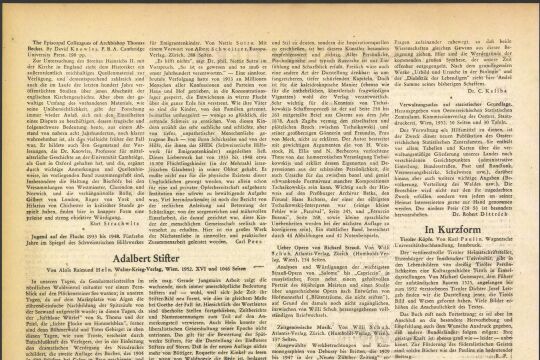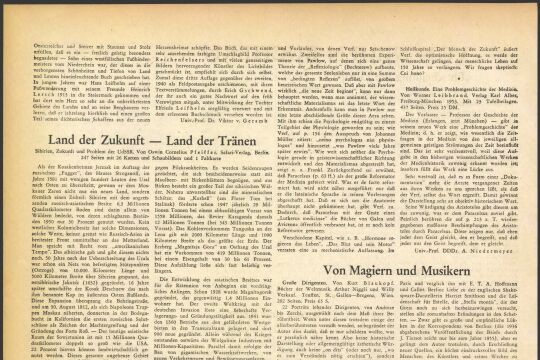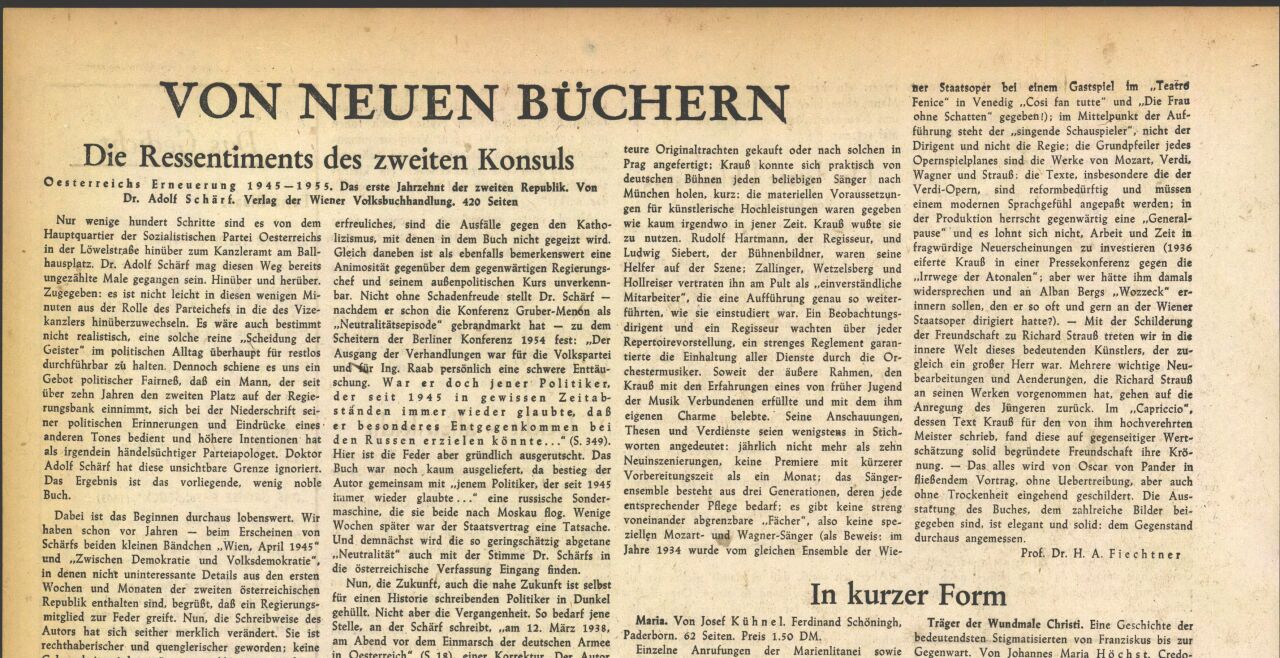
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Von großen Musikern
Die Last der Gnade. Ein Mozart-Roman. Von Pert Peterneil. Verlag „Das Bergland-Buch“, Salzburg. 448 Seiten. Preis 54 S.
Das ist nun einer der ersten Vorläufer jener Schar von Mozart-Büchern, die für 1956, zum 200. Geburtstag, zu erwarten sind. Seit Heribert Rau 1858 den ersten Mozart-Roman veröffentlichte, hat sich die Zahl der Musikerromane steigend vermehrt. Wenn einer so sauber und vernünftig geschrieben ist wie dieser, kann man ihn als Erbauungslektüre für Leute gelten Jassen, die sich scheuen, eine Biographie zu lesen. Und daß auch diesen nicht immer zu trauen ist, bezeugen einige historische Irrtümer, die der Autor wahrscheinlich nicht selbst begangen, sondern aus seinen Quellen geschöpft hat. Zum Beispiel ist Franz Anton Mesmer, der Magnetiseur, nicht in Dillingen geboren, wo er allerdings im Priesterseminar der Jesuiten eine Zeitlang studiert hat (S. 112). Der „junge Mesmer“, der erste Direktor der Lehrerbildungsanstalt und des Schulbücherverlags, Josef Mesmer, war nicht sein Sohn, sondern sein Vetter (S. 180). Der Erzherzog, zu dem Kaunitz über Mozart gesprochen hatte, hieß Maximilian, nicht Johann (S. 399). Haydn diente nicht Grafen, sondern den Fürsten Esterhäzy. Rätselhaft ist, warum das Buch 1787, mit dem Tode Leopold Mozarts, des Vaters, abbricht. War der vorgeschriebene Umfang des Buches dort erreicht? Oder haben die Leser einen anderen Band abzuwarten, der die letzten vier Jahre Mozarts schildern wird? Das Buch ist übrigens in einem Wiener Sender bruchstückweise vorgelesen worden.
Johannes Brahms. Von Franz Burkhart. Gerlach k Wiedling, Wien. 29 Seiten und 49 Ab-hiMnnaen.
Dieses sich „kleines Brevier“ nennende Büchlein will eine kurze, erste Unterrichtung geben. In der historischen Auffassung ziemlich konform mit den traditionellen Ansichten (zum Beispiel der Grund der Trennung von den Gesellschaftskonzerten, die dann wieder Herbeck übernahm: eigene Schaffenspläne), in der Datierung, soweit Stichproben ergaben, zuverlässig. Der Bildteil kostet Geld; daher mußte man — um den Preis erschwinglich zu halten — die Ausstattung recht bescheiden gestalten. Irgendeine Reproduktion der Radierungen Klingers zu den Werken von Brahms hätte man sich aber doch erwartet.
Hanns Salaschek
Clemens Krauß in München. Von Oscar von Pander. Verlag C. H Beck, München. 130 Seiten. Preis 11.50 DM.
Bezeichnend für dieses von Begeisterung getragene, aber im Detail vorbildlich sachliche Buch ist, daß es mit einer Zeittafel und einem Verzeichnis der Neuinszenierungen und .Konzerte unter Clemens Krauß beginnt. Man weiß in Wien, unter welchen Umständen Krauß seine Vaterstadt verließ, um erst nach Berlin, dann nach München zu gehen. Was die Wiener Oper verlor, gewannen die drei Münchner Häuser, vor allem das Nationaltheater, das unter Krauß seine zweite große Blütezeit erlebte. Hier fanden, von Jänner 1937 bis Sommer 1944, Jahr für Jahr jene „grundlegenden Neuinszenierungen“ statt, die zum Besten gehörten, was man damals an deutschen Opernhäusern sehen konnte: Die Stellung von Clemens Krauß in München war einzigartig. Dieser autonomste Opernchef erhielt einen jährlichen Zuschuß von 400.000 Mark und persönlich ein Gehalt von 60.000 Mark; für den Ankauf italienischer Meistergeigen (Guarneri und Stradivari) wurden ihm 100.000 Mark zur Verfügung gestellt, die Inszenierungen erfolgten ausschließlich mit echten Kostümen, für die „Verkaufte Braut“ zum Beispiel wurden teure Originaltrachten gekauft oder nach solchen in Prag angefertigt; Krauß konnte sich praktisch von deutschen Bühnen jeden beliebigen Sänger nach München holen, kurz: die materiellen Voraussetzungen für künstlerische Hochleistungen waren gegeben wie kaum irgendwo in jener Zeit. Krauß wußte sie zu nutzen. Rudolf Hartmann, der Regisseur, und Ludwig Siebert, der Bühnenbildner, waren seine Helfer auf der Szene; Zallinger, Wetzelsberg und Hollreiser vertraten ihn am Pult als „einverständliche Mitarbeiter“, die eine Aufführung genau so weiterführten, wie sie einstudiert war. Ein Beobachtungsdirigent und ein Regisseur wachten über jeder Repertoirevorstellung, ein strenges Reglement garantierte die Einhaltung aller Dienste durch die Orchestermusiker. Soweit der äußere Rahmen, den Krauß mit den Erfahrungen eines von früher Jugend der Musik Verbundenen erfüllte und mit dem ihm eigenen Charme belebte. Seine Anschauungen, Thesen und Verdienste seien wenigstens in Stichworten angedeutet: jährlich nicht mehr als zehn Neuinszenierungen, keine Premiere mit kürzerer Vorbereitungszeit als ein Monat; das Sängerensemble besteht aus drei Generationen, deren jede entsprechender Pflege bedarf; es gibt keine streng voneinander abgrenzbare „Fächer“, also keine speziellen Mozart- und Wagner-Sänger (als Beweis: im Jahre 1934 wurde vom gleichen Ensemble der Wiener Staatsoper bei einem Gastspiel im „Teatrd
Fenke“ in Venedig „Cosi fan tutte“ und „Die Frau ohne Schatten“ gegeben!); im Mittelpunkt der Aufführung steht der „singende Schauspieler“, nicht der Dirigent und nicht die Regie; die Grundpfeiler jedes Opernspielplanes sind die Werke von Mozart, Verdi, Wagner und Strauß; die Texte, insbesondere die der Verdi-Opern, sind reformbedürftig und müssen einem modernen Sprachgefühl angepaßt werden; in der Produktion herrscht gegenwärtig eine „Generalpause“ und es lohnt sich nicht, Arbeit und Zeit in fragwürdige Neuerscheinungen zu investieren (1936 eiferte Krauß in einer Pressekonferenz gegen die „Irrwege der Atonalen“; aber wer hätte ihm damals widersprechen und ah Alban Bergs „Wozzeck“ erinnern sollen, den er so oft und gern an der Wiener Staatsoper dirigiert hatte?). — Mit der Schilderung der Freundschaft zu Richard Strauß treten wir in di innere Welt dieses bedeutenden Künstlers, der zugleich ein großer Herr war. Mehrere wichtige Neubearbeitungen und Aenderungen, die Richard Strauß an seinen Werken vorgenommen hat, gehen auf die Anregung des Jüngeren zurück. Im „Capriccio“, dessen Text Krauß für den von ihm hochverehrten Meister schrieb, fand diese auf gegenseitiger Wertschätzung solid begründete Freundschaft ihre Krönung. — Das alles wird von Oscar von Pander in fließendem Vortrag, ohne Uebertreibung, aber auch ohne Trockenheit eingehend geschildert. Die Ausstattung des Buches, dem zahlreiche Bilder beigegeben sind, ist elegant und solid: dem Gegenstand durchaus angemessen.
Prof. Dr. H. A. Fiechtner
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!