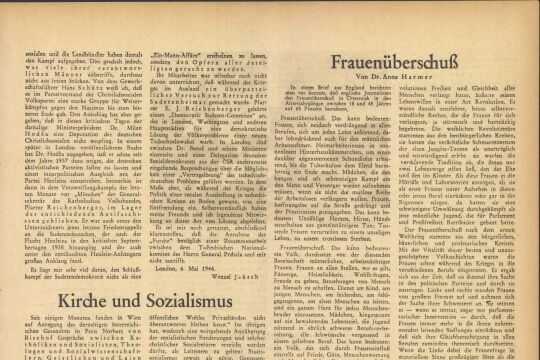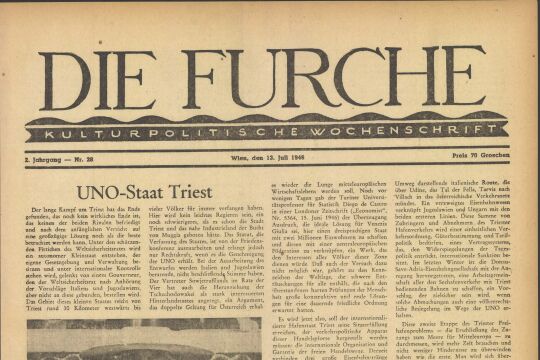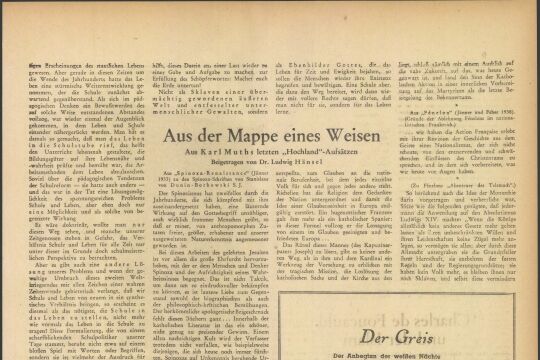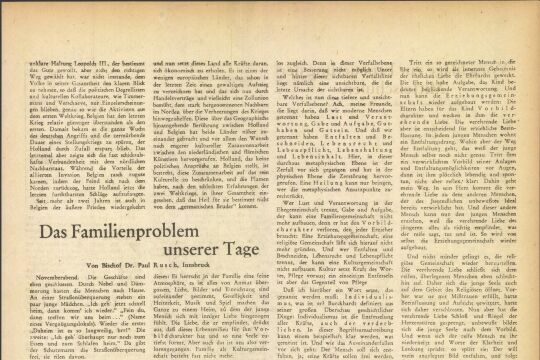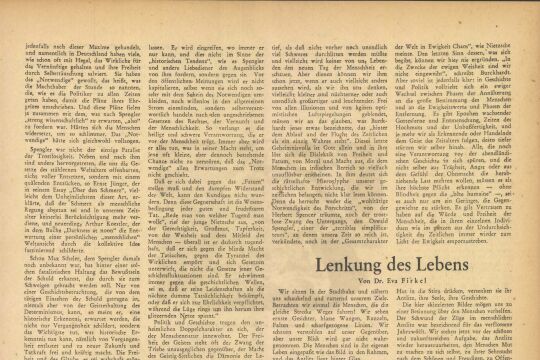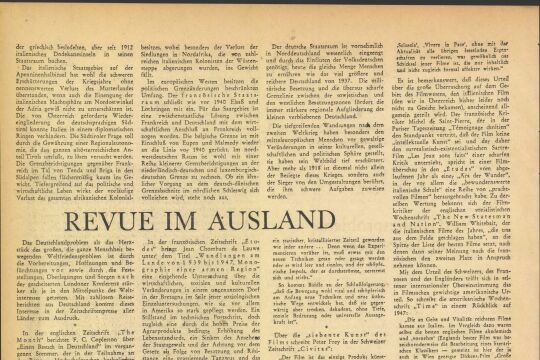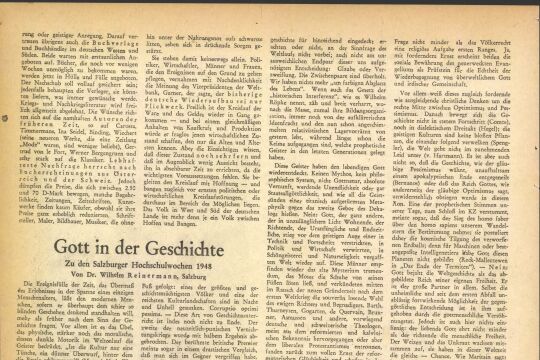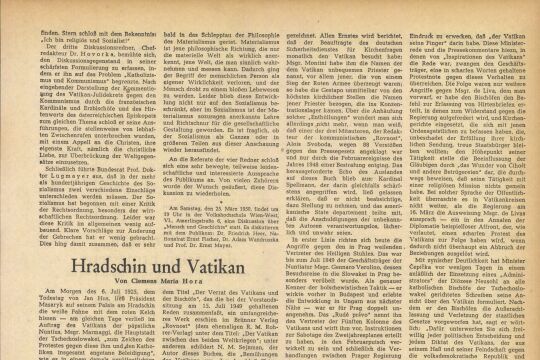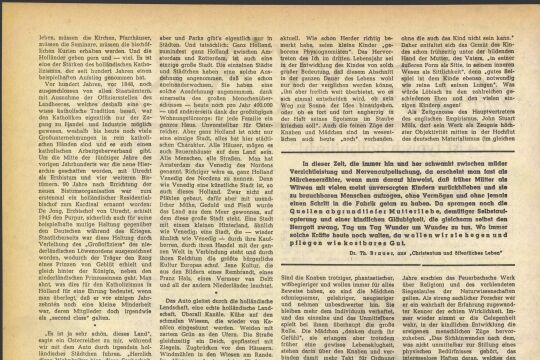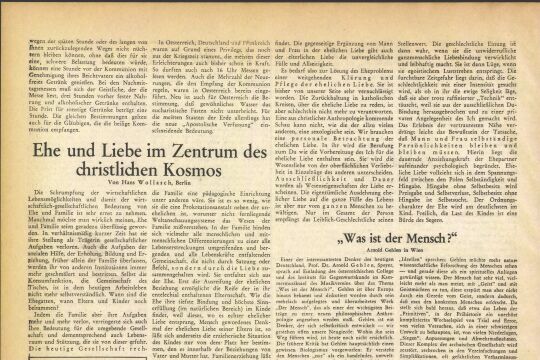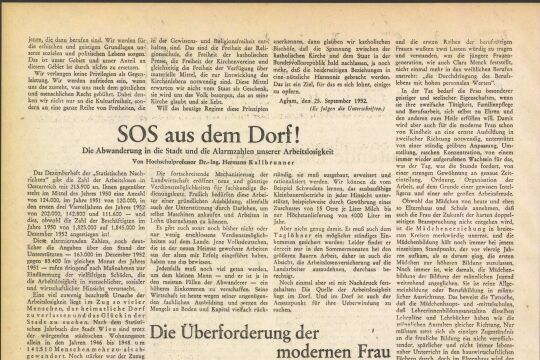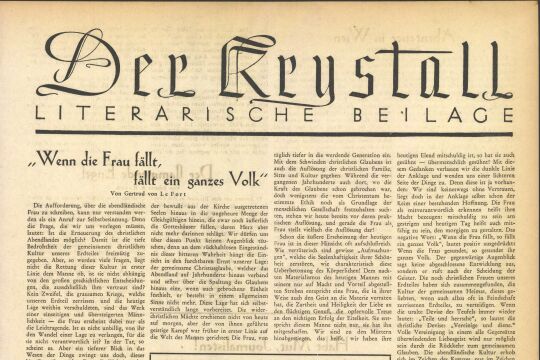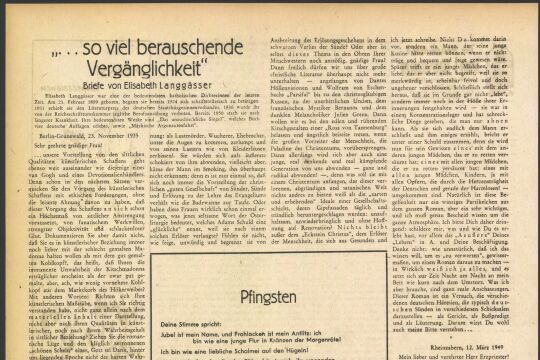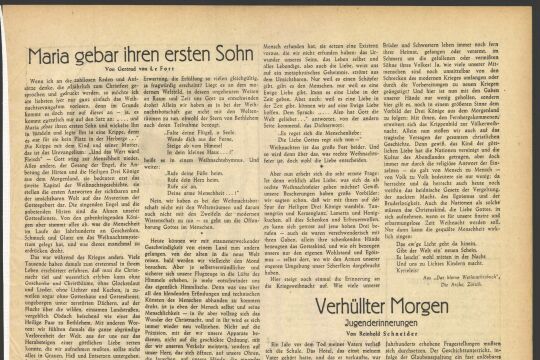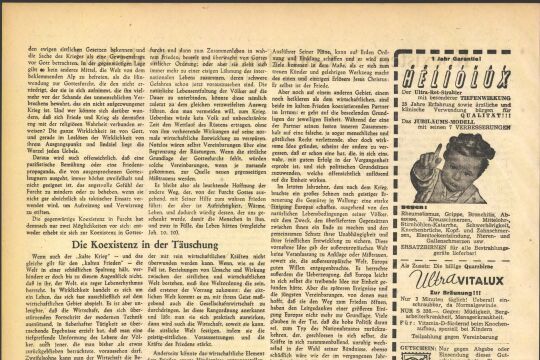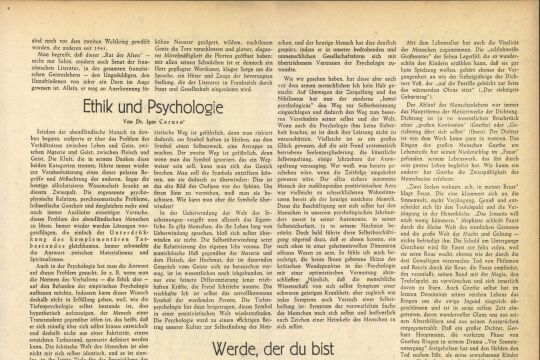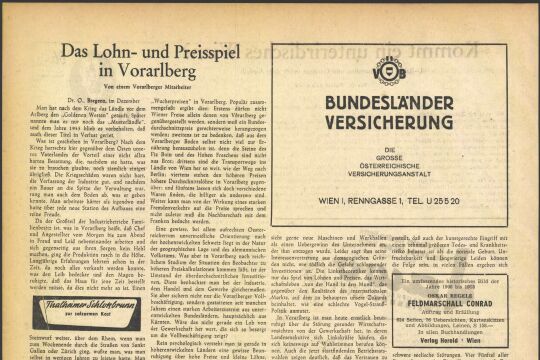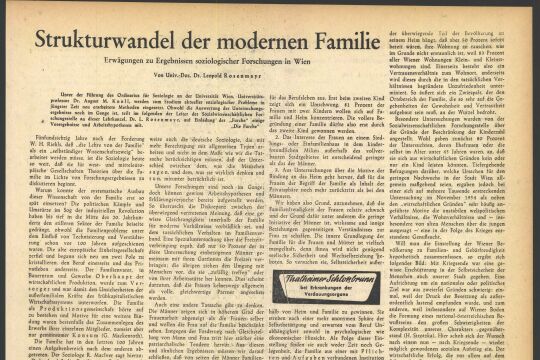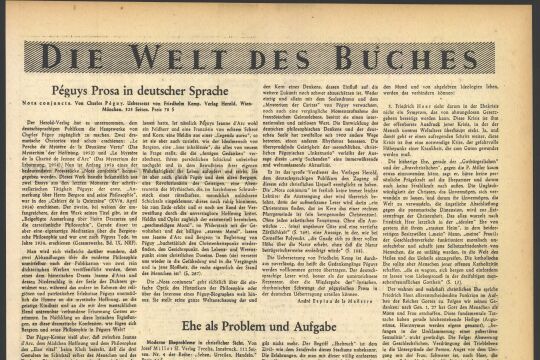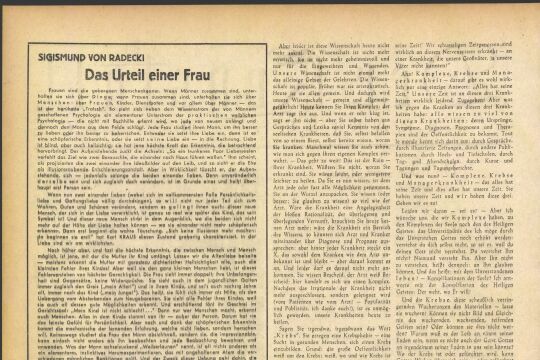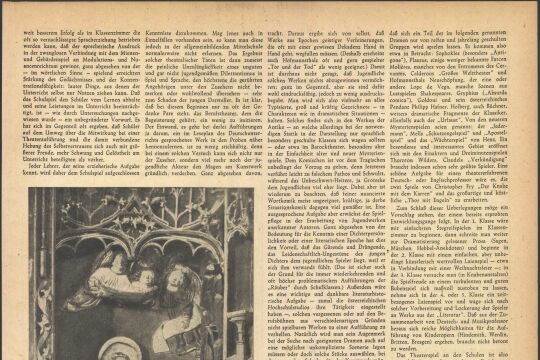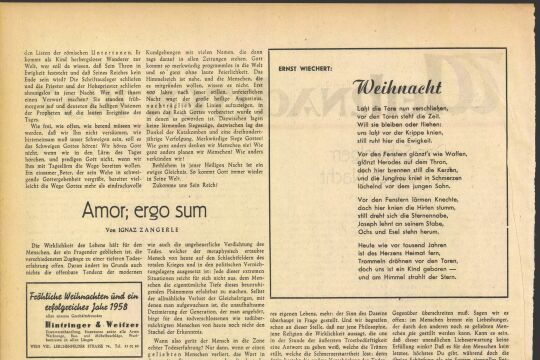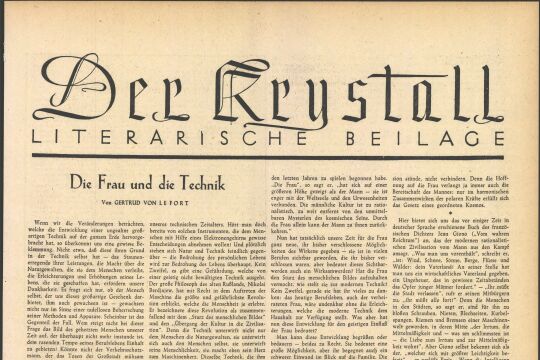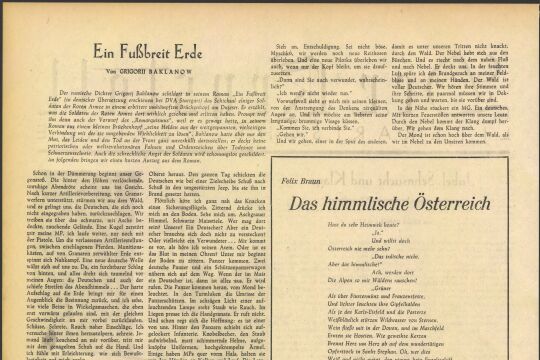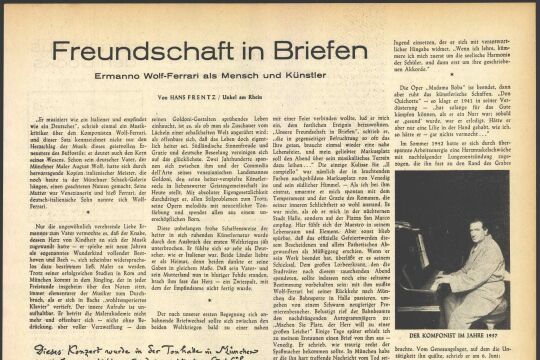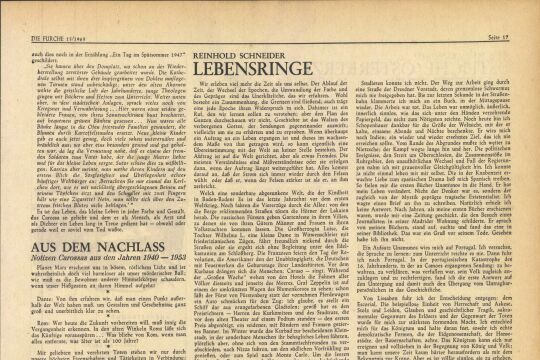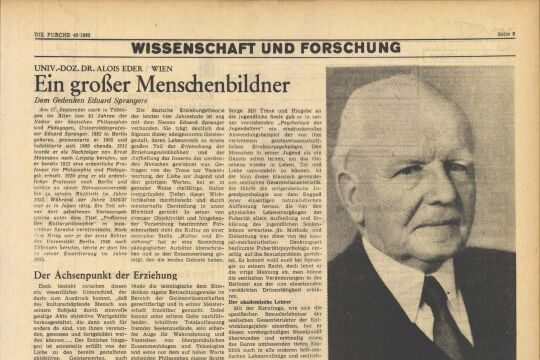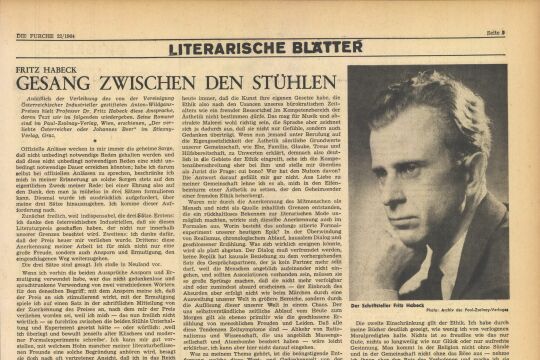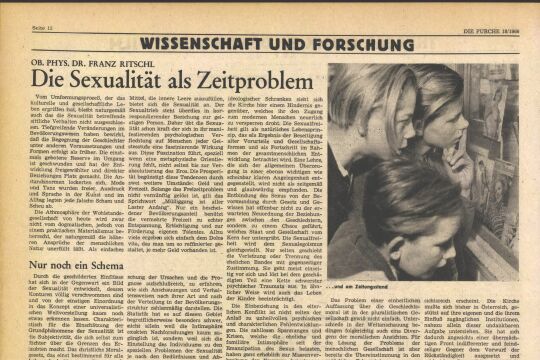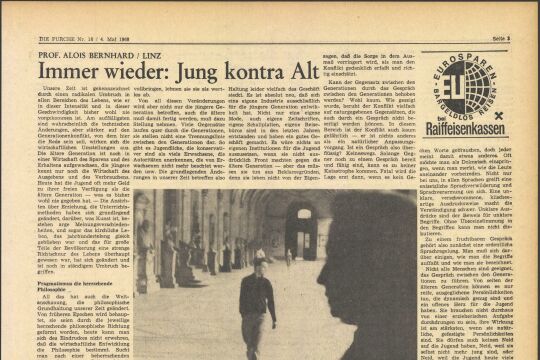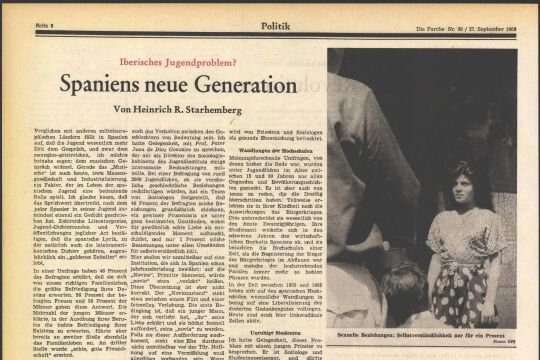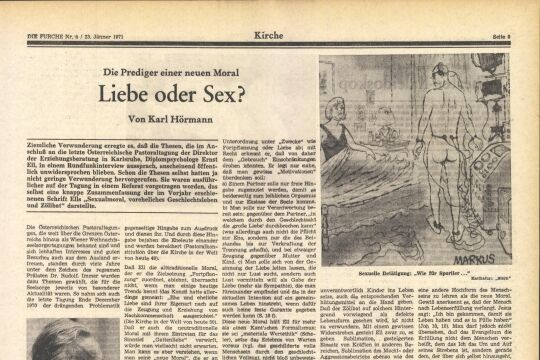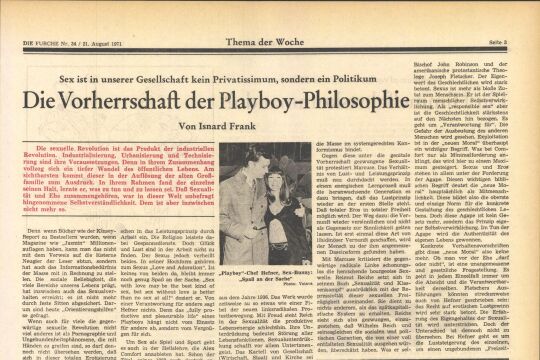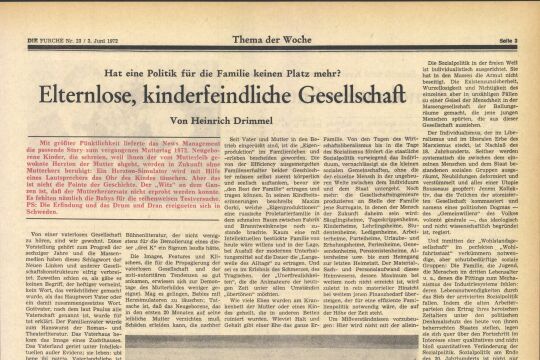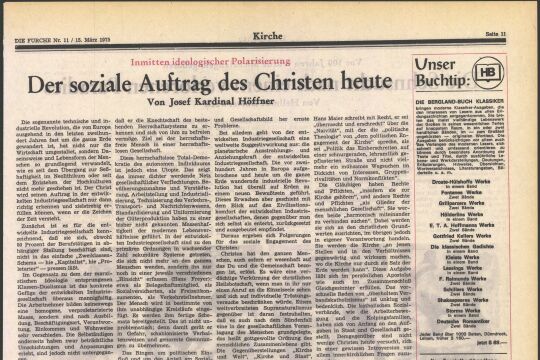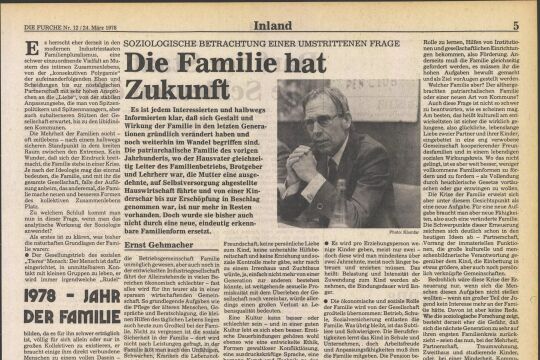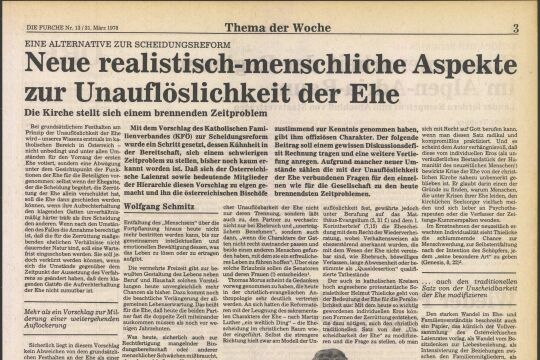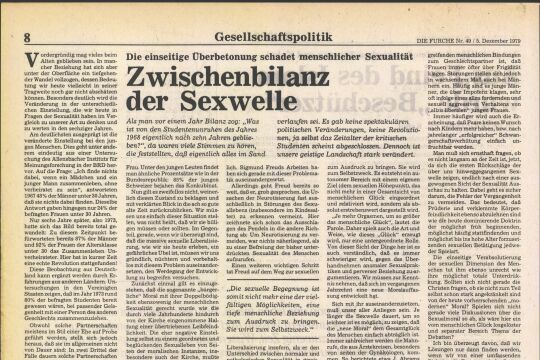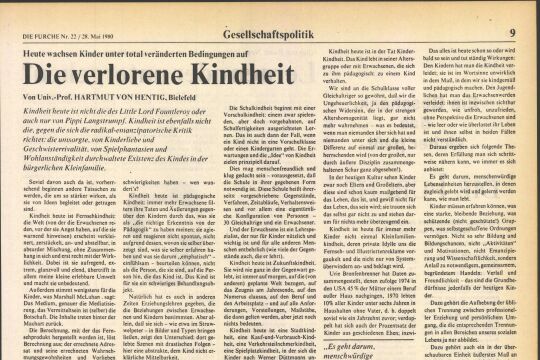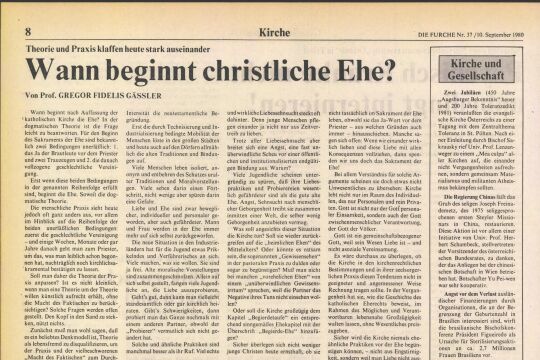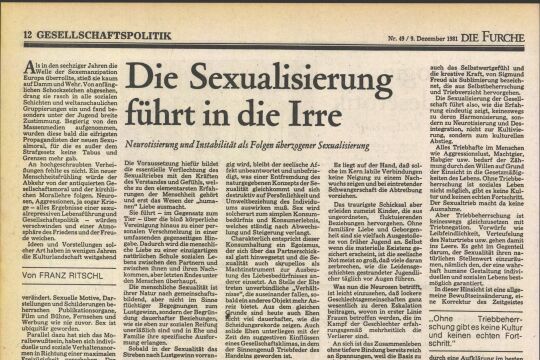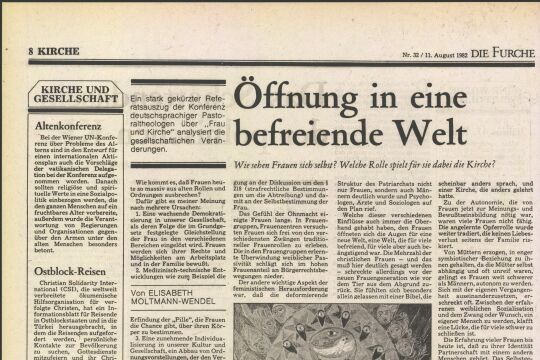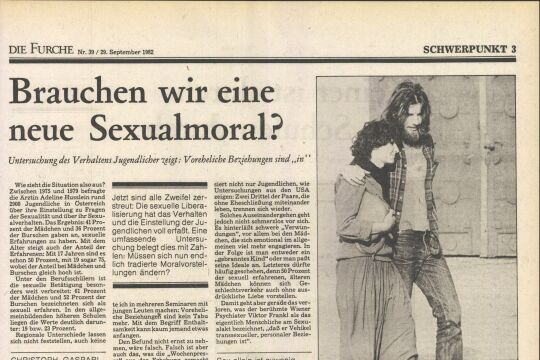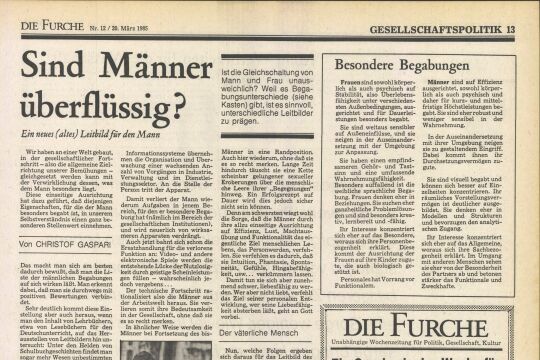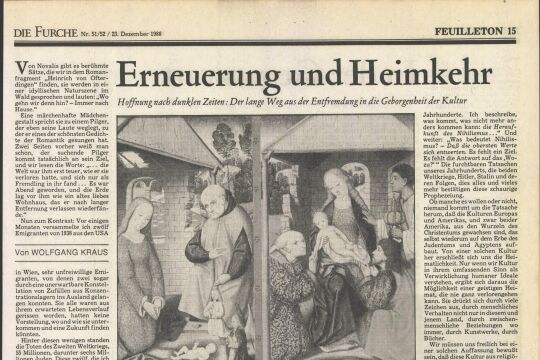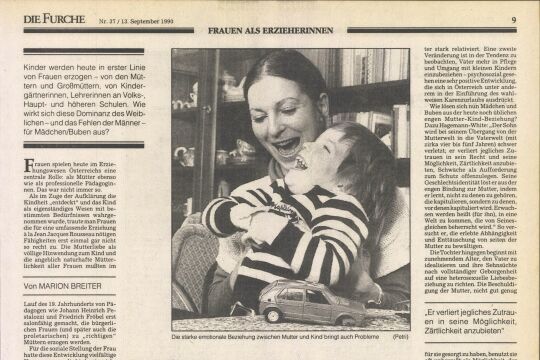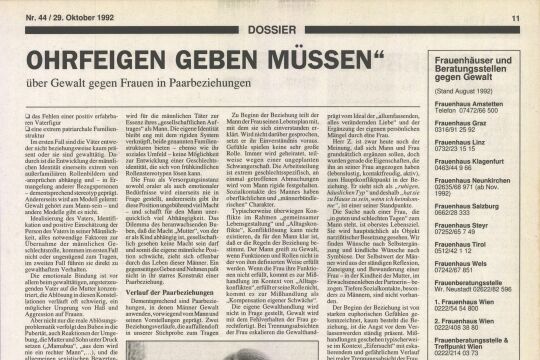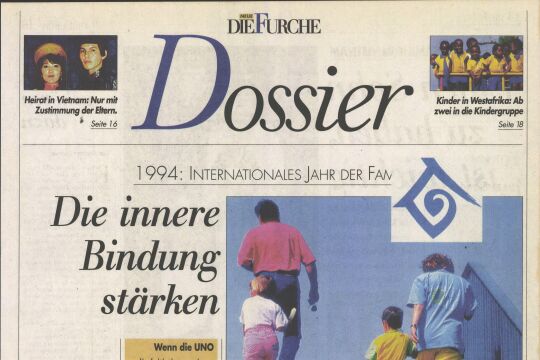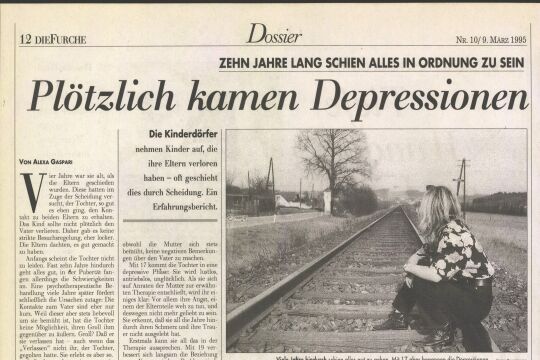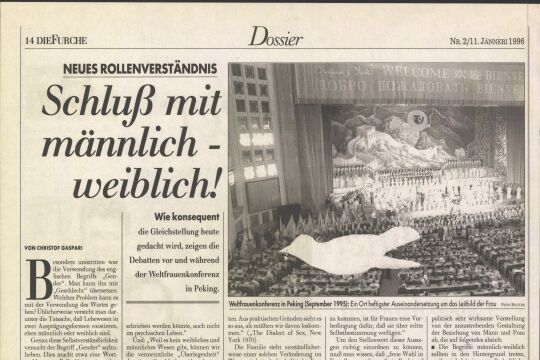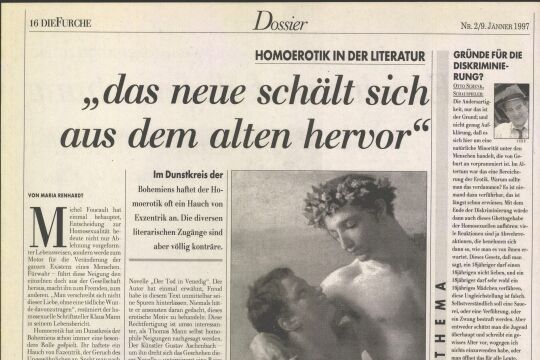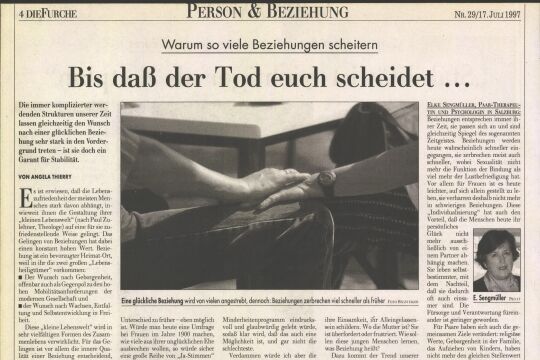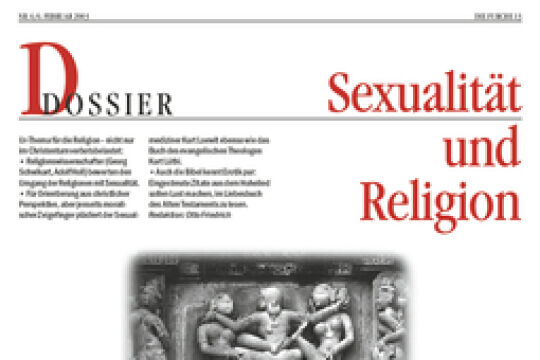Die Regeln der Liebe
Romantische Beziehungen werden oft als Resultat biochemischer Prozesse verstanden. Doch sie sind vor allem auch gesellschaftlich geprägt.
Romantische Beziehungen werden oft als Resultat biochemischer Prozesse verstanden. Doch sie sind vor allem auch gesellschaftlich geprägt.
Die Mehrheit der frisch verliebten Paare lernt sich heute über Dating-Apps kennen, so zeigen es jüngste Studien. Dort wird basierend auf Äußerlichkeiten nach links oder rechts geswipt. Wer ein match hat, sich also gegenseitig gefällt, kann ein Date ausmachen und dann –ganz im Gegensatz zur technischen Funktionsweise der Apps – intuitiv entscheiden: Mag man den Geruch des anderen? Kann man sich mit seinem Gegenüber Intimität vorstellen? Wird man sich nach dem ersten Treffen wiedersehen?
Die Liebe ist etwas Magisches. Wann sie einen überrollt, scheint außerhalb unserer Macht zu stehen. „Welch eine himmlische Empfindung ist es, seinem Herzen zu folgen“, schrieb Johann Wolfgang von Goethe einst – und diesem Gebot scheinen wir auch heute noch nachzugehen, wenn wir uns ganz nach Gefühl in eine neue Beziehung hineinfallen lassen.
Verliebtheit ist das Resultat biochemischer Prozesse. Hormone stellen unser Leben auf den Kopf, sorgen für Bauchkribbeln und rauben uns den Appetit. Auch die Psychologie beeinflusst, wie wir lieben. So finden wir uns oft in Beziehungen wieder, deren Dynamiken uns aus früher Kindheit bekannt sind, wie Attraktivitätsforscher aufzeigen. Ist die Menschheit der Liebe also machtlos ergeben?
Ganz so einfach ist es nicht. Die romantische Liebe ist eine Erfindung der Neuzeit, schreibt etwa die Soziologin Barbara Kuchler, die sich seit mehreren Jahren mit ihr auseinandersetzt. Und tatsächlich: Dass romantische Beziehungen vor allem gesellschaftlichen Konventionen folgen, scheinen wir heute oft zu vergessen.
„Die Ehe“, schrieb der spätantike Dichter Palladas, „beschert einem Mann zwei glückliche Tage: den, an dem er seine Braut zu Bett bringt – und den, an dem er sie zu Grabe trägt.“ Die Misogynie in diesem Zitat war Norm im alten Griechenland und auch viel später noch. Doch wo kein Miteinander auf Augenhöhe stattfindet, sind auch keine Partnerschaften auf Augenhöhe möglich. Tatsächlich wurden Beziehungen zwischen Mann und Frau vor allem zum Zweck der Fortpflanzung eingegangen – eine Pflicht dem Staat gegenüber, wie man meinte. Liebesgefühle, die gesellschaftlich angepriesen wurden, so etwa von Philosophen wie Platon, bezogen sich vor allem auf die geistige Verbundenheit unter Männern.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!