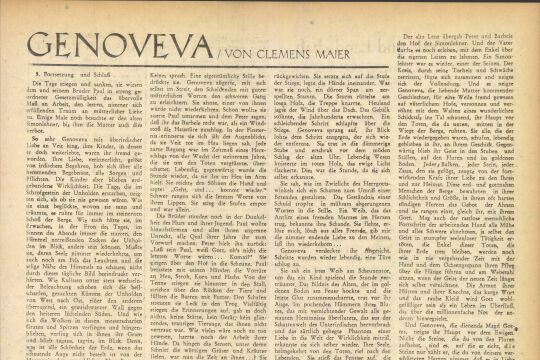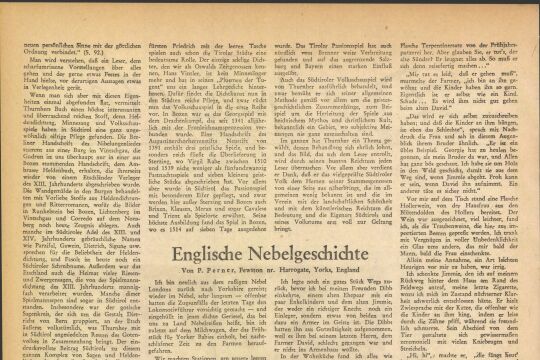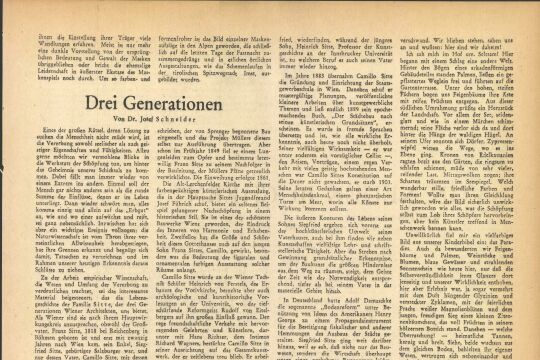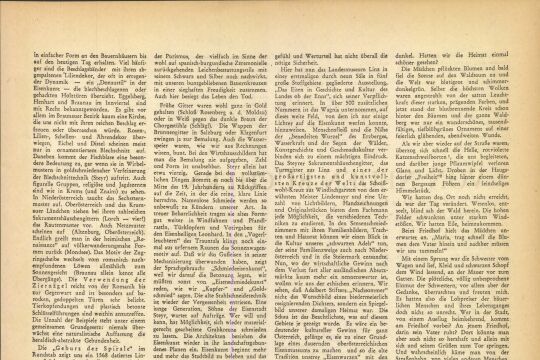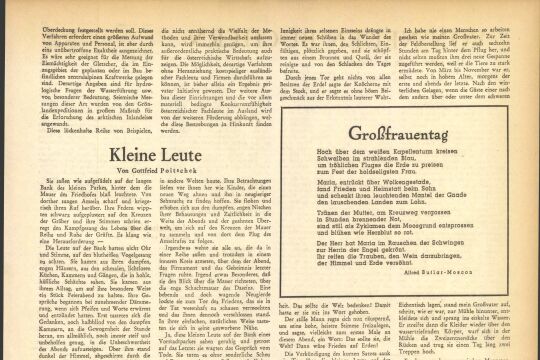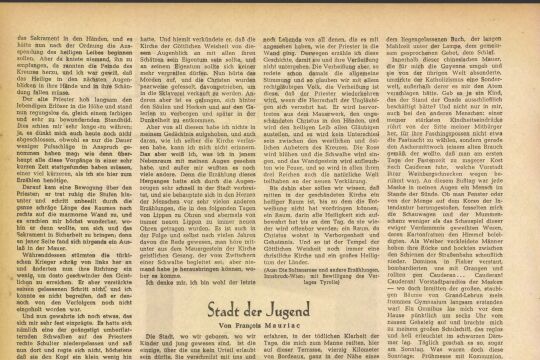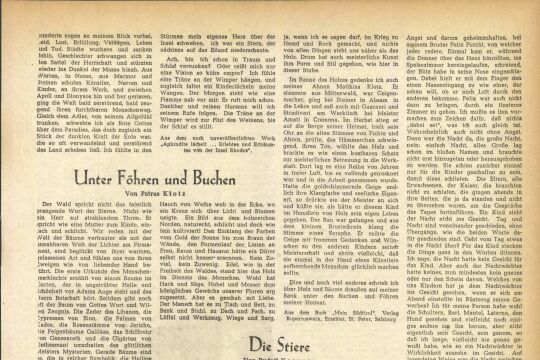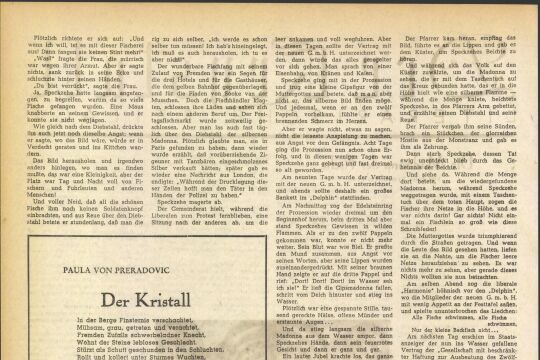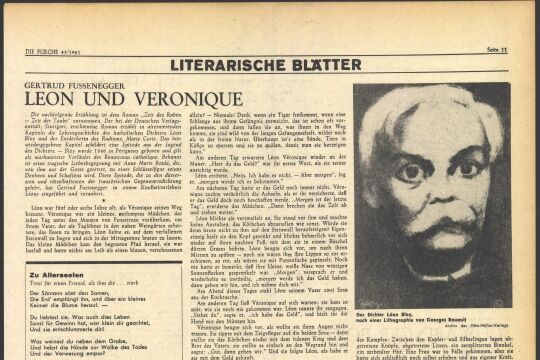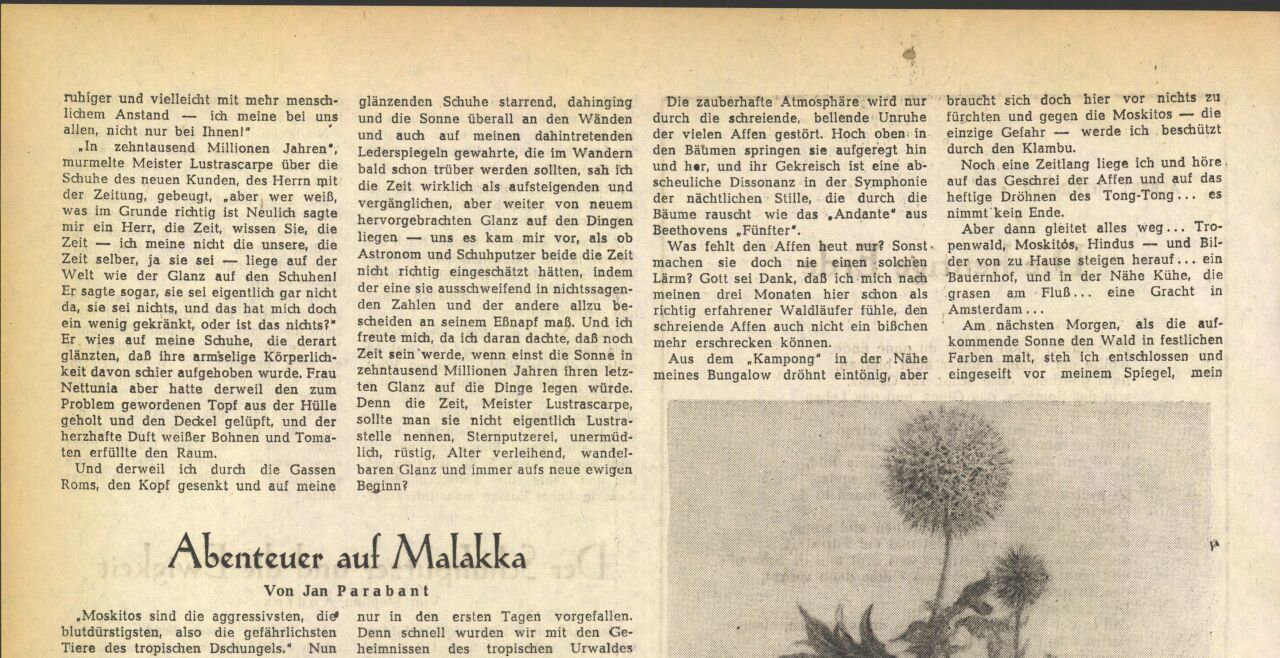
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Abenteuer auf AAalakL
„Moskitos sind die aggressivsten, die blutdürstigsten, also die gefährlichsten Tiere des tropischen Dschungels.“ Nun schon fast drei Monate lang wurde uns diese Mahnung tagtäglich vom Sanitätsdienst eingeschärft. Natürlich hatten wir uns das allmählich hinter die Ohren geschrieben ... „Wir“, das war ein Bataillon holländischer Freiwilligen, das sich September 1945 voller Enthusiasmus nach Niederländisch-Indien hatte einschiffen lassen und das aus irgendeinem unerklärlichen Grund der immer unerklärlichen hohen Politik auf der Halbinsel Malakka gestrandet war.
So waren wir nun schon beinahe drei Monate lang in einem total verwahrlosten, ehemals japanischen Lager, in „Morib Beach“, irgendwo an der Westküste, untergebracht.
Der Anfang war gar nicht so einfach; tagsüber war die Atmosphäre erdrük-kend heiß wie geschmolzenes Blei. Die Abende jedoch brachten eine kühlende Seebrise und, wenn die Sonne in einer Symphonie von exotischen Farben in den Meeresfluten versank, eine unwirkliche Pracht. Unmittelbar darauf fiel die Nacht herein, ohne vorherige Warnung der Dämmerung, so wie wir es in Europa gewöhnt sind. Und mit der niedersinkenden Nacht begann der Urwald zu leben; wilde Schweine schnüffelten und wühlten um die Feldküchen, Schlangen wagten sich bis an die Baracken vor; die Wände wurden das Jagdrevier der „Chekkos“, eine Art Rieseneidechse mit einem ungeheuerlichen Drachenkopf, den das Tier aufbläst, wenn es „Chekko, Chekko“ ruft. Aus dem Wald klangen unheimliche Geräusche unbekannter Tiere, die auch bei den unverzagtesten Kriegern — zum Großteil einfache holländische Bauernburschen — eine Gänsehaut hervorriefen.
Einmal hatten wir mitten in der Nacht „Großalarm“: Einer der Soldaten war aufgewacht und entdeckte neben seinem Klambu (Moskitonetz) ein abscheuliches
Gesicht, das ihn mit einem satanischen Lächeln anstarrte. Der Soldat schrie laut auf, und es dauerte keine zwei Sekunden, da war die ganze Kompanie mit „sten guns“ und Gewehren aus den Moskitonetzen gesprungen. Aber nur die Allerschnellsten sahen noch den kolossalen Affen, der in eine hohe Palme geflüchtet war und nun philosophisch auf den Tumult heruntersah, den er verursacht hatte... Aber dergleichen „Inzidente“ waren nur in den ersten Tagen vorgefallen. Denn schnell wurden wir mit den Geheimnissen des tropischen Urwaldes vertraut. Wir freundeten uns bald mit der primitiven Bevölkerung an-, die Kinder der Hindu, „Tamils“, und die der Mohammedaner, „Malaier“, zeigten uns, wie man Krabben fängt und als Leckerbissen zubereitet. Sie hielten bei unseren täglichen Mahlzeiten tüchtig mit und saßen einmütig ganz vorne, wenn unser Bataillonsgeistlicher am Sonntagmorgen unter den Djatibäumen am Strand die Messe zelebrierte.
Und vor den Tieren fürchteten wir uns auch schon lange nicht mehr; die wilden Schweine bildeten bald eine willkommene Abwechslung in unserem täglichen Konservenmenu; Schlangenhäute wurden eifrig zugerichtet, um für die Mädchen zu Hause in Handtaschen verwandelt zu werden, und fast jeder Soldat hatte einen eigenen „Leibaffen“, der am Fußende seiner „baleh-baleh“, außerhalb des Klambu, schlief.
Nur die Moskitos natürlich! Ihnen hatten wir den „totalen“ Krieg erklären müssen. Der Doktor konnte uns nidit genug aufs Herzogen, daß Moskitos die gefährlichsten, die aggressivsten und blutdürstigsten Tiere des Urwaldes wären, vor allem, wenn die Sonne untergegangen ist. Denn ihr Biß verursacht das gefürchtete Malariafieber, das auch den tapfersten Batallonsstoßtruppen erhebliche Verluste zufügen kann...
Als ich deshalb an einem Abend spät das Lager verließ, rieb ich mir Gesicht und Hände gründlich mit Moskitoöl ein, um gegen jegliche Gefahr gut geschützt zu sein. Ich mußte eine halbe Stunde weit durch den Wald gehen, in demich wegen meiner Spezialaufgabe im Bataillon in einem „Bungalow“ eines Ceylonesen einquartiert war.
Es ist ein herrlicher Genuß, nachts allein durch den Wald zu gehen. Der Vollmond hat ihn, der tagsüber so düster ist, in einen zauberhaften Märchenwald verwandelt. Der kleine Fluß, am Tage ein träges, sumpfiges Gewässer, glänzt wie ein silberner Bach vom Zauberstab des Mondes berührt. Und die Kokospalmen dort drüben, die alten Aristokraten des Tropenwaldes, sind in ihrer stattlichen Höhe noch unnahbarer geworden, da sie nun silberne Kronen tragen.
Außer mit einer Dienstpistole, die in ihrem Futteral irgendwo hinten an meinem Gürtel baumelt, bin ich natürlich nicht bewaffnet. Warum sollte man sich auch bewaffnen, es wohnen lauter einfache, freundliche Menschen hier. Vor den wenigen malaiischen Pfahlhütten am Fluß brennen Feuer. Wahrscheinlich auch zum Schutz gegen die Moskitos, denke ich. Die Menschen rufen mir einen langen, von breiten Gebärden begleiteten Gruß zu. Ich verstehe natürlich kein Wort von dem, was sie sagen, und weiß nichts Freundlicheres zu 'tun, als ihnen mit einer gleich breiten Gebärde „Gute Nacht“ zu wünschen.
Die Bäume in der Nähe des Feuers werden durch die Flammen rötlich beleuchtet, die hoch auflodern; dahinter tanzen, gleich phantastischen Waldgeistern, die Schatten, welche die Kraft des Feuers geboren hat.
Die zauberhafte Atmosphäre wird nur durch die schreiende, bellende Unruhe der vielen Affen gestört. Hoch oben in den Bäumen springen sie aufgeregt hin und hr, und ihr Gekreisch ist eine abscheuliche Dissonanz in der Symphonie der nächtlichen Stille, die durch die Bäume rauscht wie das .Andante“ aus Beethovens „Fünfter“.
Was fehlt den Affen heut nur? Sonst-machen sie doch nie einen -solchen Lärm? Gott sei Dank, daß ich mich nach meinen drei Monaten hier schon als richtig erfahrener Waldläufer fühle, den schreiende Affen auch nicht ein bißchen mehr erschrecken können.
Aus dem „Kampong“ in der Nähe meines Bungalow dröhnt eintönig, aber in erregendem Rhythmus der „Tong-Tong“. Sollte noch eine Hochzeit sein im Kampong? Oder sollten die Hindus sich wieder einmal bis zur Ekstase aufpeitschen zu Ehren ihrer Todesgöttin, die in der Nähe ihren Tempel hat? Einmal konnte ich so einer Hindufeierlichkeit beiwohnen. Bei untergehender Sonne zog mit Flötenklang und Glockengeklingel eine Prozession um den Tempel, während der „Tong-Tong“ den Rhythmus angab. Große Feuer wurden entfacht, und als die Dunkelheit hereingefallen war, wurde aus der Prozession ein Tanz, der durch Musik und „Tong-Tong“ immer mehr gesteigert wurde, bis endlich alle in leidenschaftlich religiöser Ekstase wilde Schreie ausstießen und sich flach auf die Erde warfen zu Ehren der Göttin, die diesen Heiden so viel Furcht einflößt und deshalb von ihnen so sehr angebetet wird.
Auf dem Höhepunkt der Ekstase erkletterten dann einige nackte Hindus die brennenden Holzstöße, tanzen wie unheimliche dunkle Teufel minutenlang im Feuer und kamen wieder unversehrt hervor aus den Flammen.
Einen Augenblick zaudere ich, ob ich in den Kampong gehen soll. Aber vielleicht ist es doch nicht vernünftig, als Europäer uneingeladen gerade jetzt auf dem Höhepunkt ihres Festes zu erscheinen. Und weiter dröhnt der Tong-Tong, aufregend, leidenschaftlich, Angst einjagend . ..
In meinem Bungalow ist niemand zu sehen. Mein Gastgeber ist verreist, das weiß ich. Aber auch die Bedienten sind • nicht da ... wahrscheinlich sind sie auf dem Fest. Macht nichts, es ist ja schon spät genug, denke ich, und krieche zufrieden unter meinen „Klambu“ — natürlich erst nach einer peinlich genauen „Säuberungsaktion“ gegen eventuell anwesende Moskitos und nachdem ich meiner Pistole rein gewohnheitsmäßig ihren Platz unter meinem Kopfkissen gegeben habe. Türen und Fenster bleiben wie immer weit geöffnet. Man braucht sich doch hier vor nichts zu fürchten und gegen die Moskitos — die einzige Gefahr — werde ich beschützt durch den Klambu.
Noch eine Zeitlang liege ich und höre, auf das Geschrei der Affen und auf das heftige Dröhnen des Tong-Tong... es nimmt'kein Ende.
Aber dann gleitet alles weg... Tropenwald, Moskitos, Hindus — und Bilder von zu Hause steigen herauf... ein 'Bauernhof, und in der Nähe Kühe, die grasen am Fluß... eine Gracht in Amsterdam...
Am nächsten Morgen, als die aufkommende Sonne den Wald in festlichen Farben malt, steh ich entschlossen und eingeseift vor meinem Spiegel, mein
Rasiermesser in der Hand, als mein Bedienter hereinkommt und mich lange und sprachlos anstarrt, als wäre ich ein Weltwunder...
„Sahib tapferer Mann“, sagt er schließlich.
„Sahib versteht natürlich nichts davon und weiß im Moment nichts Vernünftigeres zu tun, als sehr weise und bestätigend in den Spiegel zu nicken.
„Sahib gar nicht ängstlich.“
„Sahibs“ Mund öffnet sich weit vor Staunen, er weiß nicht, was sein Diener meint.
„Am Abend zwei schwarze Panther im Wald ... Affen schreien ... Menschen große Angst, Feuer anzünden, Tong-Tong schlagen, um Panther wegzujagen ... hier ganz nah Büffel zerreißen ... aber Sahib gar keine Angst... allein durch den Wald laufen.“
Ein roter Strich erschien auf „Sahibs“ Kinn; Blut floß herunter, „Sahibs“ tapfere Hand hatte sdieinbar doch plötzlich gezittert. Denn der schwarze Panther — das hörten wir später — ist noch vor den Moskitos das aggressivste, blutdürstigste und gefährlichste Tier des Urwaldes. Noch weitaus gefährlicher als der „gewöhnliche“ Tiger, weil ein Panther auf die Bäume klettert, um von da aus sein Opfer zu belauern. Wir hätten es eigentlich wissen sollen, aber schließlich glaubt ein moderner Mensch so schwer an Panther, es sei denn, sie sitzen hinter Gitterstäben im Tiergarten.
Einige Tage später fanden unsere Soldaten irgendwo im Dschungel ein Nest mit drei jungen Panthern, die dann in unserem Lager liebevoll mit der Milchflasche aufgezogen wurden.
Aber eines Morgens fanden wir auch im Lager Spuren der „Mutter“-Panther, die des Nachts nach ihren Jungen suchte. Von jenem Tage an konnte auch der tapfere „Sahib“ nur mehr unter dem Schutze einer bewaffneten Patjrouille, die brennende Fackeln trug, zu seinem Bungalow begleitet werden. Und so blieb es, bis wir Malakka verließen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!