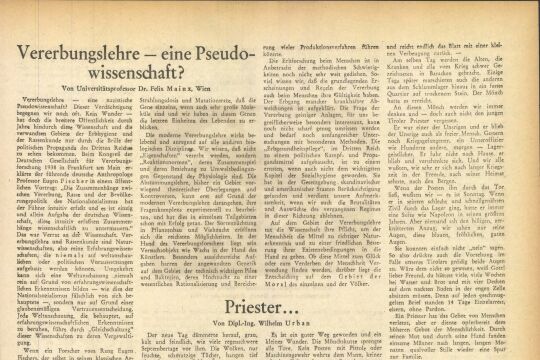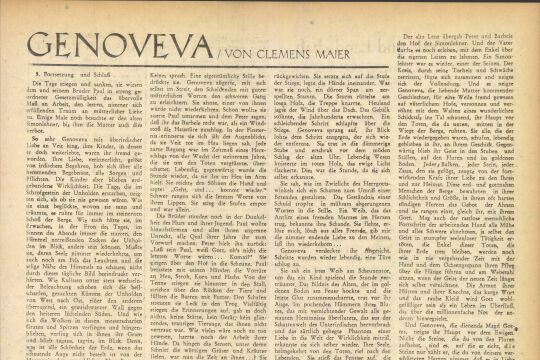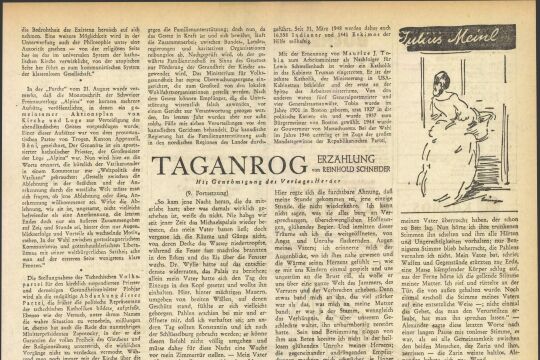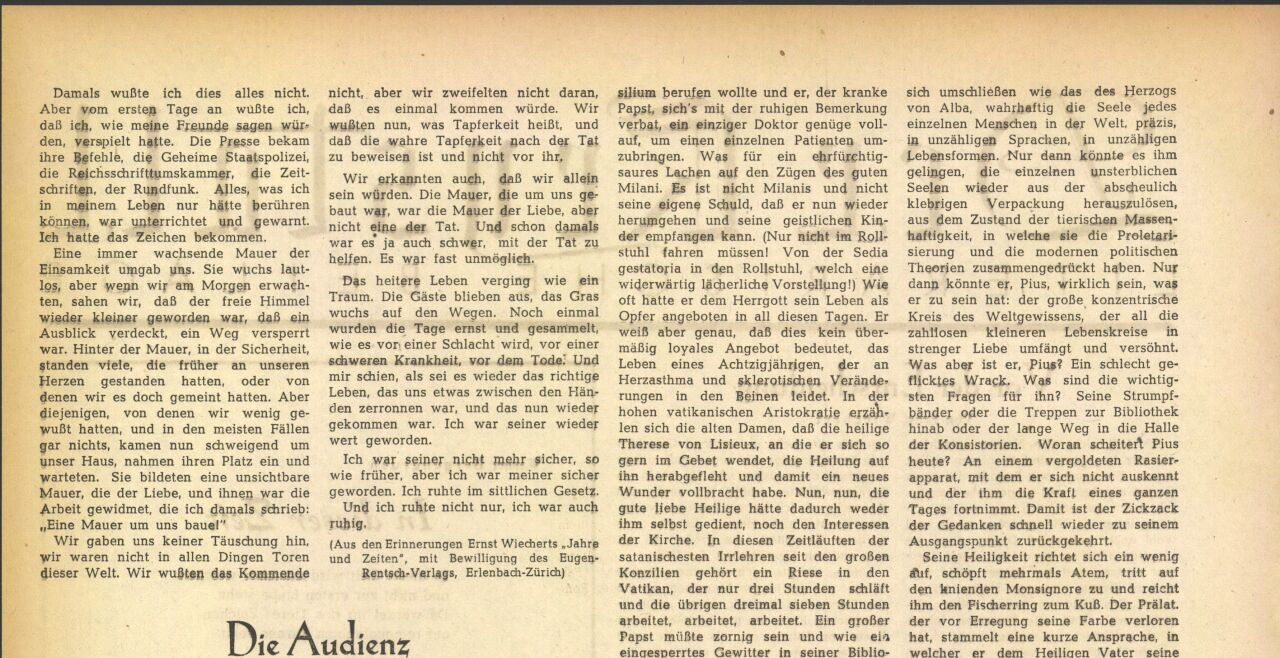
Der Morgen des 1. März 1870 stieg empor.
Meldende — nicht furchtsame — Stimmen riefen durch das kleine Lager der Paraguayer:
„Die Camba kommen!“
Der Feind hatte die vorgeschobenen Posten überrannt, die an den beiden einzigen Zugängen aufgestellt worden waren. Der Kampf mußte sehr kurz gedauert haben. Nachdem die Brasilianer den Übergang über den Aquidaban-nigui forciert hatten, drangen sie in Cerro Corä ein.
„Alle zu den Waffen!“ rief Lopez, der Marschall und Tyrann von Paraguay, während Oberst Centuriön zu den Scharfschützen eilte, um sich an ihre Spitze zu stellen.
Im nächsten Augenblick stieg der Marschall aufs Pferd. Die brasilianische Kavallerie rückte langsam vor. Von allen hohen und niederen Offizieren und Soldaten umgeben, wartete der Despot gelassen. Dieses Häuflein zerlumpter und hungernder Menschen dachte nicht an den Sieg. Hier war der Tod. Noch einige Sekunden, und es gab kein Heer mehr. Dessen einzige Aufgabe war es, mit dem Marschall in den Tod zu gehen, die letzte Handbreit paraguayischen Bodens zu verteidigen.
Schon waren die Brasilianer da. Hier und dort kleine, hastige Scharmützel. Alle Paraguayer sinken nieder, einer nach dem anderen. Mehrere Stabsoffiziere geraten in Gefangenschaft.
Lopez hat sich unterdes im Galopp zum Hauptquartier zurückgezogen. Centuriön, in diesen Augenblicken der eigentliche Befehlshaber der paraguayischen Truppen, ist verwundet. Einige Gesellen aus Rio Grande verfolgen Lopez. Er will zu Pferde den Pfad erreichen, auf dem man zu einem kleinen Arm des Aquidaban-nigui gelangt. Von ferne hat man den Fliehenden erkannt; in diesem Heer von Skeletten ist er der einzige Feiste.
An allen Stellen der Ebene fliehen nun die Paraguayer. In einem Wagen sitzt Madame Lopez mit ihren jüngeren Söhnen. Oberst Panchito, ihr ältester Sohn, auch noch ein Knabe, reitet neben ihr her. Der brasilianische Oberstleutnant Martins greift ihn an.
Und der Mann und der Knabe kämpfen miteinander. Madame Lopez kann nicht zusehen. Verzweifelt, wie von Sinnen, steigt sie aus dem Wagen. Jetzt ist sie nicht mehr die Ehrgeizige, die ein Guaranl-Kaiserreich anstrebte. Auch nicht die lasterhafte Frau mit den verbrecherischen Trieben. Nicht die, die ihren Mann bestimmte, die argentinische Republik zu überfallen, um sich an den Zeitungen von Buenos Aires zu rächen, die sich über sie lustig machten. Sie ist nur noch eine Mutter, die sieht, daß ihr Kind getötet werden soll.
Und bebend, mit ausgestreckten Armen, schreit sie aus voller Kehle: „Ergib dich, Panchito, mein Sohn!“
Aber Oberst Panchito fällt, mit einer Wunde im Rücken. Die Mutter stürzt sich über die Leiche, bedeckt sie mit ihren Kleidern und wendet sich schluchzend gegen die Feinde.
„Ich bin Engländerin! Respektiert mich!“
Andere sind ins Hauptquartier gedrungen. In dessen Nähe sitzt auf einem Karren ein Greis von achtzig Jahren. Ein Soldat droht ihm:
„Ergib dich!“
Der Alte ruft: „Mich ergeben? Ich?“
Und da er den Degen zieht, streckt ihn ein Schuß in die Brust für immer nieder. Es ist Sänehez, der Vizepräsident der Republik Paraguay.
Und so begegnet man an allen Stellen, wo gekämpft wird, ähnlichen Beispielen außerordentlichen Heldenmutes, der Gleichgültigkeit gegen den Tod. Hier ist es ein Knabe, dort ein Achtzigjähriger, anderswo wieder eine Frau. Fast jeder Paraguayer stirbt kämpfend. Manche freilich ergeben sieh, sobald sie erfahren, daß Lopez sie im Stich gelassen.
Anderswo verfolgen wieder die Eindringlinge die Paraguayer. In wirrem Durcheinander fliehen Männer, Frauen und Kinder. Die Riograndenser rennen sie wütend und jubelnd erbarmungslos nieder .
Aber schon haben die brasilianischen Kerle den Marschall eingeholt. Sie stehen vor ihm. Und ein Korporal aus Rio Grande, Jose Francisco Lacerda, mit dem Spitznamen „Kleiner Teufel“, versetzt ihm einen heftigen Lanzenstich. Doch mehrere Paraguayer kämpfen für ihren Befehlshaber und wollen seine Flucht decken. Der Marschall, der vom Pferde gestiegen ist, verschwindet im Gebüsch. Er ist schwer verletzt.
Zwei seiner Offiziere nähern sich ihm.
„Ich bitte euch, laßt mich. Ich will allein sterben.“
Er geht einige Schritte auf dem Pfad und kommt zu dem kleinen Arm des Aquidabän-nigui. Hier stürzt er am Ufer nieder. Seine Füße liegen im Wasser. In der Hand hält er noch immer den Degen.
Vor ihm steht jetzt eine Gruppe von Feinden. Einer davon ist General Jose Antonio Correa da Camara, ein Riograndenser. Der General da Cämara ist ein Prachtmensch — hochgewachsen, elegant, vornehm, von ruhig-melancholischem Wesen. Er ist herzleidend. Tapfer bis zur Tollkühnheit. Er hat großartige Phrasen, eines Romanen würdig. Der schwarze, feine Bart, die dunklen Augen, der weiße Poncho und der große Sombrero tragen dazu bei, seine Erscheinung noch wirkungsvoller zu gestalten.
General Cämara betrachtet den verwundeten Lopez. Endlich, nach fünf Jahren, ist der Jaguar der Guaraniwälder niedergestrecktl Hier liegt der furchtbare Mann, mit dem Willen eines Riesen, er, der aus dem Nichts ein Heer schuf, er, der mit Kanus Panzerschiffe angriff, er, der mit einer Handvoll Kinder, Krüppel und Frauen eine machtvolle Armee in Schach hielt. Hier liegt der geniale Feldherr, der den fanatischen Enthusiasmus des Pöbels zu wecken verstand. Hier liegt der bluttriefende Tyrann, der lieber den Tod aller Paraguayer wollte, als daß er von der Regierung zurückgetreten wäre. Hier liegt der Mörder seiner Brüder, seiner besten Generäle, tausender Soldaten und vieler tausend Frauen. Aus Liebe zum Vaterland hat er das Vaterland in den Untergang getrieben. Und um das Prinzip der völligen Unabhängigkeit zu wahren, hat er das ganze paraguayische Volk zu den furchtbarsten Leiden und zum Tode verurteilt.
„Ergeben Sie sich, Marschall“, ruft der brasilianische General ohne Hochmut, mit volltönender, freundlicher Stimme.
Und als Lrtpez die fast schon leblosen Augen mit grauem Blick zu ihm hebt, fügt Camara hinzu;
„Ich bin der brasilianische General, der die Truppen hier befehligt.“
In dem entschwindenden Geist Francisco Solano Lopez' mußte jetzt wohl jener Satz wieder aufblitzen, mit dem er einst dem General Bartolome Mitre geantwortet hatfe, als dieser ihn aufforderte, von der Regierung zurückzutreten, .vas eine unerläßliche Bedingung für den Frieden war, damals bei der Besprechung von Yataytl-Cora. „Das soll man von mir in meinem letzten Verteidj-gungsgraben in Paraguay verlangen.“ Und jener andere Satz, mit dem er den General der Triple-Allianz ruhig und wehmütig seinen Entschluß bekräftigte: „Wenn dem so ist, werde ich mit meinem Volke sterben.“ Er hat sein Versprechen eingelöst. Vom äußersten Süden Paraguays in Itapirii, am Fluß Pa-ranä, ist er als Verteidiger der heimischen Scholle bis zu den entferntesten Gebieten des Landes zurückgewichen. Er hat mit seinen Truppen und seinem Volk, Tausende und aber Tausende von Frauen und Kindern mitschleppend, viele, viele hundert Kilometer zurückgelegt. Und jetzt ist er an der äußersten Grenze Paraguays, vielleicht um sein Wort buchstäblich wahr zu machen, vielleicht um für die Großartigkeit der Augenblicke, die nun kommen, eine richtige Bühne zu finden.
Er liefert seinen Degen nicht aus. Er hat nicht an Übergabe gedacht. Alle jene, die in Gefangenschaft geraten sind, hat er als Verräter betrachtet, wenn sie wieder zum Heer stießen. Mag der Hunger noch so drückend sein, mögen die Kräfte schwinden, mag es keine Munition mehr geben, ein paraguayischer Soldat darf sich niemals in die Hände des Feindes liefern. Seine Pflicht ist es, zu sterben, das Sterben zu verstehen.
Und jetzt liegt Lopez hier, um zu erfüllen, was er von den anderen gefordert. Auch er ergibt sich nidit. Er will nicht das Leben. Er wird der Welt zeigen, daß er zu sterben versteht.
Und während er gegen den General Camara einen Degenstoß führt — den Stoß eines Sterbenden, schwach und wirkungslos —, spricht er die Worte:
„Ich sterbe mit meinem Land.“
General Camara hört in diesem Satz den ganzen Stolz des Mannes. Aus Stolz hat er zwei Nationen ins Unglück gestürzt, sein eigenes Volk vernichtet. Niemals hat er Einwände oder Ratschläge zugelassen. Jede andere Ansicht war ein Verbrechen. Sein zyklopischer Stolz verzieh es den Alliierten nie, daß sie ihm den Rücktritt von der Regierung diktieren wollten. Er war Paraguay. Und ohne ihn Frieden wollen, hieß Hochverrat begehen. Tausende von Paraguayern hat er füsilieren lassen, weil sie den Frieden und das Leben gewünscht haben, aber für ihn war der einmütige Wunsch des Volkes wertlos. Camara erkennt das alles, er sieht die tausende Hingerichteten, die mit Leichen übersäten Felder, die Frauen, die sich sterbend durch Gebirge und Urwälder schleppen.
Und voll Verachtung für diesen barbarischen, grausamen Tyrannen gibt er zweien seiner Soldaten den Befehl:
„Entwaffnet den Mann!“
Der tapfere General Camara kann keine Furcht empfinden, am wenigsten vor einem Sterbenden und vor einem Menschen, der nie selber gekämpft hat. Er würdigt ihn einfach dessen nicht, daß er ihn selber entwaffne. Und er wirft diese verächtlichen Worte hin, die Lopez gewiß schmerzlicher verwunden als der Lanzenstich des „Kleinen Teufels“.
Ein Soldat hält ihn an den Fäusten fest. Lopez weigert sich, den Degen herzugeben. Der dichtmähnige Kopf sinkt zweimal unter Wasser. Halb erstickt, kann er kaum noch atmen. Der Degen ist aus der schlaffen Hand gefallen, und krampfhaft zuckt Lopez, als ein Kavallerist, der herangelaufen ist, auf ihn schießt. Lopez wälzt sich zur Seite, aus Mund und Nase schießt Blut. Die Füße sind noch immer im Wasser. Der Körper liegt ausgestreckt da, hier am Ufer des Aquidabä“n-nigui.
Im nächsten Augenblick verbreitet sich die Nachricht, daß der Tyrann tot ist. Die Frauen und die Kinder, die das brasilianische Heer begleitet haben, überfallen die Equipagen des Marschalls und seiner Frau. Unter Geschrei, Gelächter, Beschimpfungen plündern sie die Wagen .
Der Tote, dem hohe und niedere Offiziere folgen, wird inzwischen, an einer langen Stange hängend, ins Lager der Brasilianer getragen.
Kurz nach der Ankunft im Lager fand die Beerdigung statt. Man ließ seine Frau dazu. Sie trat an die Leiche und blickte sie lange an. Sie sprach kein Wort und weinte auch nicht. Sie hatte gebeten, man möge Lopez mit seinem Sohn begraben. Sie wollte sich eine Handvoll Haare ihres Mannes aufheben. Ein Soldat schnitt ihr eine Strähne ab und andere Büsdiel für sich selbst und seine Freunde.
Schon lag der Jaguar unter der Erde. Niemand beweinte ihn. Seine Offiziere und seine Soldaten empfanden große Irleichterung, als sie von diesem Ende erfuhren. Niemand beweinte den Mann, der ganze Familien, die größere Hälfte der Bevölkerung Paraguays, dem Tod durch Erschießen oder durch die Lanze oder durch Hunger preisgegeben hatte. Niemand beweinte ihn ... niemand, nur eine alte Frau dort am Aquidaban-nigui. Bitterlich schluchzte die Siebzigjährige, bitterlich und trostlos. Es war Dona Juana Carillo de Lopez. Es war seine Mutter. Er hatte ihr den Prozeß gemacht, er hatte ihr den Mate und die kleinen Freuden des Greisenalters entzogen, er hatte sie zum Tod verurteilt. Und sie war der einzige Mensch, der ihn beweinte.
Ihre Tochter Rafaela sagte ihr.
„Warum weinen Sie, Mutter? Sehen Sie denn nicht ein, daß dieser Mensch niemals ein Sohn oder Bruder gewesen ist? Daß er nichts anderes auf Erden war als ein Ungeheuer?“
Im brasilianischen Heer und unter den paraguayischen Frauen wollten der Jubel und die Freude kein Ende nehmen.
Fünf Tage später taumelte Asuncion in einem Fieberrrausch der Freude. Scharen von Männern und Frauen veranstalteten Umzüge durch die Straßen. Statt Fahnen trugen sie ihre Mäntel oder Ponchos an Stangen. Diese Fahnen gingen während des Marsches ui)d beim Spiel der improvisierten Musikkapellen unter frenetischem Geschrei von Hand zu Hand. Die Familien, die jetzt schon in ihren Häusern wohnten, traten vors Tor und an die Fenster, um die Bandera-yere zu sehen, wie man diese Manifestationen nannte. Die Hände klatschten sich wund, und aus jedem Mund sprühten Schreie. Viele Familien schlössen sich der begeisterten Menge an. Die Fenster schmückten sich mit Blumen. Auf den Straßen platzten Knallfrösche, während die Schiffe des alliierten Geschwaders den Spiegel des Flusses mit ihren Salven erzittern machten und die gelassene Ruhe der Kirchenglocken durch die Luft bebte. Musikkapellen, Böllerschüsse, Extraausgaben der einzigen Zeitung. Und Tanz am Fluß, Tanz auf Tden Plätzen, auf den Straßen, beim Klang der Ziehharmonika, der Geige, der Harfe oder der dumpfen, eintönigen Gomba. Die Häuser bedeckten sich mit Fahnen. Die Leute lachten, hüpften, tanzten, und sie weinten auch, aber vor Glück.
So feierte Asuncion in dionysischer Freude den endlichen Sieg über den Tyrannen Francisco Solano Lopez.
(Aus dem Roman „Lopez“ mit Bewilligung des Paul-Zsolnay-Verlages, Wien)