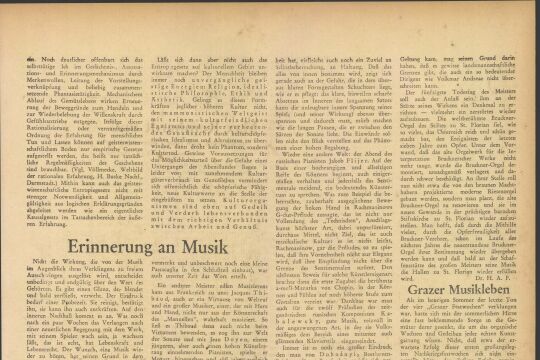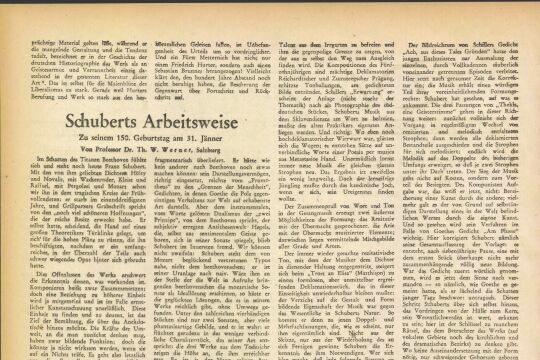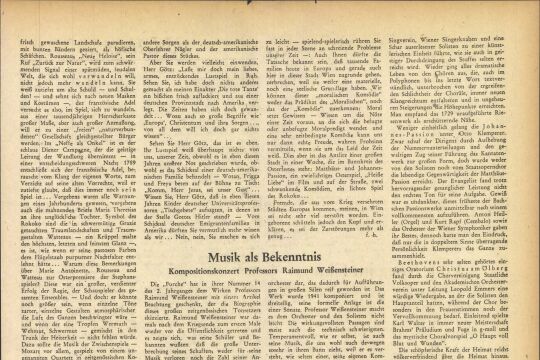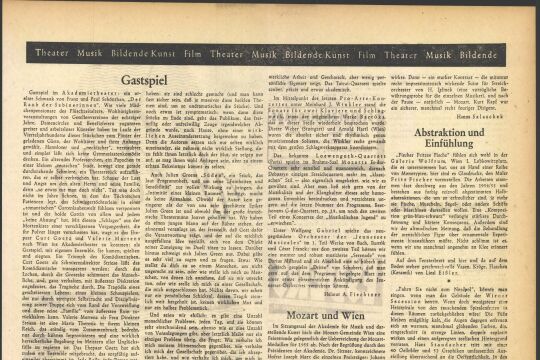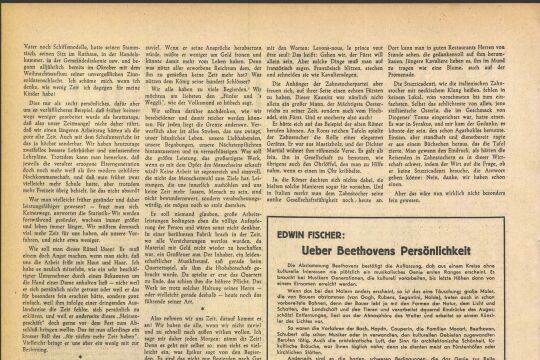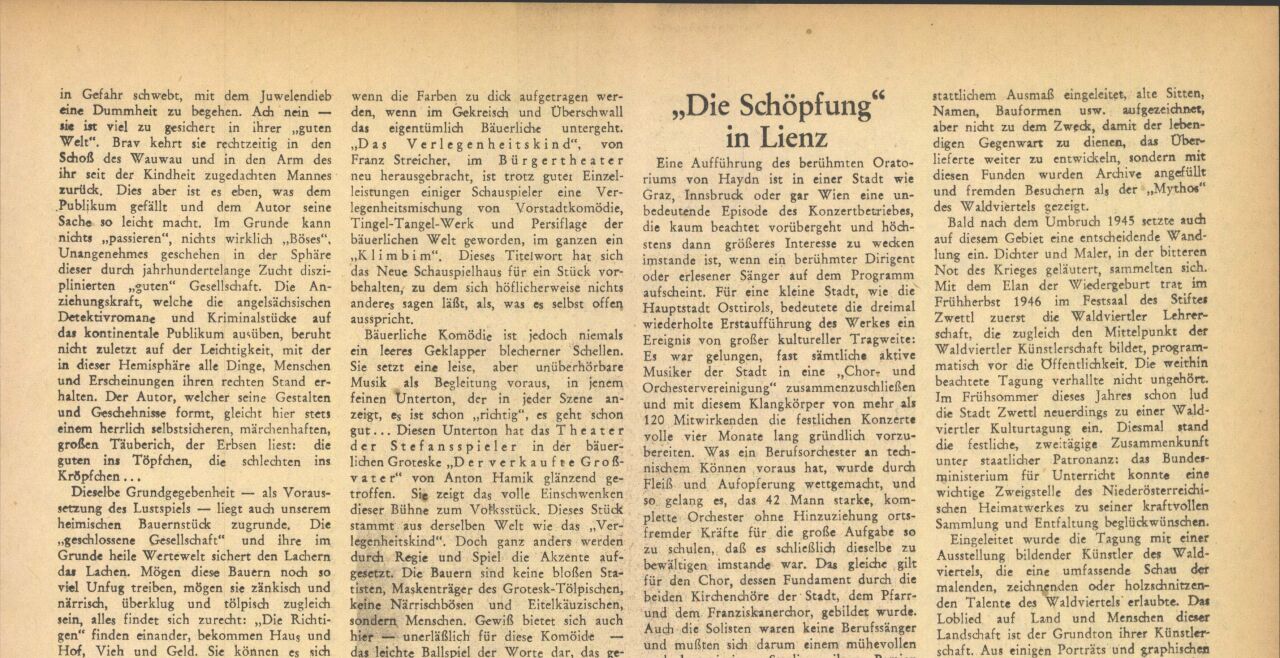
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Botschaft des Erbes
Drei Abende klassischer Musik waren in das Programm des modernen Musikfestes eingereiht. Ihren Sinn finden wir wohl nicht darin, daß sie uns zeigen sollten, inwieweit die Entwicklung von dem gültig, eben „klassisch“ Gewordenen und für Generationen gültig Gebliebenen weg- und weitergeführt hat; wäre es so gemeint gewesen, hätte man es auf einen historischen, lehrhaften Zweck abgesehen gehabt, dann hätte der bestrittene und wieder geliebte Werkbestand des eigentlichen „neunzehnten Jahr-derts“ in wesentlichen Proben dargestellt werden müssen; so wäre der Weg in unser Jahrhundert beleuditet worden.
Beethoven, Schubert haben an Kraft und Wirkung, an Größe und Bedeutung nicht verloren. Ja, ihr Werk hat gerade dadurch, daß es auch für uns bei jeder Begegnung die Elemente des Neuen mit erstaunlicher Plastik aufweist, über gewohnte und vertraute Gültigkeit hinaus seine Dauerkraft zu uns spredien lassen. Wie „neu“ ist doch immer wieder Schuberts nachgelassenes d-moll-Quartett mit seinen Zügen wilder Kraft, die für den Zeitgenossen, hätte er ei noch zu Schuberts Lebzeiten hören können, etwas aufrüttelnd Unheimliches haben mußte, nichts ander als Beethovens vom glatt „Schönen“ sich so jäh abwendendes Temperament, als Mozarts für die Ohren von damals „atonale“ Einleitung zum Dissonanzen-Quartett! Denn das, was der behagliche Genießer als „melodiös“ schätzt, liegt allzu leicht im schillernden Schein des Mißverständnisses. Sdiuberts Süße, Mozarts Grazie sind Blüten eigensten Duftes. Aber in der Wertreihe der Düfte irrt sich so manche Nase, sie fühlt nur das Angenehme, nicht das Besondere. Mancher verwechselt dal Schöne mit dem Gefälligen, die reine Empfindung mit trüber Sentimentalität. Wie viel Hübsches, das den Zeitgenossen ebensogut, ja nodi besser gefiel als Mozart, als Schubert und gar als Beethovens durch den Filter ringenden Leides schmerzlich gewonnene vergeistigte Schönheit, ist längst verwelkt, duftlos geworden! Nicht auf die Glätte, niöit auf die Gefallsamkeit kommt es an, sondern auf die Kraft, die den schönen Schein zum wahren Sein steigert.
So sagt uns die Musik der klassischen Meister die Botschaft der Kraft, der Wahrheit des Müssens, nicht der Gefälligkeit des F.rklingens aus; so manchem mag ja heut das klassische Werk, längst vertraut und 'mmer wieder gehört, nur Beruhigung, Erholung bedeuten. Was uns die Meister der Vergangenheit zu sagen haben, das ist die Botschaft ihrer Gegenwart, ihrer Gegenwärtigkeit: wie eh und je ist die Kunst ein Lebenskampf, nicht ein Gesellschaftsspiel. Wieviel Ringen verbirgt sich hinter scheinbar glücklichem Gelingen! Dies ist es, was daj große Erbe uns zu sagen hat. Nach hundert Jahren klingt uns so viel selbstverständlich, was die Zeitgenossen mit Kopfschütteln und Murren angehört haben. Daß es auch vor hundert Jahren Experiment und Irrweg gegeben hat, das wissen heute nur mehr die Historiker. Was nur Experiment und nicht Ringen gewesen ist, gehört der Vergangenheit an. Das Suchen ist Schicksal und hat seinen Sinn im Spiel der Kräfte. Das Finden, das Gelingen, das Erringen ist der Lohn der Meister und sichert ihnen Gegenwart auch nach hundert Jahren.
Solches gaben die drei Abende klassischer Musik im Zusammenhang der Musikfesttage zu denken, zu fühlen. Mit Schuberts d-moll-Quartett und C-dur-Quintett gab das Konzerthaus-Quartett in denkwürdig sdiöner, spannungsreicher und ausgeglichener Wiedergabe den beglückenden ersten Beitraf. Mit Violinsonaten von Beethoven setzten Schneiderhan und Aeschbacher dies kleine wienerische Fest in vornehmer Form fort, und es klang mit Klaviersonaten von Beethoven, die Aeschbacher spielte, nicht minder bedeutend aus. Was das Konzerthaus-Quartett und Sdineiderhan als Geiger von hoher Kultur und der rechten Einfühlung in den Stil klassischer Ausgeglidienheit boten, war Quintessenz wienerischen Musizierens. Adrian Aeschbacher, der ausgezeichnete Schweizer Pianist, hat zunächst das Verdienst, als Schneiderhans Partner, sich einfühlsam dem Wiener Stil angepaßt zu haben. Sein eigener Abend ließ seine expressive, wohl von Edwin Fischer herkommende Art, deutlich und doch nidit vom Wiener Stil sich entfernend, ihr Wort sprechen. Nicht immer im ganzen, aber in vielen fesselnden Einzelzügen erzielte Aeschbacher eine starke und innerliche Wirkung. Dabei wechselt ein härterer Ton mit bezaubernder Anmut des Anschlags; ein spielerisdies Moment madit sich geltend, das etwa im munter fließenden Finale der As-dur-Sonate op. 26 das glückhafteste, rein und voll überzeugende Gelingen erreichte. Vorher aber war der herrliche Trauermarsch der gleichen Sonate zur ganzen Tiefe seiner Wirkung gebradit worden. So bestätigte sich an der Darstellung des Beethovenchen Doppelwesens von Tiefe und spielender Lebenskraft Aeschbadiers Berufenheit zum Beethoven-Spiel.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!