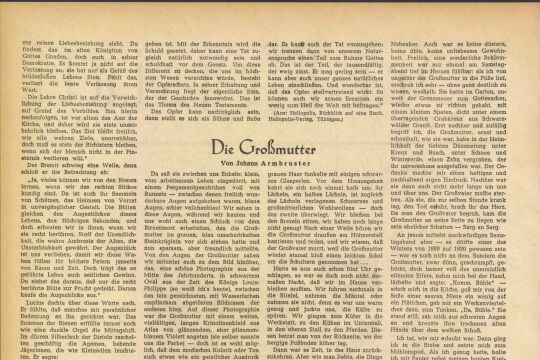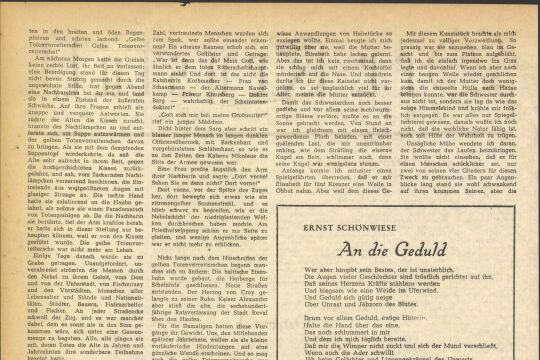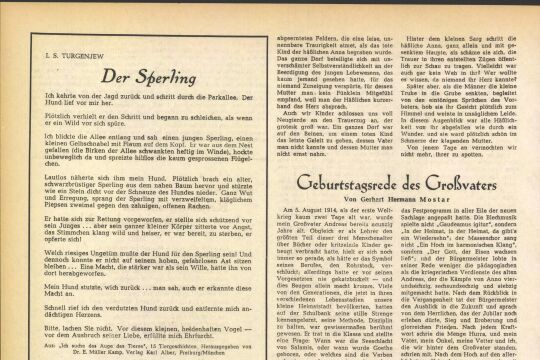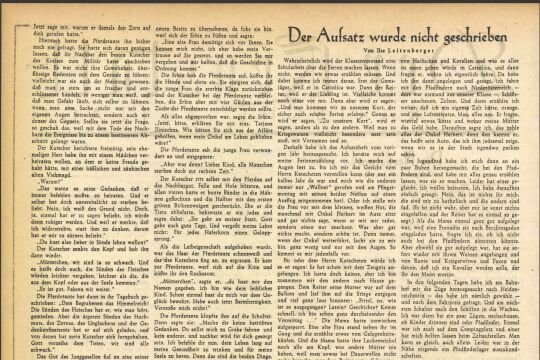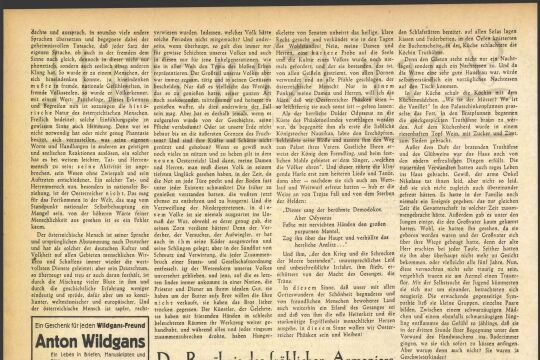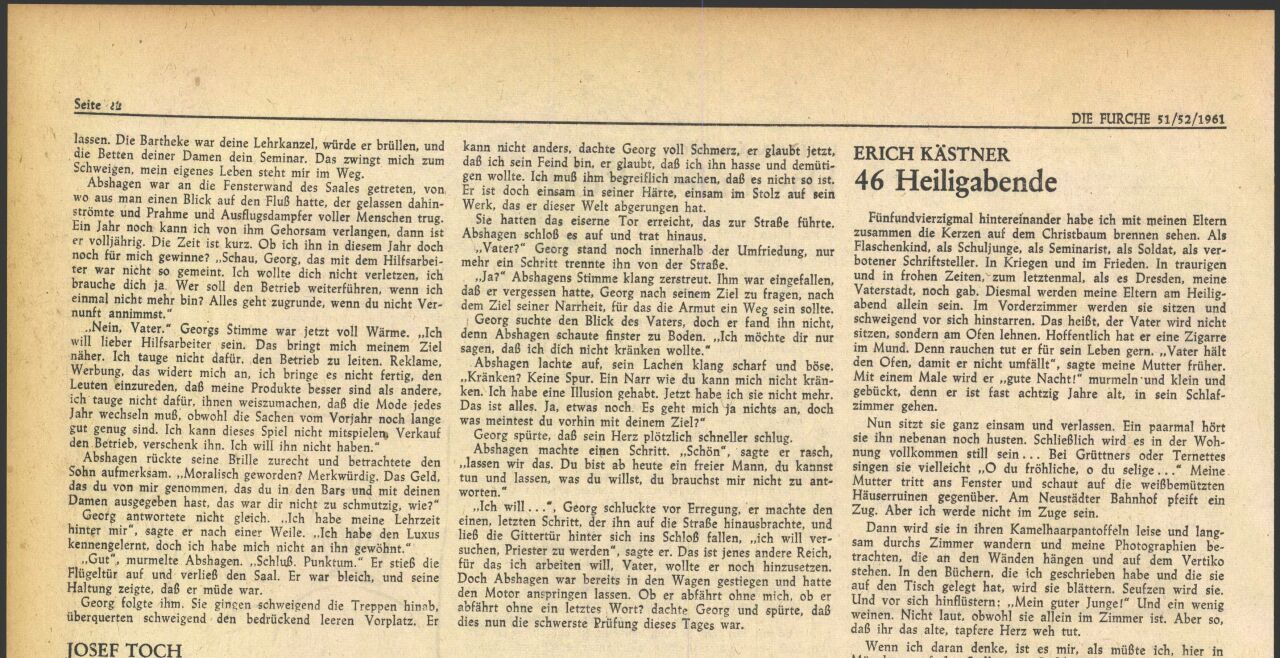
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Gans von Nikolsburg
Wenn Weihnacht kommt, wo soviel geschenkt wird, fällt mir immer mein Großvater ein, der wie keiner um die große Kunst des Schenkens wußte. Dabei war er nur ein kleiner jüdischer Handelsmann und kaum imstande, ein großer Spender zu sein. Sein Büro war ein kleines abgegriffenes Notizbuch, und sein Geschäftsladen der große Leinwandsack, in den er die Hasenfelle und Hühner- und Gänsefedern stopfte, die er bei den Bauern in der Umgebung von Nikolsburg einhandelte. Wenn er mit dem schweren vollen Sack von seiner Wanderung nach Hause kam und den Einkauf ausleerte und sorgfältig sortierte und aufstapelte, umstanden wir Kinder ihn voll Spannung; wir glaubten immer, daß der Sack etwas Besonderes enthalten könnte — aber es waren ewiglich nur Hasenfelle und Federn. Großvaters Geld reichte nur für ihren Einkauf. Wenn er aber beim Großhändler abgeliefert hatte, langte der Unterschied zwischen dem, was er von diesem bekam unJ dem, was er den Bauern gegeben hatte, gerade fürs nackte Leben für ihn und seine Frau und neun Kinder. Als die heranwuchsen und sich zu erhalten und zu heiraten und Kinder zu bekommen anfingen, hatte der Großvater deshalb auch nicht‘mehr Geld. Wenn man ihn fragte, Woher das käme,1 sägte'er immer nur; „Es tut nicht gut, Geld anzusammeln.“ Er verstand es auf zweierlei Weise, Geld von sich fernzuhalten. Zuerst hatte er auf die übliche Methode verzichtet, mit der arme Leute sich zuweilen imstande setzen, das, was man in der Volkswirtschaft „ursprüngliches Kapital“ nennt, zu akkumulieren: die eigenen Kinder für sich arbeiten zu lassen. Der Großvater sah darauf, daß sie lernten und das Gymnasium besuchten und Ärzte und Juristen wurden. So war’s zuerst gewesen. Später gab er sich völlig einem Laster hin: dem Schenken. War er bei den Wohlhabenden als „unpraktischer Mensch“ bekannt, so sprachen weit über Nikolsburg hinaus jene Juden, die noch ärmer als er waren, so daß sie einen Beruf daraus machten — die Schnorrer —, wenn sie einander über Land trafen und berieten: „Und in Nikolsburg nicht zu vergessen auf Moische Leb Toch. Er gibt nicht viel, aber er gibt. Vor der Frau muß man sich in acht nehmen; sie ist eine scharfe!“
Der Großmutter Erklärung hierzu lautete: „Wenn ich nicht wäre, würdest du uns die Betten unterm Leib wegschenken.“ In der Tat fand der Großvater, wenn er kein Geld oder keine Lebensrnittel herzugeben hatte, dennoch immer etwas im Haus, das sich einem Schnorrer schenken ließ: ein Stück Inlet oder ein Bündel Wollgarn oder ähnliches, das er aus dem Kasten der Großmutter stahl. „Irgend etwas wirst du schon dafür bekommen“, pflegte er dabei dem Beschenkten zu sagen. Wenn ihm darnach die Großmutter vorwarf, daß er Dinge herschenkte, die man selber so dringend brauche, sagte er: „Wenn man gibt, muß man spüren, daß man gibt.“ So war es in unserer Familie umgekehrt wie sonst im Leben, wo man vorherrschende Härte durch Mildtätigkeit auszugleichen versucht. Der Großmutter lag aber anscheinend weder an ihrem Ruf als böser harter Frau noch an dem des Großvaters als guter Mensch. Sogar in der Nikolsburger Christengemeinde war es bekannt, und trotz deren sonst so strenger Trennung von der jüdischen Kommunität scheuten sich christliche Bittgänger nicht, beim Großvater vorzusprechen. Die jüdischen Schnorrer sahen es mit finsteren Gesichtern; sie kamen sich dadurch zu Unrecht verkürzt vor — um so mehr, als sie es unter ihrer Würde befunden hätten, „zum Goj“ schnorren zu gehen.
Und nun zur eigentlichen Geschichte. Sie passierte an einem Weihnachtsabend, der in jenem Jahr an einen Freitag gefallen war. Freitagabend aber wurde. bei den Großeltern immer mit einem feierlichen Schabbesmahl begangen, an dem sämtliche Kinder und Schwiegertöchter und -söhne, und Enkel teilzunehmen pflegten. So auch an jenem Schabbes. Die ganze große Familie saß erwartungsvoll — von einem Ende der Stube zum anderen — um den durch einen zweiten verlängerten, weißgedeckten Tisch, indessen die Großmutter Schüssel um Schüssel hereinbrachte. Sie gestattete niemandem, ihr dabei zu helfen: am Schabbes mußte es würdig und ohne Gelaufe und Gedränge zugehen.
Da nun alle so um den Tisch saßen und die Großmutter immer noch ein- und ausging, zupfte ein Enkelkind den Großvater am Ärmel und deutete auf eines der Fenster des ebenerdigen Raumes. Draußen stand ein Mann. Er stand unbeweglich im Schnee da und schaute intensiv durch das Fenster auf den Großvater. Jeder wußte sofort, daß es ein Bittgänger war; sie stellten sich immer vors Fenster, um die Aufmerksamkeit des Großvaters auf sich zu lenken; an die Haustür zu klopfen, wagten sie nicht; da hätte die Großmutter öffnen und sie fortschicken können. Als nun mein Großvater den Draußenstehenden bemerkt hatte, winkte er ihm allsogleich heftig zu, er möge ja nur warten und nicht Weggehen, er könne sicher sein, etwas zu bekommen. Der Familie bedeutete der Großvater durch den Finger vor dem Mund, nichts zu verlauten. Kurz darnach kam die Großmutter wieder herein und brachte die Hauptspeise des Abends, eine riesige gebratene Gans auf einer großen Porzellanplatte. Die stellte sie vor den Großvater, damit er als Hausvater den Vogel tranchiere. Kaum war die Großmutter wieder hinausgegangen, um noch Zuspeisen und Salat zu holen, da ergriff der Großvater die Schüssel mit der Gans und eilte zum Fenster, das vergittert war. Er öffnete es hastig und zwängte sodann mit aller Kraft die Gans durch das Gitter dem draußenstehenden Annen entgegen. Als das geschehen war, winkte er ihm zu, zu verschwinden. Die leere Porzellanplatte schob der Großvater unter einen Schrank und setzte sich eilends wieder an den Tisch. Alle Söhne und Töchter und Schwieger- und Enkelkinder blickten mit aufgerissenen Augen auf den Alten, dessen dichter roter Vollbart zwar ein Lächeln verhüllte, dessen zwinkernde Augen es jedoch verrieten.
Dann kam die Großmutter wieder herein. Während sie mehrere Schüsseln auf den Tisch stellte, fragte sie nebenhin den Großvater: „Warum teilst du die Gans nicht aus?“
„Ich Lab’ sie schon ausgeteilt“, sagte der Großvater.
Die Großmutter blickte um sich und auf die leeren Teller und sagte: „Wo? Was?“ An der Schnelligkeit, mit der sie erfaßte, was geschehen war, konnte man erkennen, wie lange sie schon mit dem Großvater verheiratet war. Sie setzte sich ganz langsam auf einen Sessel und sagte kein Wort. Dann blickte sie verloren einen nach dem anderen an. Eines der Enkelkinder fühlte sich dadurch veranlaßt, zu sagen: „Es war einer aus Unter-Tannowitz, denen die Häuser abgebrannt sind. Die gehen jetzt überall absammeln."
„Ja … aber ..fragte sie immer noch benommen, „warum die Gans?“ Sie begann sich zu erlangen und schoß dem Großvater die Worte blitzschnell, wie Pfeile, ins Gesicht: „Und was sollen wir jetzt essen?"
„Ich sehe noch genug gute Sachen hier herumstehen", sagte der Großvater, „herausgebackene Erdäpfel und Rotkraut undᾠ" „Rotkraut und Erdäpfel!“ schrie die Großmutter, „und das soll unser Schabbesessen sein!"
„Schau“, sagte der Großvater schmeichelnd, „Schabbes ist jede Woche, aber Weihnachten ist nur einmal im Jahr.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!