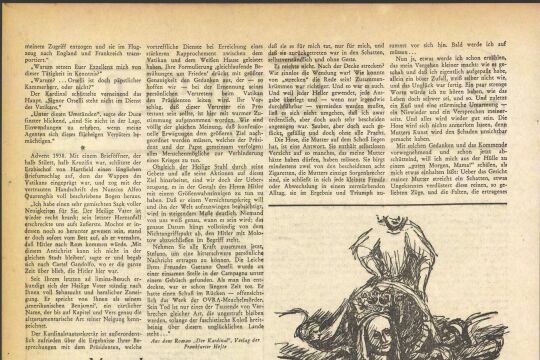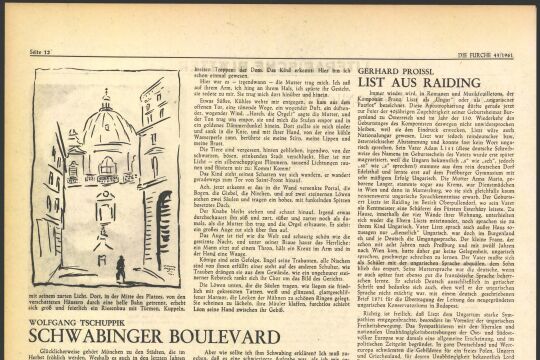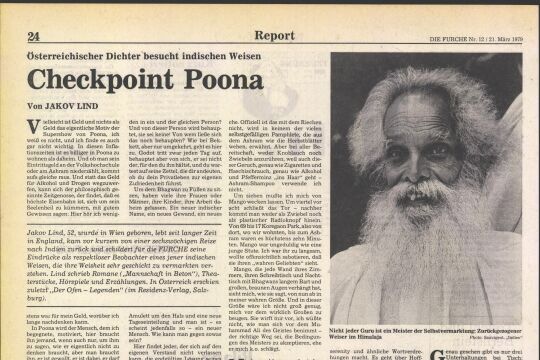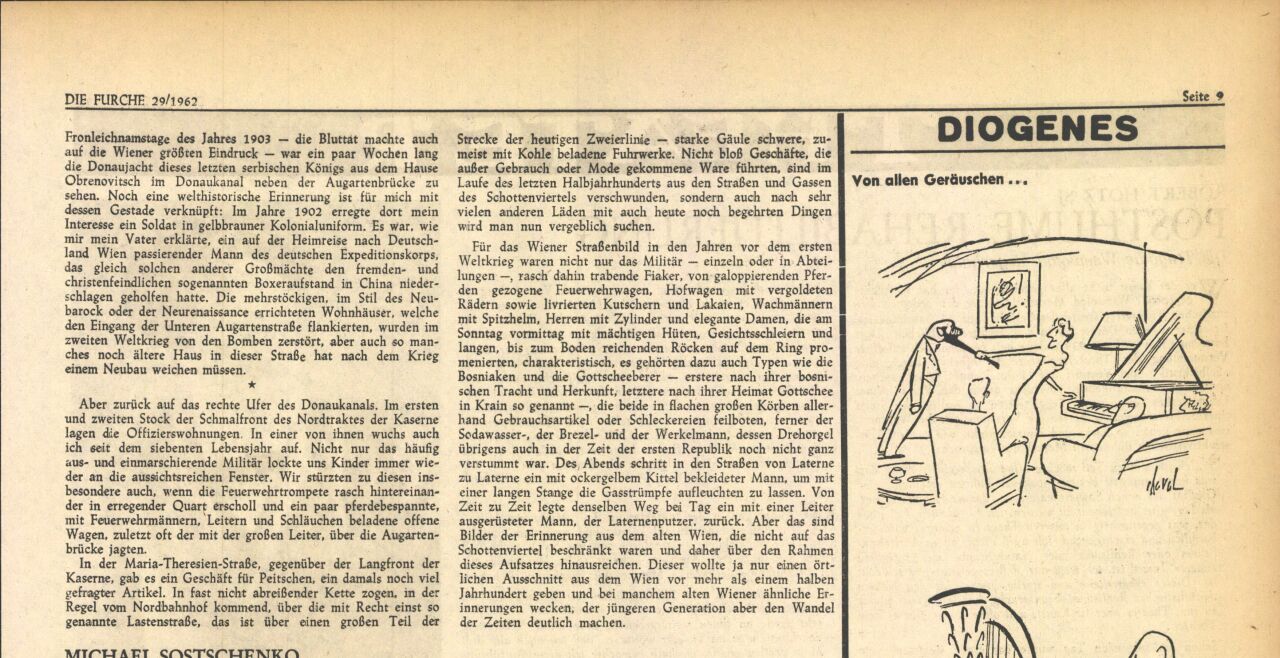
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ein Augenblick bei der Probe
Viele Dramatiker erfreut es, den Aufführungen ihres eigenen Stückes beizuwohnen. Abend für Abend findet man sie in den Garderoben herumlungern, und wenn sie entdeckt und gestellt werden, so tun sie, als müßten sie dem alten Kunze beistehen, der den Arzt spielt, oder als müßten sie entscheiden, ob der zweite Akt am Ende etwas gekürzt werden könnte. Aber — gesegnet seien ihre Herzen! — in Wirklichkeit sind sie dort, um sich zu erfreuen. Nun gehöre ich nicht zu diesen Dramatikern. Sobald ein Stück reibungslos verläuft, halte ich mich ihm möglichst fern. Einer der Gründe dafür ist, daß ich die Inszenierung während der Proben so aufmerksam verfolgt und mir die ersten Aufführungen so sorgfältig angesehen habe, daß ich des Stückes überdrüssig bin und an etwas anderes denken möchte. Wenn es sich um ein ernstes Stück handelt, werde ich eher von ihm irritiert als ergriffen. Wenn es sich um eine Komödie handelt, so bringen der Anblick und das Geräusch des lachenden Publikums mich nicht auf den Gedanken, was für ein feiner komischer Kerl ich bin, sondern erwecken in mir ein Gefühl des Abscheus. Daran finde ich also keine Freude. Die stellt sich früher ein, an irgendeinem Punkt bei der Probe. Nach den ersten Leseproben, die eher interessant als erfreulich sind, hat man mit Gebärden- und Mienenspiel zu kämpfen, und die Schauspieler legen ihre Rollen beiseite und versuchen, sich ihre Texte zu merken; und das alles ist für den Autor etwa so, als führte er eine Gruppe Touristen über Kleisterfelder. Aber dann kommt, wenn man Glück hat, der Augenblick, da — plötzlich, wie durch ein Wunder — das Stück lebendig ist. Es gibt kein Bühnenbild, keine Beleuchtung, keine Kostüme, keine Schminke, keine Effekte, kein Publikum, und doch ist das Stück vielleicht lebendiger, als es je wieder für einen sein wird. Man vergißt, daß man immer noch mit Stühlen und Apfelsinenkisten und Kreidestrichen auf einer leeren, nur von einer grellen Glühbirne beleuchteten Bühne herumwurstelt. Man vergißt, daß die Putzfrauen in den oberen Galerien schwatzen und Krach machen und daß die leeren Flaschen klirrend aus der Foyerbar entfernt werden. Man vergißt den donnernden Verkehr draußen. Man vergißt, daß das Theater einem nur bis fünf Uhr zur Verfügung steht und daß man immer noch kein eigenes Theater hat. Man vergißt all diese Dinge, weil ein Wunder geschieht. Der Regisseur und sein Assistent, die an ihrem üblichen Tisch sitzen und Bemerkungen in ihr Textbuch kritzeln, verschwinden aus dem Gedächtnis. Das fürchterliche „Arbeitslicht“ existiert nicht mehr; seltsame Morgendämmerungen und Sonnenuntergänge erscheinen. Kalkstriche und Apfelsinenkisten werden zu perfekten Wänden und Tischen und Sofas. Fräulein Soundso, in ihren schäbigen Kleidern, jedenfalls mit ihrer schäbigen Frisur, mit verhärmten Gesichtszügen und gelbem Teint, verwandelt sich plötzlich in die schöne Gestalt der eigenen Phantasie. Der junge Dingsda — bisher ein Tölpel, eine schlechte Besetzung — taucht jäh sprühend als heiterer und hübscher Herzensbrecher auf. Der alte Wer-ist-Das, der ein Fehlgriff zu sein schien, vielleicht nur weil er zuviel trinkt und keine einzige Zeile behalten kann, ist nun der liebenswürdige alte Schmidt bis zum letzten Fältchen und Kichern. Und was für ein Pathos — was für eine Komödie — was für eine Spannung — was für eine Lebensechtheit — was für ein tiefer Symbolismus! Ja, das ist es — wie man es sich zuerst vorgestellt hat — nein, besser — viel besser — oh, herrlich! Einige Minuten; aber so lange sie anhält, diese Verwaltung — welche Freude!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!