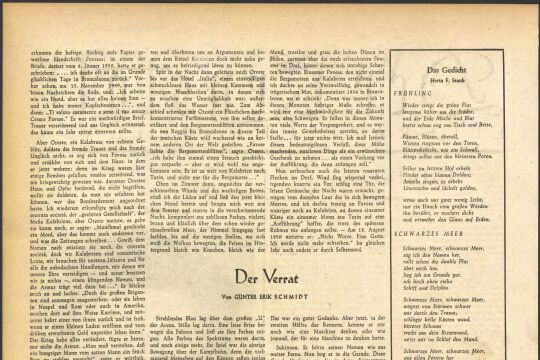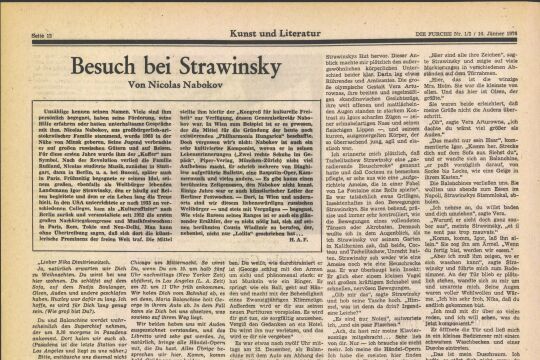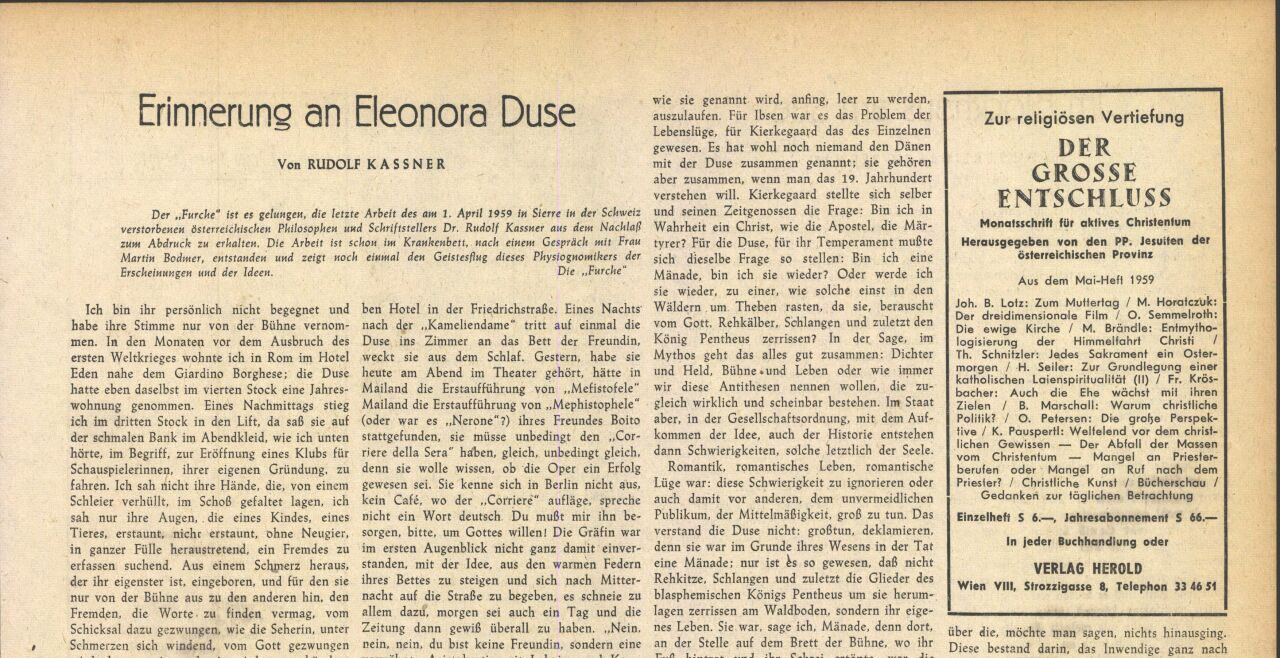
Erinnerung an Eleonora Duse
Der „Furche“ ist es gelungen, die letzte Arbeit des am 1. April 1959 in Sierre in der Schweiz verstorbenen österreichischen Philosophen und Schriftstellers Dr. Rudolf Kassner aus dem Nachlaß zum Abdruck zu erhalten. Die Arbeit ist schon im Krankenbett, nach einem Gespräch mit Frau Martin Bodmer, entstanden und zeigt noch einmal den Geistesflug dieses Physiognomikers der Erscheinungen und der Ideen. Die „Furche“
Der „Furche“ ist es gelungen, die letzte Arbeit des am 1. April 1959 in Sierre in der Schweiz verstorbenen österreichischen Philosophen und Schriftstellers Dr. Rudolf Kassner aus dem Nachlaß zum Abdruck zu erhalten. Die Arbeit ist schon im Krankenbett, nach einem Gespräch mit Frau Martin Bodmer, entstanden und zeigt noch einmal den Geistesflug dieses Physiognomikers der Erscheinungen und der Ideen. Die „Furche“
Ich bin ihr persönlich nicht begegnet und habe ihre Stimme nur von der Bühne vernommen. In den Monaten vor dem Ausbruch des ersten Weltkrieges wohnte ich in Rom im Hotel Eden nahe dem Giardino Borghese; die Duse hatte eben daselbst im vierten Stock eine Jahreswohnung genommen. Eines Nachmittags stieg ich im dritten Stock in den Lift, da saß sie auf der schmalen Bank im Abendkleid, wie ich unten hörte, im Begriff, zur Eröffnung eines Klubs für Schauspielerinnen, ihrer eigenen Gründung, zu fahren. Ich sah nicht ihre Hände, die, von einem Schleier verhüllt, im Schoß gefaltet lagen, ich sah nur ihre Augen, . die eines Kindes, eines Tieres, erstaunt, nicht erstaunt, ohne Neugier, in ganzer Fülle heraustretend, ein Fremdes zu erfassen suchend. Aus einem Schinerz heraus, der ihr eigenster ist, eingeboren, und für den sie nur von der Bühne aus zu den anderen hin, den Fremden, die Worte - zu finden vermag, vom Schicksal dazu gezwungen, wie die Seherin, unter Schmerzen sich windend, vom Gott gezwungen wird, das, was ist und sein wird, zu verkünden. Ich hatte eine Zeitlang wohl unter dem Einfluß Schopenhauers gewisse Schwierigkeiten mit dem Wort, mit dem Begriff Seele. Hier in diesem Blick der Duse war die Seele wie aufgedeckt, aufgelegt.
Wir hatten viele Freunde und Bekannte gemeinsam, in den Jahren vor dem Kriege auch Rilke. Er wußte auf seine humorvolle Weise zu erzählen, wie er einmal im Frühjahr in Venedig an einem sonnigen Nachmittag mit der allergrößten Sorgfalt in einem Hotelgarten bei Torcello einen Tee für die Duse arrangiert hatte, für sie und für ihre Freundin, eine Dichterin mit einem Stück, das die Duse mit allen Mitteln aufgeführt wünschte irgendwo. Beide kamen in einer Gondel angefahren, hatten sich um den mit allerlei Köstlichkeiten wohlversehenen Tisch gesetzt, da ertönte urplötzlich von nebenan der Schrei eines Pfaus, scharf, sinnlos scharf, die Duse erhebt .sich voll Entsetzens über den ihr tVidrigen Laut des Vogels, der zu allem dazu imf Augenblick auf der Gartenmauer mit seinem bunten Schweif ein Rad zu drehen begann, stößt selber einen ihrer von der Bühne her berühmten Schreie aus, eilt zur Gondel, die Freundin ihr nach, Rilke fassungslos beim vollgedeckten Teetisch allein zurücklassend.
Es soll stets mit Schwierigkeiten verbunden gewesen sein, für sie ein Frühstück im Hotel zu bestellen; sie kam wohl zur verabredeten Stunde, aber alle Speisen, über die man sich mit ihr am Tag vorher geeinigt hatte in ihrem Sinn, mußten, da ihr das Menü vorgelegt wurde, umgeändert werden. „Mai ho mangiato un polio" oder was immer usw. Wenn ein Gast am Nebentisch sich eine Zigarette anzündete, stand sie auf und verließ den Saal. Mit solchen und ähnlichen Sek- katuren, meinten die Freunde und Bewunderer beider, der Duse und Gabriele d’Annunzios, rächte sich die große Schauspielerin am Dichter, an dessen Betrug, der vorauszusehen war.
Ich hätte sie einmal in Duino treffen sollen, bin aber weggeblieben, da ich hörte, daß d An- nunzio mit ihr käme. Was gewiß dumm von mir war. Lord Vansittard nennt d’Annunzio „the most outstanding cad". Die gleiche Ansicht wurde wohl auch von anderen geteilt. Das ist es nicht. Cad, unübersetzbar, ist das Gegenteil des Gentlemans. D’Annunzio war ein Virtuose in allem, an den Rändern ungenießbar.
Ich bin ihm vor dem Kriege in Paris bei irgendwelchen Empfängen das eine oder andere Mal begegnet. Mir fielen am meisten an ihm in seinem mit allen Wässern, Essenzen kahl und kugelglatt gewaschenen Gesicht und Schädel die blauen großen Augen auf mit einem weichen Blick, zweien Spiegeln gleichend, die einen Sprung mitten durch bekommen hatten. Sein Gesicht war häßlich, die Frauen, sagte man, erlägen aber seiner Stimme. Zu einem Diner, das Boni de Castellane dem Dichter zu Ehren gab, stieg er aus seinem Auto mit der kleinen schwarzen Maske, wie sie im alten Venedig getragen wurde, sooft man nachts in der Gondel ins Theater, in den Spielsaal fuhr, zu einem Rendezvous mit der Geliebten.
Die Duse hatte in allen Ländern Europas Freunde, Freundinnen, die ihr mit aller Ergebenheit anhingen. Es war in den allerersten Jahren ihres großen Ruhmes. Sie gab ein Gastspiel in Berlin; es war noch in den neunziger Jahren, glaube ich. Eine Freundin, Trägerin eines großen Namens in Oesterreich, war ihr dahin gefolgt, beide hatten ihre Zimmer nebeneinander im selben Hotel in der Friedrichstraße. Eines Nachts' nach der „Kameliendame“ tritt auf einmal die Duse ins Zimmer an das Bett der Freundin, weckt sie aus dem Schlaf. Gestern, habe sie heute am Abend im Theater gehört, hätte in Mailand die Erstaufführung von „Mefistofele" Mailand die Erstaufführung von „Mephistophele“ (oder war es „Nerone"?) ihres Freundes Boito stattgefunden, sie müsse unbedingt den „Cor- riere della Sera" haben, gleich, unbedingt gleich, denn sie wolle wissen, ob die Oper ein Erfolg gewesen sei. Sie kenne sich in Berlin nicht aus, kein Cafe, wo der „Cotriere" aufläge, spreche nicht ein Wort deutsch. Du mußt mir ihn besorgen, bitte, um Gottes willen! Die Gräfin war im ersten Augenblick nicht ganz damit einverstanden, mit der Idee, aus den warmen Federn ihres Bettes zu steigen und sich nach Mitternacht auf die Straße zu begeben, es schneie zu allem dazu, morgen sei auch ein Tag und die Zeitung dann gewiß überall zu haben. „Nein, nein, nein, du bist keine Freundin, sondern eine verwöhnte Aristokratin mit Lakaien und Kammerjungfrauen hinter sich, du sollst dich schämen. so kein Herz zu haben.“ Die Gräfin steht auf, wirft sich in den Pelz, verläßt das Hotel, läuft nach dem Cafe Bauer und kommt nach einer Weile mit dem „Corriere" zurück. Worauf die Duse unter Tränen auf die Knie fällt und die Füße der Freundin küßt, die für sie durch die eiskalte Nacht im Schnee gelaufen wären, um eine Zeitung irgendwo noch zu finden.
Es geht bei der Duse nicht darum, daß sie wahrscheinlich oder wirklich die größte Schauspielerin ihrer Zeit oder aller Zeiten gewesen sei. Es hat immer große, größte gegeben und wird es immer wieder geben. Die Duse war gerne bereit, andere Schauspielerinnen für mehr zu halten als sich selber, sie hielt am liebsten alle für größer als sich selber, haßte in Augenblicken ihre Kunst, haßte vor allem die Stücke, in denen sie am größten war, spielte am liebsten Ibsen, ohne das ihrem Wesen Fremde des Norwegers zu spüren, spüren zu wollen, und sagte zu Rodin, es gebe Tage, an denen sie lieber eine kleine Näherin wäre als eben die am meisten gefeierte Schauspielerin in Europa. In solchen Stimmungen mag sie wohl auch zu Isidora Duncan gesprochen haben: Wenn ich so wäre wie Sie! Als Tänzerin sind Sie, was Sie sind. Ich bin nie das, was ich bin. Ich bin nur eine Schauspielerin und mache den Leuten etwas vor.
Es ging auch der Duse um das große Problem der Dichter des 19. Jahrhunderts von Keats bis zu Rilkes Duineser Elegien, um das Problem, wie bringe ich es zuwege: zu dichten, etwas zu fingieren und zugleich zu s e i n, zu leben. Es ist das Problem der existentiellen Einbildungskraft, von (dem meine Bücher an vielen Stellen handeln und das aufkam, als die klassische Kunst, die großd, wie sie genannt wird, anfing, leer zu werden, auszulaufen. Für Ibsen war es das Problem der Lebenslüge, für Kierkegaard das des Einzelnen gewesen. Es hat wohl noch niemand den Dänen mit der Duse zusammen genannt; sie gehören aber zusammen, wenn man das 19. Jahrhundert verstehen will. Kierkegaard stellte sich selber und seinen Zeitgenossen die Frage: Bin ich in Wahrheit ein Christ, wie die Apostel, die Märtyrer? Für die Duse, für ihr Temperament mußte sich dieselbe Frage so stellen: Bin ich eine Mänade, bin ich sie wieder? Oder werde ich sie wieder, zu einer, wie solche einst in den Wäldern um Theben rasten, da sie, berauscht vom Gott, Rehkälber, Schlangen und zuletzt den König Pentheus zerrissen? In der Sage, im Mythos geht das alles gut zusammen: Dichter und Held, Bühne und Leben oder wie immer wir diese Antithesen nennen wollen, die zugleich wirklich und scheinbar bestehen. Im Staat aber, in der Gesellschaftsordnung, mit dem Aufkommen der Idee, auch der Historie entstehen dann Schwierigkeiten, solche letztlich der Seele.
Romantik, romantisches Leben, romantische Lüge war: diese Schwierigkeit zu ignorieren oder auch damit vor anderen, dem unvermeidlichen Publikum, der Mittelmäßigkeit, groß zu tun. Das verstand die Duse nicht: großtun, deklamieren, denn sie war im Grunde ihres Wesens in der Tat eine Mänade; nur ist ks so gewesen, daß nicht Rehkitze, Schlangen und zuletzt die Glieder des blasphemischen Königs Pentheus um sie herumlagen zerrissen am Waldboden, sondern ihr eigenes Leben. Sie war. sage ich, Mänade, denn dort, an der Stelle auf dem Brett der Bühne, wo ihr Fuß hintrat und ihr Schrei ertönte, war die Bühne nicht mehr Bühne, war diese, war das Brett Welt, Erde, und das Publikum nicht mehr Zahl, zahlreich oder spärlich, sondern ein einziger, geeinigter Körper, wie schließlich auch bei den Liebungen der Derwische oder Aissauas und anderen Sekten auf dem Boden Asiens.
Das war, ich möchte sagen, das Heilbringende am Spiel der Duse, was soviel heißt wie, daß sie ganz und gar außer Vergleich zu stehen kam, so oft sie spielte. Wenn ich Friedrich Mitterwurzer als den größten Schauspieler bezeichne, den größten in meinem Leben und den größten aller Zeiten, so vergleiche ich ihn noch. Dieser prachtvolle Mensch, der sich auf der Bühne in alles zu verwandeln vermochte, in ein Stück Holz meinetwegen, war in den letzten Jahren seines Lebens zu gewissen Stunden kniend auf den Stufen des Altars der Michaelerkirche in Wien zu finden, er war gläubig wie nur irgendein Mensch ist, der ein Gebet spricht. Die Duse war nicht gläubig, ihr Spiel war Mänadentum. Man kann es darum auch Mystik nennen. Man darf sie die letzte Mänade nennen. Nach ihr sollte es keine mehr geben. Als das ist sie an der Jahrhundertwende gestanden. Der Ruhm, der ihr überallhin folgte, war nur ein Teil ihres Rausches. In den Ruhm hat sich ihr Rausch übertragen, in ihn ist sie im Rausch getreten. Der darin letztlich bestanden hat, daß sie alles, alle sogenannten Rollen in sich selber verwandelte und nicht, wie es bei Mitterwurzer der Fall war, sich selber in alle Menschen. Die Duse war ungebildet, wußte von nichts etwas; so kam es, daß das, was wir Gleichgewicht nennen, Harmonie, für sie Anpassung an die Gottheit werden mußte, was das Wesen der mänadischen Verzückung ausmacht
Alles das kam in ihrer Sprache zum Ausdruck, über die, möchte man sagen, nichts hinausging. Diese bestand darin, das Inwendige ganz nach außen zu kehren, aufzudecken. Die Rede war völlig unrhetorisch. Was hat sie nicht alles aus der leeren Rhetorik in d’Annunzios „Gioconda“ zu machen vermocht, in desselben Dichters „Francesca da Rimini", darin alle Handlung dazwischen, zwischen Worten, Sätzen verinnert! Sie konnte die Kleopatra Shakespeares nicht spielen, weil bei Shakespeare Sprache und Handlung, Bild und Handlung in eins zusammenfallen und dem Schauspieler nichts zu „retten" übrigbleibt. Die Duse hatte eine einzigste Art, ihre schönen Hände mit ins Spiel zu ziehen, das Innere der Hand, la paume, ein Wort, das Rilke liebte und dessen Entsprechung im Deutschen er vermißte. Damit vermochte sie dann die völligste Reinigung, Oeffnung ihres mänadischen Wesens auszudrücken, ihre Hingabe, Entäußerung.
Was bleibt bei Menschen nicht alles im Inneren der Hand zurück, wird darin versteckt, bleibt darin verunreinigt, wie klebrig! Die Gebärde der Hände wies bei der Duse auf die Durchsichtigkeit des eigenen Wesens hin und war zugleich die Durchsichtigkeit des Wortes selber. Diese war von höherem Rang als die bloße Schönheit. Das Wortgebilde, rein für sich genommen, scheint durch. So war die Sprache der Duse auf eine besondere Art durchscheinend. Mitter- wurzers Sprache kam so aus seinem Munde, daß man das Gefühl hatte, man höre das Wort zum ersten Male, das Wort werde in dem Augenblick geboren, trete ins Licht, gewinne Gestalt, da er es ausspreche. Ohne irgendwelche Gebärden der Hand. Viele Leute von heute haben noch den Kainz gehört. Bei diesem großen Schauspieler war der Vers das Primäre und nicht das Wort. Alle drei brauchten keine Inszenierung um sich herum, akzeptierten vielmehr jede. Reinhardts Inszenierungskunst hat der Sprache geschadet, sie um ihre Kostbarkeit, Einzigkeit, Erstgeburt gebracht. Es blieb dann nur der Film übrig, der die Sprache abwürgt. Wer hört darin noch auf das Wort? Um noch einmal daraufzukommen: es kam bei allen dreien, der Duse, dem Mitterwurzer, Kainz, nicht auf die Schönheit der Sprache an wie bei der Wolter und der. Bartet an der Comėdie Franęaise. Die Wolter hat wohl die schönste Sprache, aber es blieb dabei, möchte ich sagen, die Sprache sollte nicht über die Schönheit hinaus. Auch verlangt die deutsche Sprache nicht so nach der Gebärde der Hand, fordert diese nicht so deutlich heraus wie die italienische. Die englische Sprache ist so veranlagt, daß sie die Hand des Menschen zur Unterstützung nicht braucht, wozu sich noch sehr viel vorbringen ließe.
Es ist in der Tat so, als ob nach der ursprünglichen Vergewaltigung des normannisch-lateinischen Elements im Lauf der Jahrhunderte die Hand sich zurückzuziehen gehabt hätte. Engländer reden mit den geringsten Gebärden der Hand, die Italiener mit den meisten. Mir ist an russischen Schauspielern, bei Stanislawsky, bei Moskwin, bei den anderen Mitgliedern der unvergleichbaren Truppe seinerzeit aufgefallen, daß die Sprache der Russen auf den sinnlich reichen Lippen lag und nichts den Händen überantwortet war. Ich habe die Bartet erwähnt. Die einzige, höchste Schönheit ihrer Sprache war letztlich aus der Schönheit der französischen Sprache selbst geholt. Diese trägt die Forderung in sich, schön ausgesprochen zu werden, verlangt die Hand nicht, braucht sie nicht.