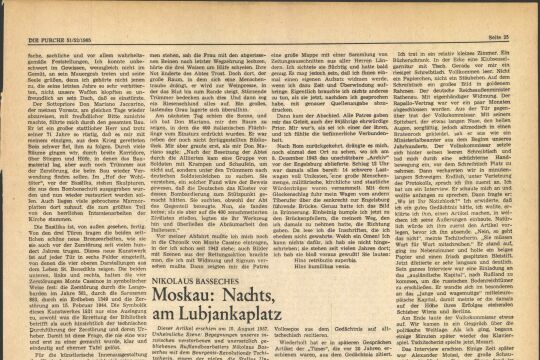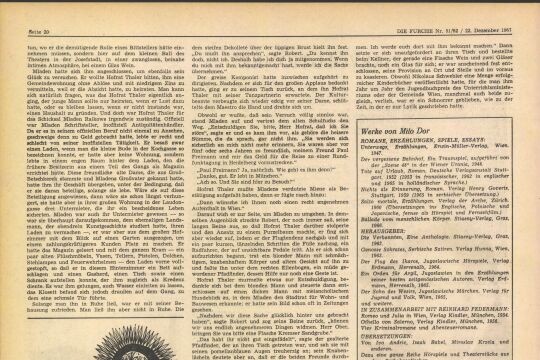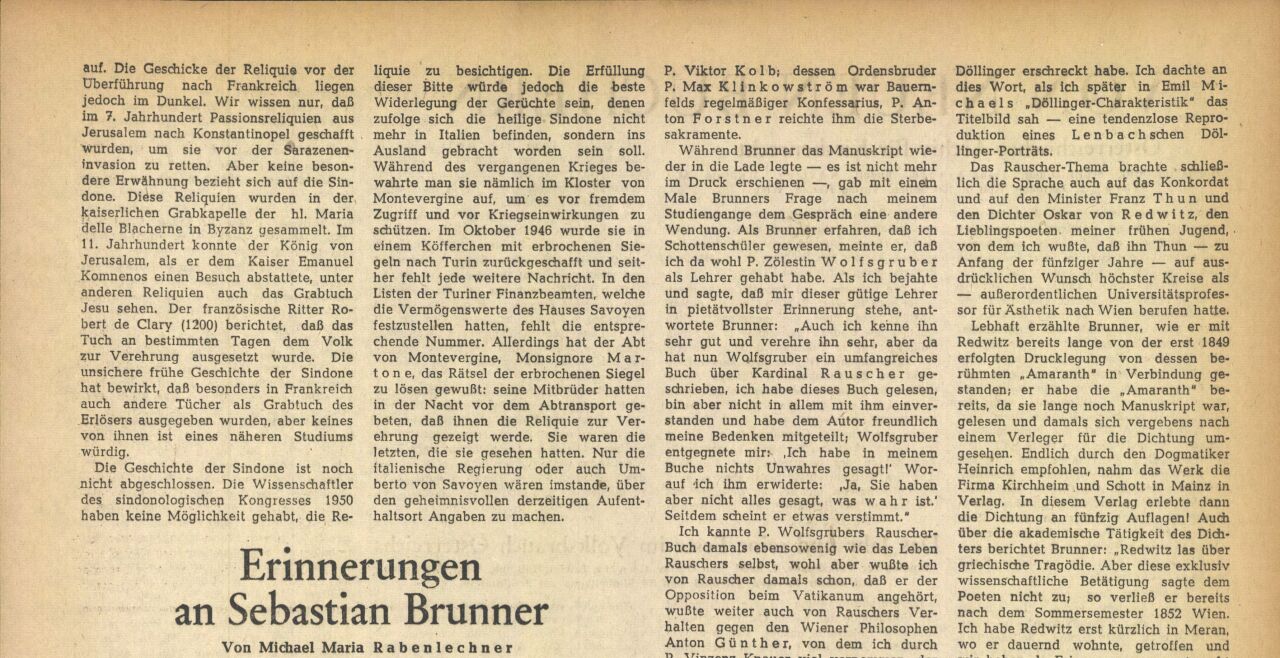
Unter den markanten Persönlichkeiten, die im Hause meines Vaters verkehrten, befand sich auch Sebastian Brunner.
Als wäre es wie heute, erinnere ich mich, wie ich, der Zehnjährige, ihn damals in unserer Wohnung im Schottenhof zum ersten Male sah: die ziemlich große Gestalt in einen grauen, schon stark verschossenen Radmantel gehüllt, um den Hals ein rotes, nachlässig geknüpftes Tuch, in der Hand einen — wahrhaftig nicht mehr neuen — Zylinderhut, die Füße in riesigem, schier rechteckigem Schuhwerk. Indes weniger um dieser äußeren Erscheinung willen als vielmehr um einer den ganzen Mann in seiner urwüchsigen Art charakterisierenden Äußerung ist mir die erste Bekanntschaft mit Sebastian Brunner unvergeßlich geblieben. Es war schon Abend, als er kam; und er entschuldigte sich, daß er etwas spät sich einstelle, er komme eben von einem Leichenbegängnisse: „mei Dachdecker is gsturbn“, sagte er — der geborene Schottenfelder — in unverfälschtem Wiener Dialekt, und er wies dabei mit der Hand auf das dunkelbraune, hochgescheitelte Haupthaar. Trotz der Geste verstand ich die Äußerung nicht; erst als Brunner sich empfohlen, erfuhr ich, daß der Besucher von dem Erzeuger seiner Perücke gesprochen habe. „Dieser geistliche Herr“ — lautete die ergänzende Erklärung — „trägt aber nicht bloß eine Perücke, sondern zuweilen darüber auch eine Inful. Er ist nämlich der berühmte Prälat Sebastian Brunner.“
Brunner kam stets nachmittags zu uns. Gewöhnlich saß ich dann über meinen gymnasialen Schulbüchern und er richtete dann an mich gelegentlich ein ermunterndes Wort. Ich hatte damals noch keine rechte Vorstellung von der Bedeutung des freundlichen Mannes; erst als mir als Quartaner Wilhelm Lindemanns sechsbändige „Bibliothek der deutschen Klassiker für Schule und Haus“ und Herders — damals 4 Bände umfassendes — „Conversationslexikon“ in die Hände gefallen waren, gingen mir die Augen auf. Mein Vater starb, da ich mich noch in der vierten Gymnasialklasse befand, und zum letzten Male kam dann Brunner in unsere Wohnung einige Tage nach meines Vaters Tode, um meine Mutter zu trösten. Bei dieser Gelegenheit zog er aus der Tasche ein von ihm verfaßtes, schön gebundenes Gebetbuch „Jesus mein Leben“, das viele Gedichte von ihm enthielt; er schenkte es mir, nachdem er vor mir noch als Widmungswort hineingeschrieben: „Dem guten Sohn am Begräbnistage seines guten Vaters, des k. k. Oberrechnungsrates Michael Rabenlechner — Mai 1884 — der Verfasser.“ Ich habe dieses Gebetbuch als kostbares Erinnerungsstück an Brunner bis heute bewahrt.
Nun sah ich Brunner Jahre nicht mehr — dafür beschäftigte ich mich als Obergymnasiast um so eifriger mit seinen Schriften, verschlang gierig seine
Selbstbiographie „Woher? Wohin?“ und als deren Ergänzung die „Denkpfennige“, nahm seine Monographie über „Joseph II.“ vor sowie das prächtige Buch über „Clemens Maria Hofbauer“; schließlich hatte ich auch die „Hau- und Bausteine zu einer Literaturgeschichte der Deutschen“ erhascht, die mich indes — warum soll ich's verschweigen bei allem kaustischen Witz enttäuschten. Indes die literarhistorischen Marotten Brunners ließen mir die Freude an dem Erzähler Brunner, der so sehr an Jean Paul erinnerte, an dem geistvollen Satiriker, dem brillanten Reiseschriftsteller nicht verkümmern.
Jahre später, während meiner Universitätszeit, kam ich im Gedränge des Wiener Westbahnhofes vor den Kassen in seine Nähe, und er erinnerte sich freundlich meines Vaters und meiner. Dann nahm ich mir eines Tages das Herz, in einer rein persönlichen Sache, in der Brunners Wort gewichtig sein konnte, ihn aufzusuchen.
Brunner hauste schon seit vielen Jahren im Wiener Dominikanerkloster. Er wohnte innerhalb der Klausur, speiste sogar mittags im Refektorium mit den Mönchen, ließ sich indes abends — die Dominikaner leben nach ihrer Regel auch an den höchsten Festtagen fleischlos — das Abendessen aus dem dem Dominikanerkloster nahen Hotel „Post“ bringen.
Brunner empfing mich freundlich und wies mir einen Stuhl neben seinem Schreibtisch an. Das Persönliche war rasch erledigt, aber mich fesselte der Blick auf die Berge von Manuskripten, die herumlagen, und so drängte es mich zu fragen, ob seine Lesergemeinde denn nichts mehr von ihm, dem Erzähler, dem Schöpfer zum Beispiel von „Fremde und Heimat“, des „Diogenes von Azzel-brunn“ hoffen dürfe. Brunner nahm den Faden sofort auf: „So etwas schreibt man nur, wenn man jung ist.“ Und er zog, am Schreibtisch sitzend, aus einer Lade zur Linken ein dickes, mit Spagat umwundenes Blätterkonvolut hervor: „Das ist meine gegenwärtige Arbeit.“ Er las mir den langen Titel und das gereimte Motto vor, wobei er — stark kurzsichtig, er trug nie Augengläser — das Gesicht sehr nahe dem Papier haltend, mit einer Bewegung des ausgestreckten Zeigefingers dem gelesenen Worte jeweils Nachdruck gab. Es war eine Arbeit über Goethe, in deren Titel, wie ich mich noch genau erinnere, die Worte „Goethes Theologie“ standen. Es fielen nach Titel und Motto Streiflichter auf Goethe, Schiller und einige moderne Poeten hinsichtlich ihrer „Theologie“, auch — wie ich mich genau erinnere — auf Bauernfeld; Brunner sprach davon, von Bauernfeld, der in seinen letzten Lebensjahren sich der Kirche zugewandt habe und regelmäßig am Tisch des Herrn erschienen sei. Uber diese religiöse Wandlung Bauernfelds erfuhr der Verfasser dieser Zeilen übrigens später noch Einzelheiten durch den großen Prediger
P. Viktor Kolb; dessen Ordensbruder P. Max Klinkowström war Bauernfelds regelmäßiger Konfessarius, P. Anton Forstner reichte ihm die Sterbesakramente.
Während Brunner das Manuskript wieder in die Lade legte — es ist nicht mehr im Druck erschienen —, gab mit einem Male Brunners Frage nach meinem Studiengange dem Gespräch eine andere Wendung. Als Brunner erfahren, daß ich Schottenschüler gewesen, meinte er, daß ich da wohl P. Zölestin Wolfsgruber als Lehrer gehabt habe. Als ich bejahte und sagte, daß mir dieser gütige Lehrer in pietätvollster Erinnerung stehe, antwortete Brunner: „Auch ich kenne ihn sehr gut und verehre ihn sehr, aber da hat nun Wolfsgruber ein umfangreiches Buch über Kardinal Rauscher geschrieben, ich habe dieses Buch gelesen, bin aber nicht in allem mit ihm einverstanden und habe dem Autor freundlich meine Bedenken mitgeteilt; Wolfsgruber entgegnete mir: ,Ich habe in meinem Buche nichts Unwahres gesagt!' Worauf ich ihm erwiderte: ,Ja, Sie haben aber nicht alles gesagt, was wahr ist.' Seitdem scheint er etwas verstimmt.“
Ich kannte P. Wolfsgrubers Rauscher-Buch damals ebensowenig wie das Leben Rauschers selbst, wohl aber wußte ich von Rauscher damals schon, daß er der Opposition beim Vatikanum angehört, wußte weiter auch von Rauschers Verhalten gegen den Wiener Philosophen Anton Günther, von dem ich durch P. Vinzenz Knauer viel vernommen, der damals an der Wiener Universität eben über neuere Philosophie las. Uber das Vatikanum kam die Sprache auf — D ö 11 i n g e r. Und nun berichtete mir Brunner folgende Episode, die ich treu nach meinem Gedächtnisse wiedergebe: Vorausgeschickt sei, daß Brunner sich schon bei Pius IX. und zumal bei Leo XIII. großen Ansehens erfreute. Leo XIII. wußte, daß Brunner mit Döllinger gut befreundet gewesen. „Kurz nach der Wahl des Papstes“, erzählte Brunner, „gelangte an mich das päpstliche Ersuchen Leos XIII., Döllinger in München aufzusuchen: ,Venga c'e: un altro papa', lautete wörtlich die Botschaft des Papstes (.Gehen Sie, es gibt da einen andern Papst,'). Ich begab mich nach München zu Döllinger, trat zu ihm mit den Worten Leos, sprach, wie es in den Absichten des Papstes lag, glaubte den Rückweg für Döllinger geebnet zu haben und schied in hoffnungsvollster Stimmung. Da schaltete sich unheilvoll Döllingers Professor Johannes Friedrich ein und die Angelegenheit war damit negativ entschieden. Es war Friedrich gelungen, alles zu verderben.“
So — und noch wie heute höre ich den gemütlichen Tonfall des Brunnerschen Italienisch — berichtete Brunner in jener Stunde, und als ich ungefähr zehn Jahre später Friedrichs damals soeben erschienene dreibändige Döllinger-Biogra-phie vornahm, fand ich denn auch im dritten Bande, pag. 588, an der Stelle, wo Friedrich von Unterwerfungsaufforderungen an Döllinger redete, jenen Besuch Brunners — sogar samt jenem „Venga c'e: un altro papa“ verzeichnet. In der Erinnerung an jenen Besuch bei Döllinger sprach Brunner nachdrucksvoll über „das unheimliche Gesicht“, das ihn an
Döllinger erschreckt habe. Ich dachte an dies Wort, als ich später in Emil Michaels „Döllinger-Charakteristik“ das Titelbild sah — eine tendenzlose Reproduktion eines L e n b a c h sehen Döl-linger-Porträts.
Das Rauscher-Thema brachte schließlich die Sprache auch auf das Konkordat und auf den Minister Franz Thun und den Dichter Oskar von R e d w i t z, den Lieblingspoeten meiner frühen Jugend, von dem ich wußte, daß ihn Thun — zu Anfang der fünfziger Jahre — auf ausdrücklichen Wunsch höchster Kreise als — außerordentlichen Universitätsprofessor für Ästhetik nach Wien berufen hatte.
Lebhaft erzählte Brunner, wie er mit Redwitz bereits lange von der erst 1849 erfolgten Drucklegung von dessen berühmten „Amaranth“ in Verbindung gestanden; er habe die „Amaranth“ bereits, da sie lange noch Manuskript war, gelesen und damals sich vergebens nach einem Verleger für die Dichtung umgesehen. Endlich durch den Dogmatiker Heinrich empfohlen, nahm das Werk die Firma Kirchheim und Schott in Mainz in Verlag. In diesem Verlag erlebte dann die Dichtung an fünfzig Auflagen! Auch über die akademische Tätigkeit des Dichters berichtet Brunner: „Redwitz las über griechische Tragödie. Aber diese exklusiv wissenschaftliche Betätigung sagte dem Poeten nicht zu; so verließ er bereits nach dem Sommersemester 1852 Wien. Ich habe Redwitz erst kürzlich in Meran, wo er dauernd wohnte, getroffen und wir haben da Erinnerungen ausgetauscht an die Stunden, da wir in seiner kurzen Wiener Zeit in Wiener Abendgesellschaften beisammen waren.“ Eine stattliche Reihe von Salons solcher erlesener hochgeistiger Zirkel in Wien standen Brunner damals offen. Der Gedanke an die Kreise, in denen er damals Einfluß hatte, ließen auch das Thema „Ehre und Auszeichnungen“ anschneiden. Mit bezeichnender Gebärde schloß da Brunner: „Kardinal Gangibauer, der zufällig erfahren, daß ich noch keinen Orden besitze, erklärte sich sofort bereit, alles hiezu Nötige in die Wege zu leiten, daß dieses Versäumnis behoben werde. Als ich von diesem Vorhaben Kenntnis erhielt, bat ich den Kardinal auf das dringende, von jedem Schritte abzusehen. ,Man darf nicht gar so demütig sein', sagte der Kardinal. .Eminenz', sagte ich, ,es ist nicht Demut, ich bin zu stolz dazu.'
Wenige Monate nach diesem meinem Besuche las ich eine Zeitungsnotiz — ich glaube im „Vaterland“ —, daß Brunner, alt, kränklich und pflegebedürftig, aus seiner Wohnung im Dominikanerkloster nach Währing ins Greisenasyl in der Gentzgasse übersiedelt sei. Dort ist Brunner bald darauf in seinem 79. Lebensjahre, am 27. November 1893, gestorben.
Noch bei Lebzeiten hatte er sich auf dem Friedhofe in Maria-Enzersdorf eine Gruft bestimmt. Auf diesem Gottesacker ruht Brunner. Sein schöner Grabstein läßt die von ihm verfaßte Inschrift lesen: Diesem Fleisch mitsamt den Knochen Ist das Urteil schon gesprochen, Doch wer glauben kann und hoffen, Wird darüber nicht betroffen.