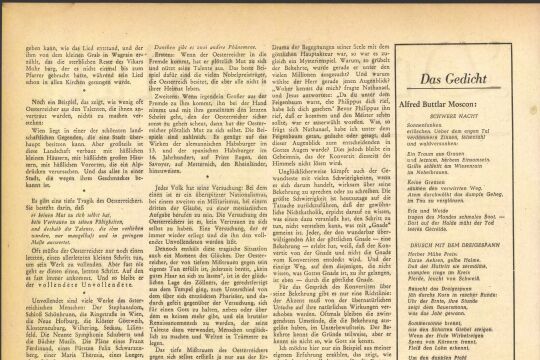Manchmal war es für den Deutschen, der Schweden in den dreißiger Jahren besuchte, erstaunlich, daß die wirkliche Weltberühmtheit der Selma L a g e r 1 ö f nicht ausreichte, um sie vor dem despektierlichen Urteil zu schützen, das damals deutlich im Ansteigen war. Man lächelte über sie, wenn das Gespräch auf sie kam, man nannte sie ..Tante Selma“. Erst bei nähere; Kenntnis des neuen Schweden verstand man, daß es sich hier um einen klaffenden Generationsbruch handelte. Die Dichterin, die trotz ihres Alters Millionen Leser der ganzen Welt faszinierte, hatte sich in ihrer Heimat überlebt. Gewiß war sie, die eine kleine Gestalt hatte und hinkte, weiter die Dame der königlichen Akademie und ihrer strahlenden Nobelfeste, die Herrin von Märbacka, ihres Gutes in Wärmland, die vielgelesene Autorin der schwedischen Bibliotheken und Schulen — aber der Strom der jüngeren Generation brauste vorüber an ihr. Sie hatte 1910 den Nobelpreis erhalten und damit den Zenit ihres literarischen Ruhmes vor dem Weltkrieg erreicht. Wenn sie auch 1914 bis 1918 so stark miterlebte, daß sie während langer Perioden nicht arbeiten konnte, ließ sie sich doch nicht in die Wirbel des großen Zusammenbruches ziehen. Ihre geistige Welt blieb die gleiche auch nachher: sie lebte in Alt-Europa, in Alt-Schweden. Und es war dies, was ihr die Jugend übelnahm.
Selma “Lagerlöf wußte um diese unheilbare Spannung. Wenn sie in diesen späten Jahren ein Werk abgeschlossen hatte, empfand sie eine Art Lähmung, wo „es schrecklich“ war, „dazusitzen und auf die Kritik zu warten“. Schließlich meldete sie zu ihrem 80. Geburtstag der Freundin Olander, sie fürchte, ihre Nerven seien dem
Echo eines neuen Buches nicht mehr gewachsen, und sie wolle deswegen auch keines mehr herausgeben. In der Tat: ihr letzter Romanplan wurde nicht mehr verwirklicht. Er ging als eine Sammlung von Aufzeichnungen auf die Nachwelt über.
Damit beginnt das schwere Altern der Dichterin. Zu dem Bangen vor der Isolierung gesellen sich körperliche Plagen, Krämpfe und Magenbeschwerden, aber vor allem die Angst, daß die Inspiration sie verlasse. „Der Ring des Generals“, der 1925 erschien, der erste Teil des Löwensköld-Zyklus, ist zwar ein vollendetes Meisterwerk, an dem kaum etwas von einem Erlahmen gemerkt werden kann — das Buch gleicht in seiner Mythoskraft „Herrn Arnes Schatz“ oder der „Herrenhofsage“ —, aber die folgenden Teile „Charlotte Löwensköld“ und noch mehr „Anna Svärd“ fallen dagegen ab. Auch hier ein Reichtum des Menschlichen, von Einfällen, der Charaktcrgestaltung, von ungewöhnlichen Motiven und deren Konsequenz, aber die Schwungkraft ist nicht mehr die gleiche.
Selma Lagerlöf spürt es als den Tribut, den das Alter von ihr fordert. Das Schreiben geht ihr immer langsamer von der Hand, und sie hat es nicht leicht, den Verleger Bonnier zu beruhigen, der schon ungeduldig auf die nächsten Bogen wartet. „Das sind gräßlich schwere Dinge, mit denen ich jetzt zu tun habe“, schreibt sie ratlos, „und meine ganze Energie muß sich darauf einrichten.“ Neue Menschen interessieren sie kaum, sie muß sie von Fräulein Olander abwehren lassen, ebenso den Strom von Bittbriefen, der täglich eintrifft. Ihre ganze Energie soll nur der Niederschrift der neuen Kapitel dienen. Aber die Anstrengung hilft nichts.
„Ich kann sie (die Kapitel) nicht reinschreiben, denn am Anfang eines Buches ist immer soviel zu ändern. Freilich weiß ich, was darin stehen soll, und teilweise sind sie auch fertig. Ich beginne auch einigermaßen zu wissen, was sich in dem Buch ereignen wird, ... aber natürlich wird es nicht heiter.“ Der Frühling 1926, wo sie damit (mit „Anna Svärd“) zu Ende zu kommen hofft, erfüllt nicht ihre Erwartungen: „Es geht schrecklich langsam. Ich kann meinen Weg nicht sehen“, seufzt sie. Aber auch der Sommer ändert nicht viel an dem stockenden Verlauf. „Es geht verzweifelt langsam“, teilt sie dem Verleger mit. Und Monate später ist sie so mißgestimmt über das Buch, dessen Abschluß sie Bonnier für den Herbst 1927 versprochen hat, •laß sie es weglegen und etwas Neues beginnen
möchte. Da tritt eine Wendung ein. „Aber jetzt am Nachmittag kam eine gute befreiende Idee, auf die ich seit vielen Wochen gewartet habe. Jetzt glaube ich, daß ich damit zu Rande komme, obgleich natürlich noch eine Masse von Schwierigkeiten zu bewältigen ist.“ 1928, zu ihrem 70. Geburtstag, erschien „Anna Svärd“, der Roman der Daiekarlicrin. die eine Hausiererin war und Gattin eines religiösen Schwarmgeistes wurde.
In ihrer Sorge über das Ausbleiben der Inspiration hat Selma Lagerlöf oft einen Ausweg gesucht, der an die unbewußte Reaktion eines Schulkindes erinnert, das mit seiner Schulaufgabe nicht fertig wird. Sie hat an den Rand der Manuskriptseiten, die sie mit ihrer feinen, deutlichen Schrift bedeckte, Stoßseufzer, oder besser, Stoßgebete hingeschrieben, die sie später unleserlich machte, indem sie sie überkreuzte. Die neue Literaturforschung hat doch diese Stellen näher untersucht und entziffert. „Ach, mein Gott“, steht dort, oder „O mein Gott, lehre mich, was ich schreiben soll“, oder „Ich, die nur eine geringe Aufzeichnerin von Menschenschicksalen ist, keine von den großen Zweiflern, keine von den großen Glaubenshelden, und die nur eine schwache innere Zuversicht hat, an die sie sich halten kann, ich bitte dich, du meine schwache Zuversicht, ich bitte dich, du mein schmaler Lichtstreifen, leite mich, lenke...“ Hier bricht das Selbstbekenntnis ab. Ein ähnlicher Ausruf, noch aus den Kriegsjahren, lautet: „Guter Gott, hilf Selma Lagerlöf. Christus Jesus komm und hilf mir, sag, was ich schreiben soll.“
In den letzten zwölf Jahren ringt sie verzweifelt um ihr Wort in der Einsamkeit von Märbacka, an dessen Park doch schon damals die Autos mit neugierigen Touristen vorbeifahren. (Heute ist es eine der besuchtesten Stellen Schwedens). Der Abschluß des Löwensköld-Zyklus bedrängt sie. Die ersten drei Teile befinden sich endlich nach fünfzehnjähriger Arbeit gedruckt. Aber der vierte und letzte, der nur ein kleines Buch von 160 Seiten werden soll und Anna Svärds Mann, dem sektierischen Christen gilt, will sich ihr nicht ergeben. Trotz einer Menge von Aufzeichnungen und prachtvollen Einzelheiten fügt er sich nicht zur Einheit zusammen, und die berühmte Dichterin Schwedens erlebt jetzt die hilflose Verlassenheit des geringsten ihrer schreibenden Kollegen, des Dilettanten, der die Gestalt des Ganzen und das Ende nicht finden kann. Obwohl sie bis zum letzten Augenblick an der Arbeit festhält, ist dieser Teil Fragment und damit der gesamte Zyklus Torso geblieben. Der Schlaganfall vom 16. März 1940 schlägt ihr für immer die Feder aus der Hand, die schon vorher nur mit größter Mühe fast unleserliche Zeilen auf das Papier hingestammelt hat. Selma Lagerlöf kapituliert nicht bis zum Ende.
Durch ein kürzlich erschienenes Bueh „Den äldrande Selma Lagerlöi“ — „Die alternde Selma Lagerlöf“ — von Lars Ulvenstam, Bonnier Stockholm 1955, erfährt man Näheres über die Situation der alternden Dichterin, was vorher nicht bekannt war. Das Mißverständnis der jungen Generation wird dadurch in gewissem
Sinne gutgemacht. Aber auch sonst beleuchtet es Momente, die bis jetzt im Dunkel lagen: Selma Lagerlöfs Christlichkeit. Ihre Leiden, ihr Unvermögen, zu schreiben, scheinen damit zusammenzuhängen, worüber uns freilich der Verfasser nicht weiter aufklärt.
Selma Lagerlöf hat schon früh christliche Stoffe angewendet und uns ihrer Faszination ausgesetzt, etwa in „Jerusalem“. Durch ihre gesamte Dichtung ziehen sich zwei Ströme einer heidnischen Mystik und eines christlichen Erbes, die in Konjunktion und Diskonjunktion zu einander stehen, aber sie selbst bekennt sich niemals zu einer Konfession. Sie fühlt sich als die große Erzählerin des Nordens, und dies will sie auch in der Einsamkeit des Alters bleiben.
Das christliche Bekenntnis ergibt sich ihr nicht. Sie will mit ihrer Erzählungskunst Wirklichkeit wiedergeben, nicht naturalistisch, sondern als Material geheimer Mächte, die doch zum Teil mit der Sphäre des Kreuzes zu tun haben, und in diesem Sinn berührt sich immer ihre Welt mit der des Christlichen. Wenn man sie aber'darauf festlegen möchte, weicht sie aus. Sie läßt durchblicken, daß theosophische Lehren etwas von dem Uebersinnlichen zu wissen scheinen, das auch sie für existent hält, aber sie bekennt auch hier keine Zugehörigkeit und geht im übrigen gern zu einem anderen Thema über.
Im Grunde ist Selma Lagerlöf eine wärm-ländische Bäuerin, deren Eigenart an eine lakonische Realität verhaftet scheint. Geistvoll sprühend gibt sie sich niemals, sondern immer nüchtern, und selbst den größten Versuchungen, sich in einem eitlen Selbstgefühl zu sonnen, erweist sie sich gewachsen. Als Paul Valery sie bei einem Bankett, plötzlich berührt von ihrem Blick, in einer begeisterten Rede als „den modernen Homer“ feiert, und ihr Verleger sie dann beiseite nimmt und fragt, wie sie diesen Vergleich aufnehme, antwortet sie: „O ja, das hörte sich angenehm an.“ Die einsamen, vielleicht manchmal hart und abweisend wirkenden Augen der Herrin von Märbacka, denen man es ansah, daß ihnen nichts lieber war als Verborgenheit, schienen zugleich den anderen bis ins Innerste zu durchschauen, wenn auch nur eine leichte Andeutung gefallen war.
Einem solchen auf Realität und unbedingte Echtheit gerichteten Geist konnte es nicht leicht fallen, ein religiöses Bekenntnis zu dem seinigen zu machen, das nicht bis ins Letzte von ihr durchdacht war, und ihre Versuche nach einer
„beweisbaren Religion“, womit sie sich gerade in den letzten Lebensjahren herumquälte, bilden doch einen rührenden Beweis, wie ernst es ihr damit war. „Es kommt wohl ein religiöses Genie, das das Rätsel löst“, meint sie — vielleicht unter dem theosophischen Einfluß dieser Jahre, der den „Weltlehrer“ verkündete — „wie es für unsere Zeit gelöst werden muß. Es ist ziemlich leicht, aber es bedarf eines genialen Klarblicks.“
Selma Lagerlöf schwankt hier deutlich. Sie hat „Christuslegenden“ geschrieben, die zum Schönsten der nordischen Prosa gehören, aber sie zweifelt an der Gottheit Christi. „Für mich spielt die Sache keine Rolle“, schreibt 6ie. „Ich glaube gar nicht, daß Jesus die Sünden der Welt versöhnte.“ Eine andere Briefstelle lautet im gleichen Sinn: „Daß er (Christus) unsere Sünden getilgt hat, habe ich niemals verstanden.“ Selma Lagerlöf gehört einem liberalen Christentum an, das zu ihrer Zeit ein soziales und humanitäres Pathos aufrechthielt, im übrigen aber von einem dünnen Geist des Relativismus erfüllt war und auch keine lange Lebensdauer hatte: es ist heute im Aussterben begriffen. Sie hat doch größtes Vertrauen zu diesem Geist, wie es aus ihrem Brief an Professor Valfrid Vasenius hervorgeht: „Solltest du dich nicht damit zufrieden geben, daß du Gott gefunden hast und damit aufhören, von einer besonderrn Religionsform zu sprechen? Dies: an gon glauben zu dürfen, ist das wichtigste für uns. Die Religionsform ist vielleicht etwas Ueber-lebtes, vielleicht hat sie niemals für die Völker des Nordens gepaßt. Wir konnten ja niemals Christen werden.“
Das ist ein erschütterndes Bekenntnis. Besonders, wenn man bedenkt, wie sehr ihre letzte Zeit von der Llnruhe erfüllt war, weder zur religiösen Klarheit zu kommen noch das letzte Werk, das dem Schicksal eines Freichristen gewidmet war, zu Ende führen zu können. Sie mutet ihrem Glauben, von dem aus allein sie geistig existieren und schaffen könnte, Dinge zu, die ihn praktisch vernichten, und beraubt sich so selber der Kraft, aus der r.llein ihr noch Inspiration zufließen könnte. Hier war der großen Dichterin offenbar eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten konnte. Daß ihr trotzdem die Darstellung des Christlichen mit einem echten Appell an den Leser gelang, bleibt ein Phänomen der Gnade, das wohl mit der anima naturaliter christiana mancher Genies zusammenhängt.