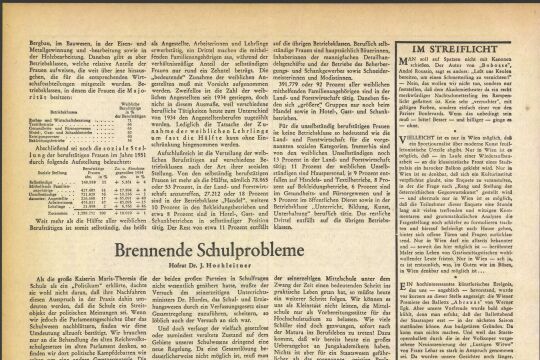Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
IM STREIFLICHT
Eins am kam der berühmte Komponist in Wien an. Vor einer Litfaßsäule studierte er den Spielplan der Staatsoper, feststellend, daß die Einladung zu der Wiener Aufführung seines musikalischen Dramas, das schon über die Bretter von zehn Bühnen der Alten und Neuen Welt gegangen war, tatsächlich stimmte. Niemand von der Leitung der Staatsoper nämlich war auf den Gedanken gekommen, einen Empfang für ihn zu veranstalten oder etwa gar der Presse Gelegenheit zu geben, einen so illustren Gast kennenzulernen; man hatte ihm ja nicht einmal das Orchester vorgestellt. Und wenn nicht zufällig ein ausländischer Gastdirigent, der unter dem Premierenpublikum saß, den Gast Gian-Carlo Menotti — dies der Name des Komponisten — gesehen, erkannt und ihn in seine Pension auf ein Glas Wein eingeladen hätte, dann wäre der Autor des „Konsul“ so einsam nach Hause gegangen, wie er gekommen war. Vielleicht hat eine Premierennachfeier stattgefunden; aber jedenfalls hat niemand daran gedacht, Menotti dazu einzuladen. Woraus füglich zu schließen sein dürfte, daß die lange Premierenpause unsere Staatsoper schon ganz vergessen gemacht hat, wie man mit lebenden musikalischen Kapazitäten umzugehen hat.
Das Theater „Die Insel“, schon längst von allen Widrigkeiten der Theaterkrise arg betroffen, soll nun kurzerhand allen Theaterkrisen enthoben werden. Man hat ein Mittel gefunden — oder besser: die KIBA hat e6 gefunden —, um dieses Theater aller Sorgen zu entledigen: sie will es in ein Kino verwandeln... Böse Zungen behaupten freilich, daß die KIBA und ihre Stützen im Wiener Gemeinderat bei diesem ernsthaft erwogenen Plan weniger das Wohl der „Insel“ im Auge haben, sondern einen Dorn, der in diesem Falle „Kärntner-Lichtspieltheater“ heißt, der „Insel“ gerade gegenüber liegt und merkwürdigerweise nicht der KIBA gehört. — Wie immer es auch um die Finanzlage der „Insel“ bestellt sein möge: die KIBA hat uns bereits bewiesen, daß man aus Markthallen und Turnsälen Kinos machen kann. Den Beweis, daß man auch Theater in Kinos verwandeln kann, möge sie uns doch lieber schuldig bleiben.
Das Wiener Stadtbauamt hat also endgültig entschieden, daß die Trümmerflächen am Franz-Josef-Kai in Parks umgewandelt werden; auf diese Weise wird es möglich sein, reizvolle Einblicke in die schönen, alten Stadtviertel um die Griechengasse und St. Ruprecht zu schaffen, dl bisher hinter häßlichen Zinshäusern eine Art von Dorn-röschenexistenz führten. Es mag 6ein, daß damit wirklich ein Anfang zur städtebaulichen Konsolidierung des Franz-Josefs-Kais gemacht wurde, der eine Fortsetzung der Ringstraße entlang eines grünenden Flußufers hätte sein können und doch nur eine unschöne, vom Verkehr kaum berührte und von grauen Gründerzeithäusern bestandene Kanaluferlände war. Diese wird jetzt — hoffentlich — ein eigenes Gesicht bekommen, Wien aber auf alle Fälle um einige schöne Stadtansichten reicher werden. Freilich kann man auch bei dieser Gelegenheit nicht ganz umhin, den städtischen Baubehörden gewisse Inkonsequenzen nachzusagen: während sie in den Innenbezirken nach einer Auflockerung der dicht bebauten Stadtteile durch die Anlage von Freiräumen oder Grünfächen 6treben — was zweifellos zu begrüßen ist, wenn auch das Kapitel „privater Grundbesitz und Enteignung durch die Gemeinde“ wesentlich heikler Ist, als es die Stadtplaner gewöhnlich wahrhaben wollen —, gestatten sie in ausgesprochenen Gartenvierteln, etwa in Pötzleins-dorf, die Errichtung von durchaus innerstädtisch anmutenden Wohnblöcken, die allen Regeln des modernen Städtebaus ebenso widersprechen wie den verschiedenen Flächenwidmungsplänen und baupolizeilachen Vorschriften, die 6onst so gerne in der Argumentation für diese oder jene nicht ganz einleuchtende Maßnahme der städtischen Baubehörden herangezogen werden. Stadtplaner haben es nicht leicht, denn was Immer 6ie beginnen — irgendwelche Interessen werden sie dabei immer verletzen. Um so mehr aber sollten sie darauf bedacht sein, nicht durch allzu offensichtliche Inkonsequenz noch mehr Widersprüche hervorzurufen, als sie ohnehin auf Bich nehmen müssen.
Das Plakat für die Wiener Frühjahrsmesse 1951 zeigt eine Telegraphenstange samt einem großen Porzellanisolator. Letzterer trägt die Farben rot-weiß-rot, ist also als Versinnbildlichung der österreichischen Wirtschaft zu verstehen. Die Telegraphendrähte hingegen dürften als die internationalen Wirtschaftsverbindungen aufzufassen sein. Leider. Denn das ein Isolator zu isolieren hat, von den elektrisch geladenen Drähten also ganz und gar nicht, beeinflußt wird, das dürfte im Zeitalter der Elektrizität auch weiteren Kreisen schon bekannt sein, denen also nur die Hoffnung bleibt, daß es um die österreichische Wirtschaft besser bestellt sein möge als um die Plakate der Wiener Messe
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!