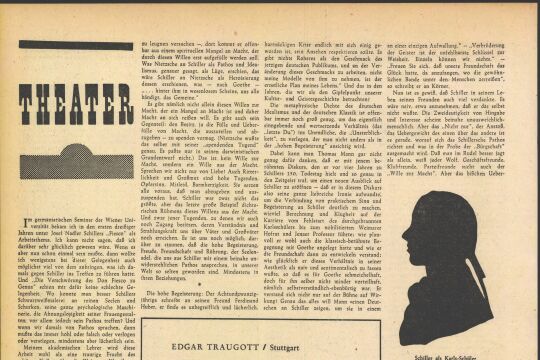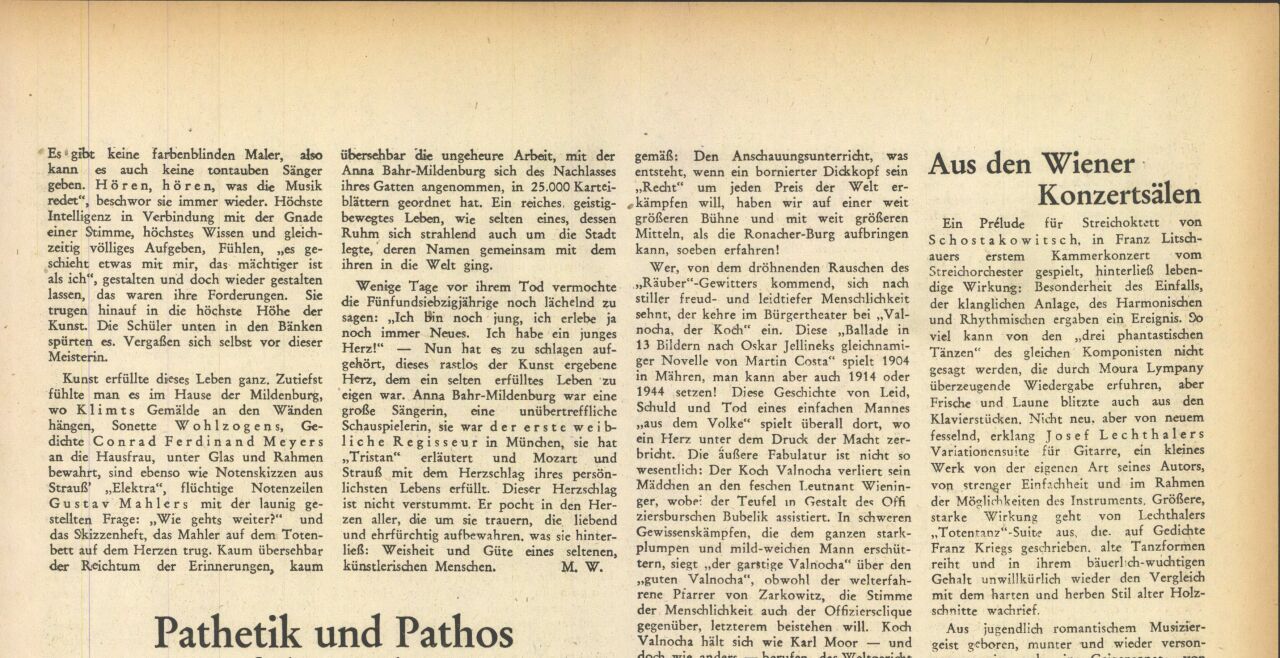
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Pathetik und Pathos auf der Bühne
Als wir in der Kälte dieser Tage vor dem Eingang des Ronacher-Gebäudes auf den Beginn der Vorstellung warteten, passierte ein älterer Herr eilenden Schrittes die erleuchtete Fassade, hob den frostroten Kopf, las den Theaterzettel: „Wozu brauchen wir die Räuber auch noch in der Inneren Stadt, in der Vorstadt haben wir genug!“ —i sprach's und ging.
Diese Scherzfrage, ein trauriger Witz vor der Treppe, weist jedoch auf Tieferes, Problematischeres: „Die Räuber“ gehören zum alten Repertoire der Burg, sie wurden in der Monarchie gespielt, nach 1918, nach 1934 und auch nach 1938: müssen sie deshalb wieder erscheinen?
Der Regie scheint selbst nicht ganz wohl gewesen zu sein, als ihr diese Aufgabe gestellt wurde. Jedenfalls, sie machte gute Laune zum überholten 9piel ;als rhetorisch-theatralisches Feuerwerk bringt sie ihren Schauspielern alle Ehre ein. Gerade diese Meisterleistung des Regisseurs zeigt aber, was dem Werk an sich fehlt. Das im letzten unechte, schmalbrüstige Pathos Schillers fordert diese Monumentalisierung, diese Aufhämmerung jedes Wortes, jeder Gebärde ins Barock-Großartige, es ist in Wahrheit ja gar nicht von großer Art! Kein Zufall, daß Schiller seit 100 Jahren zu den umstrittensten Dichtern der Klassik gehört. Die ehrliche persönliche Begeisterung des großen Schwaben, sein tapferes Ringen mit der Ungunst der Zeit und seiner eigenen Natur soll nicht verkannt werden; doch erlag Schiller bereits jener Versuchung des Deutschen, den Hochflug eines leichtentzündlichen, begeisterungsfähigen Temperaments für den Gipfelsturm echter Größe zu nehmen.
Die Tragik dieses Volkes wird sichtbar, wenn wir die „Räuber“ in die historische Situation hineinstellen: Es ist die Epoche der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, der Proklamation der Menschenrechte, der französischen Revolution. Die neue Welt des bürgerlichen Individuums will ein tausendjähriges Feudalalter ablösen. Alte Völker wandeln in ewigen Jahren ihr Antlitz, neue Völker entstehen. Deutschland aber schläft — schläft zumindest im Raum des Politischen, Gesellschaftlichen —, es wird diesen Zeitverlust durch kein ekstatisches „Deutschland erwache!“ mehr einholen.
Gewiß, im innersten geistigen Räume bereitet dies Volk eine Revolution vor, welche das Abendland zerschlagen sollte. Schon Heinrich Heine hat diese alles zertrümmernde Bedeutung der idealistischen Sektierer und Poeten (von den Tübinger Stiftsbrüdern Hegel und Hölderlin ausgehend) erkannt.
Was aber stellt Deutschland im politischen Raum der amerikanischen und französischen Proklamationen von 1776, beziehungsweise 1789 gegenüber: Schillers „Räuber“! Dieses Bühnenstück eines jugendlichen „Idealisten“ ist das Werk der nie stattgefundenen deutschen Revolution! Ein Räuberleben in den böhmischen Wäldern — die
Träume eines Schwärmers, der allerdings handfest zu sengen und brennen versteht — dann, nachdem das Erbe der Väter vertan, in Schutt und Asche gesunken, Vater und Geliebte ermordet sind — die große tönende Phrase: Der Nachfolger soll seine Banditen „dem Staate“ zur Verfügung stellen.
Nein! Wir wollen heute andere Stücke sehen. Wir erachten Aufwand und Ehrgeiz der Regie und Inszenierung für unzeit-
gemäß: Den Anschauungsunterricht, was entsteht, wenn ein bornierter Dickkopf sein „Recht“ um jeden Preis der Welt erkämpfen will, haben wir auf einer weit größeren Bühne und mit weit größeren Mitteln, als die Ronacher-Burg aufbringen kann, soeben erfahren!
Wer, von dem dröhnenden Rauschen des „Räuber“-Gewitters kommend, sich nach stiller freud- und leidtiefer Mensdilichkeit sehnt, der kehre im Bürgertheater bei „Val-nocha, der Koch“ ein. Diese „Ballade in 13 Bildern nach Oskar Jellineks gleichnamiger Novelle von Martin Costa“ spielt 1904 in Mähren, man kann aber auch 1914 oder 1944 setzen! Diese Geschichte von Leid, Sdiuld und Tod eines einfachen Mannes „aus dem Volke“ spielt überall dort, wo ein Herz unter dem Druck der Macht zerbricht. Die äußere Fabulatur ist nicht so wesentlich: Der Koch Valnocha verliert sein Mäddien an den feschen Leutnant Wieninger, wobei der Teufel in Gestalt des Offi ziersburschen Bubelik assistiert. In schweren Gewissenskämpfen, die dem ganzen starkplumpen und mild-weichen Mann erschüttern, siegt „der garstige Valnocha“ über den „guten Valnocha“, obwohl der welterfahrene Pfarrer von Zarkowitz, die Stimme der Menschlichkeit auch der Offiziersclique gegenüber, letzterem beistehen will. Koch Valnocha hält sich wie Karl Moor — und doch wie anders — berufen, das Weltgericht zu vertreten! An dem vergifteten Mahl sterben aber der Pfarrer, sein einziger Beistand, und dann andere Unschuldige; der Leutnant Wieninger ist nicht dabei . . .
Schiller hatte am Ende der „Räuber“ an „den Staat“ appelliert, der sich eben, unter Hegels und Fichtes Patronanz anschickte, aus einem Milchkind des Idealismus zum Leviathan der Menschendämmerung zu werden. Die Erfahrung eines Jahrhunderts liegt hinter dem Koch Valnocha: Nichts mehr von den großen Phrasen, welche die Weltgewitter präludierten; es bleibt nur ein leises, kaum hörbares Wort: Mitleid, Liebe. Friedrich Heer
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!