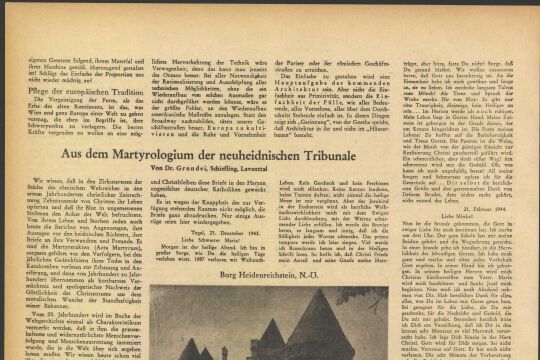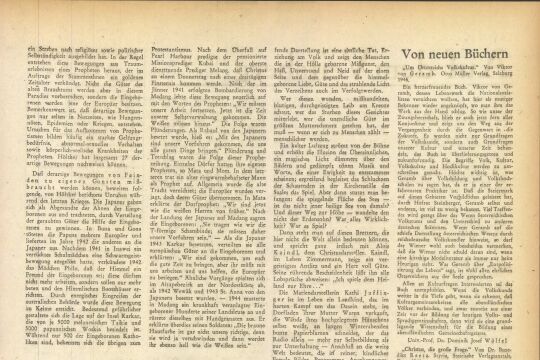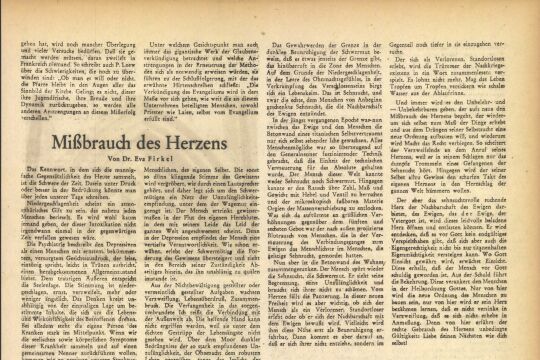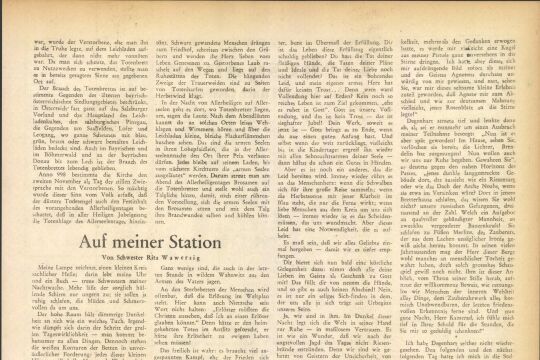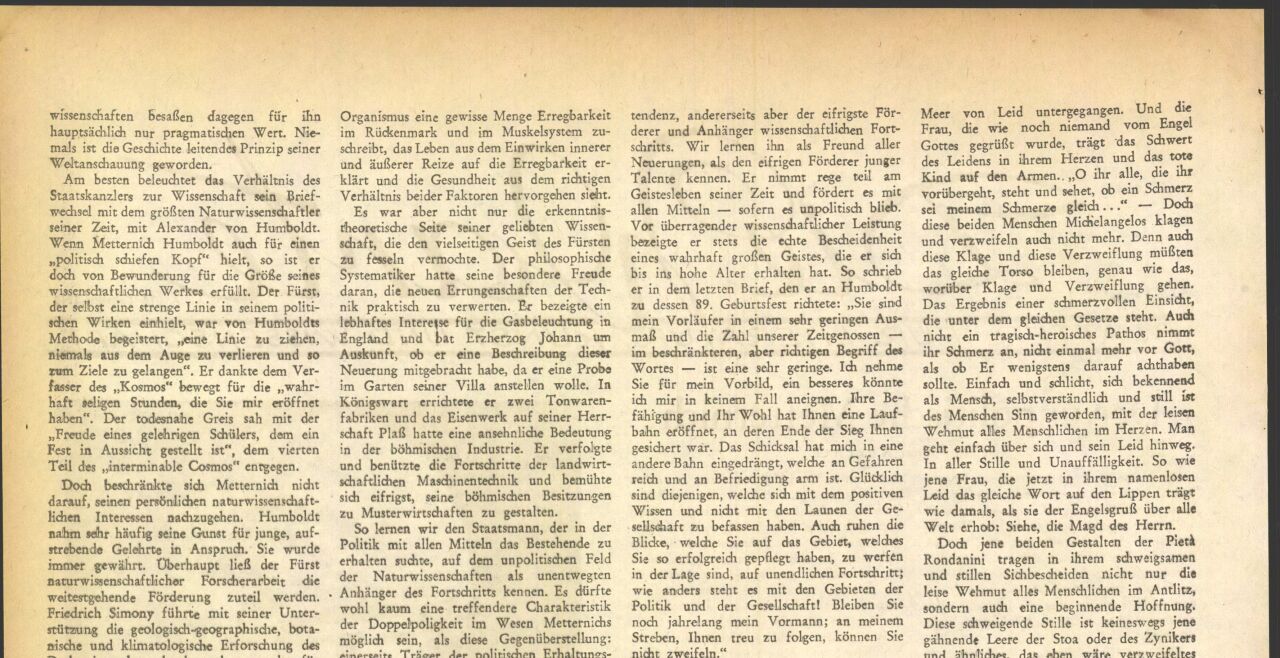
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Pieta Rondanini
Mit den beiden berühmten Statuen des Louvre, dem gefesselten und sterbenden Sklaven, begann eine eigene Schwermut im Werke Michelangelos, die sich dann zu erschütternder Tragik steigerte. Von nun an sind seine kraftvoll herrlichen Gestalten von dieser Tragik gezeichnet. Der jugendliche Schwung und die unproblematische Schönheit etwa der Pietä des Petersdomes, die ihn beinahe über Nacht berühmt gemacht hatte, oder des Siegers erhalten den Unterton einer großen Schwermut, wie das zum Beispiel beim bekannten Moses des Juliusgrabes bereits der Fail ist. Die große Tragik menschlicher Grenzhaftigkeit, das Fragwürdige des menschlichen Lebens und seiner Leistungen erfaßt A schmerzvoller Erfahrung die Seele des Künstlers, worunter er mit dem ganzen, schweren Gemüt eines Melandiolikers leidet, anfangs noch wie in einem sich wild aufbäumenden Schmerz, aber schließlich wird auch dieser Schmerz als vergänglich und bruchstückhaft erlebt und sinkt beinahe in sich zusammen. Die Einsicht, daß der Mensch nichts Vollkommenes zu leisten vermag — und nicht einmal der Sehmerz darüber vermag vollkommen zu sein — macht ihn allmählich stiller.
Michelangelo zerbricht und verzweifelt nicht an diesem menschlichsten aller Leiden, das allem andern zugrunde liegt, er ringt sich vielmehr zu jener Reife durch, wie sie nur das gemeisterte Leid zu geben vermag. So wächst sein großer plastischer Altersstil, von einer unerhörten Einfachheit nnd Schlichtheit. Von ihm zeugen zum Beispiel die beiden Statuen der Rahel und Lea auf dem Grabmal Julius’ II. Weder Resignation noch Verbitterung sind zurückgeblieben. Michelangelo war ganz auf das innerlich und tief Menschliche, das nur noch Menschliche zurückgekommen, in einer unbeschreiblichen, verhaltenen Tiefe, die zugleich seine Größe ist.
Und nun, auf der eigentlichen Höhe seines Lebens angelangt, „spricht er mit klarem Bewußtsein sein Abschiedswort, mit dem er die Welt verlassen hat" (Kriegbaum), in jenem einzigartigen Bildwerk: der Pietä Rondanini. — Sie ist ein Torso geblieben. Da steht der Künstler am Ende seines Lebens, über dem der Glanz des Ruhmes eines der größten Meister liegt, und will noch einmal alles zusammennehmen, was er weiß und erfahren hat — und schafft einen Torso. Nicht einen solchen, wie ihn jugendlicher Sturm und Drang in gewolltem Pathos beabsichtigt, sondern einen in aller Hilflosigkeit und Demut eines Menschen, der nicht mehr anders kann. Der Meißel ist seiner reifen, vom Tod bereits gezeichneten Hand entsunken, so wie sich die ausgereifte Frucht vom Baume löst. Eine namenlose Stille liegt über dem Bild, nichts Lautes ist an ihm, es hat die leise Wehmut alles Menschlichen in den Zügen, vor allem in jenen des unvergleichlichen Mundes Mariens, wie die Kunst keinen zweiten mehr kennt. „Die letzte Vision des greisen Meisters... Die Pieta Rondanini, wie er sie hinterließ,
gehört unter die zeitlosen Werke der Weltkunst, weil sie nichts ist als gestaltete Menschlichkeit...“
Ist es nicht unser menschlichster Besitz? Alles, was wir erreichen können, ist Torso und muß es bleiben. Überall stoßen wir uns an den eigenen Grenzen wund. „Alles, was wir erreichen, ist dazu da, daß wir das Letzte erlangen: das Ende“ (K. Rahner). Und gerade dort, wo wir den besten Willen haben, wo vielleicht eine große Aufgabe oder eine große Liebe unser Herz einnimmt, ausgerechnet dort kommen wir nicht weiter und müssen es am schmerzlichsten empfinden. Wohl unser größtes Leid. Immer wieder pochen unsere Hände, halb verzweifelt oder wild sich auflehnend, an diese Grenze, wenn sie sich so oft wie eine unübersteig- bare Mauer vor uns auftürmt, oder aber sie hängen in zerbrochener Mutlosigkeit hilflos herab. — Da stehen diese beiden still gewordenen Menschen der Pietä. Rondanini, wie sie der beinahe achtzigjährige Greis mit den Augen seines reif gewordenen Herzens geschaut hat, vor uns: die Mutter und ihr Sohn. Sie haben es auch erfahren müssen. Der Mensch, der sich Gottes Sohn nennt und Gottes Reich begründet hat, ist in einem
Meer von Leid untergegangen. Und die Frau, die wie noch niemand vom Engel Gottes gegrüßt wurde, trägt das Schwert des Leidens in ihrem Herzen und das tote Kind auf den Armen.. „O ihr alle, die ihr vorübergeht, steht und sehet, ob ein Schmerz sei meinem Schmerze gleich..." Doch diese beiden Menschen Michelangelos klagen und verzweifeln auch nicht mehr. Denn auch diese Klage und diese Verzweiflung müßten das gleiche Torso bleiben, genau wie das, worüber Klage und Verzweiflung gehen. Das Ergebnis einer schmerzvollen Einsicht, die unter dem gleichen Gesetze steht. Auch nicht ein tragisch-heroisches Pathos nimmt ihr Schmerz an, nicht einmal mehr vor Gott, als ob Er wenigstens darauf achthaben sollte. Einfach nnd schlicht, sich bekennend ab Mensch, selbstverständlich und still Ist des Menschen Sinn geworden, mit der leisen Wehmut alles Menschlichen im Herzen. Man geht einfach über sich und sein Leid hinweg. In aller Stille und Unauffälligkeit. So wie jene Frau, die jetzt in ihrem namenlosen Leid das gleiche Wort auf den Lippen trägt wie damals, ab sie der Engelsgruß über alle Welt erhob: Siehe, die Magd des Herrn.
Doch jene beiden Gestalten der Pieti Rondanini tragen in ihrem schweigsamen und stillen Sich bescheiden nicht nur die leise Wehmut alles Menschlichen im Antlitz, sondern auch eine beginnende Hoffnung. Diese schweigende Stille ist keineswegs jene gähnende Leere der Stoa oder des Zynikers und ähnliches, das eben wäre verzweifeltes oder resigniert-mutloses Sichaufgeben, vielmehr schläft jene Ruhe hinter den geschlossenen Augen, wie sie über unsern Friedhöfen steht: Ruhe in Frieden. Die Stille und Ruhe eben der Pietä: zwischen Kreuz und Ostermorgen. Und diese ganze und g?öße Stille, jene Ruhe in Frieden, bt nur im religiösen Sinn einer Pietä möglich, wovon uns die Geschichte oder besser noch das eigene Herz genügend überzeugt. Jenes Pauluswort steht letztlich dahinter vom Gestorben- und Begrabensein mit Christus zwischen Tod und Auferstehung, zwischen Kreuz und Ostermorgen. — Das wußte auch Michelangelo, sonst hätte er eher eine vor Schmerz über den Tod ihrer Kinder ersteinte Niobe oder die Gracchenmutter Cornelia statt einer I’ietä aus dem Stein gehauen.
Das Menschenleben ist vergänglich und fragwürdig, voller Grenzen und Leid, doch auch voll Hoffen und Harren, Sehnen und Warten. — Oder, um im Sinne des Kirchenjahres zu sprechen, voll Adventsklage über das verlorene Paradies, entsprechend dem Kreuz, und Adventshoffnung auf das Weihnachtsfest, entsprechend dem Ostermorgen. — Ganz still wird man darüber. Doch von jener Stille der Pieta Rondanini, über der bereits Gottes erlösende Schatten ruhen, wie ein Frühvollendeter einmal nach den Stürmen und Festen seines Lebens dichtete:
Und dann stille sein, verschweigen alles Leid und alles Licht, bis sich Gottes Schatten zeigen auf dem Totenangesicht.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!