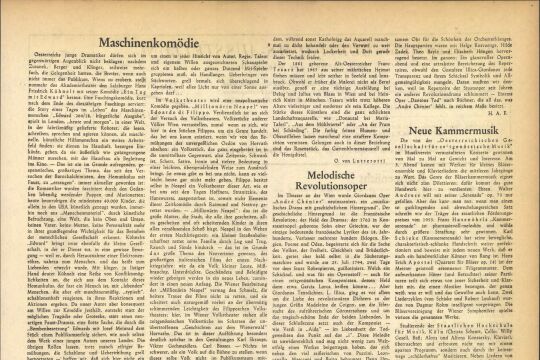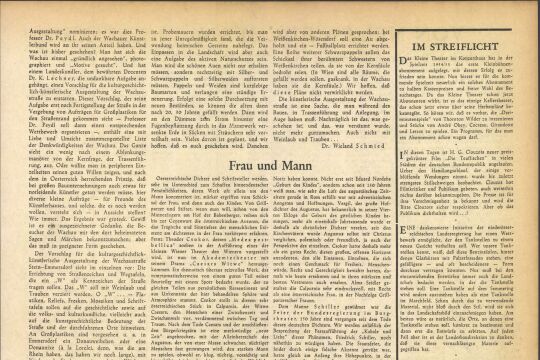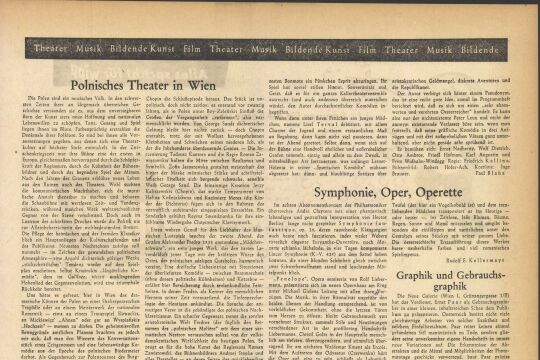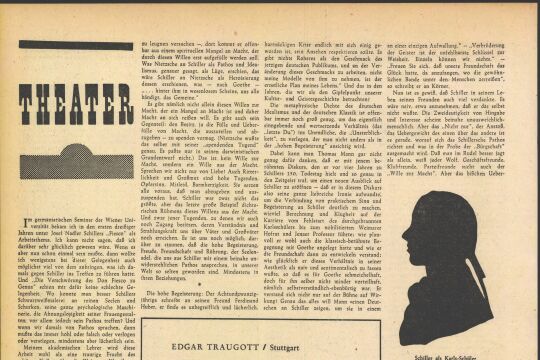Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Schiller im Sauseschritt
„Maria Stuart“ ist das dramaturgisch geschlossenste, makelloseste Drama Schillers. In strenger Architektonik und sorgfältig ausgewogenen Akten entfaltet sich in kürzestem Zeitraum eine fast kriminalistische Handlung, erfüllt sich die Notwendigkeit des Geschehens wie ein zwischen Verurteilung und Hinrichtung ablaufendes Uhrwerk. Ein dunkler Sensationsprozeß der Geschichte wird zur tragischen Fabel um die Verflochtenheit von Menschlichem und Politischem verdichtet. Aber schon in einem Brief an Goethe hatte Schiller angekündigt, daß „Neigung und Bedürfnis“ ihn zu „einem bloß leidenschaftlichen und menschlichen Stoff“ ziehen. Maria Stuart ist denn auch vor allem leidenschaftliches Theater ohne die wertsetzende Weltschau der früheren Dramen: im Grunde eine Tragödie um die Macht des Gefühls, in der die Staatsaktion, die früher alles überblendete, zurücktritt. Daher auch der Eindruck des Lebensvollen und Körperhaften an diesem Werk, das mit völlig neuen künstlerischen Mitteln gestaltet ist. Die beiden geistigen Atmosphären: Elisabeths nüchterner Protestantismus und Marias rauschhaft-reicher Katholizismus umschließen alles, und darum gehören die beiden Hauptfiguren und alle anderen, die neben ihnen als eigenwertig erscheinen und denen Schiller auch reiche Farbe zugewendet hat, in ein und dieselbe Welt.
Schiller spielen, nicht mehr und nicht weniger, ist schwer. Gustav Manker, der Regisseur der Neuinszenierung im Volkstheater (man verdankt ihm eine heute noch unvergessene „Räuber“-Inszenierung) entschied sich, den Hauptakzent nicht auf das Herrscherliche zu legen, sondern das Menschliche hervorzutreiben. Gesteigertes Tempo sollte über das Schillersche Pathos hinweghören lassen. Keine große Charakterentfaltung, keine Zuckungen des Gemüts, sondern Menschen als Bewegungs-punkite des Dramas. Gespielt wird ausschließlich zwischen düsteren hohen Gefängniswänden ohne jegliches Renaissance-Dekor. Marias Gefängnis oder Elisabeths Palast werden nur durch wenige (bewegliche) Requisiten angedeutet. Nichts soll „rühren“ (ganz im Sinne Schillers), nur die „fatale Konkurrenz der Umstände“ soll zutage treten. Denn Schuld und Tragik sind auf beiden Seiten. Unstreitig ein Regiekonzept. Aber um es zu verwirklichen und zugleich Schillern nichts schuldig zu bleiben — dazu brauchte es großer Darsteller. Traute Wassler (Maria) bringt es zu einigen Temperamentausbrüchen. In der Läuterung am Schluß (in der man den Höhepunkt der Beichte gestrichen hat) bleibt sie die ganz nach innen konzentrierte Kraftprobe schuldig. Elisabeth Epp (Elisabeth) spielt die Tragödie des Herrschens auf dieser Welt wenig überzeugend; hinter der Maskenhaf-tigkeit ihrer Züge lebt kein Dämon. Die übrigen Mitwirkenden boten mehr oder minder annehmbares Mittelmaß. Um nur die wichtigsten zu nennen: Aladar Kunrad ist ein etwas unbeteiligter Leicester, Bernhard Hall ein schwärmerisch-unreifer Mortimer (hier hätte man ruhig etwas vom Text streichen können), Joseph Hendrichs ein würdiger Shrewsbury, Ernst Meister der eiskalte Eiferer Burleigh. Es war eine der kürzesten Schiller-Aufführungen. Das Publikum spendete lebhaften Beifall.
Im Theater an der Wien bringt ein Gastspiel des „Grünen Wagens“ die Salonkomödie „Caroline“ von Somerset Maugham. Nicht gerade eines seiner besten, aber ein unterhaltsames Stück. Er hat immer genau gewußt, was die Leute gern sehen. Und sie sehen es heute noch gern, das Geplänkel um eine attraktive Frau, die umschwärmt wird, und als sie Witwe geworden ist, in die größte Verlegenheit gerät, einen der langjährigen Verehrer wirklich zu heiraten. Hilde Krahl und Karl Schönböck in den Hauptrollen, aber auch alle anderen in den Nebenrollen bieten (unter der sicheren Regie von Gerhard Metzner) einen Abend ungetrübter Unterhaltung.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!