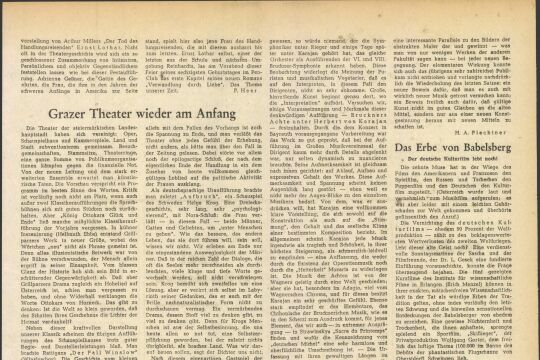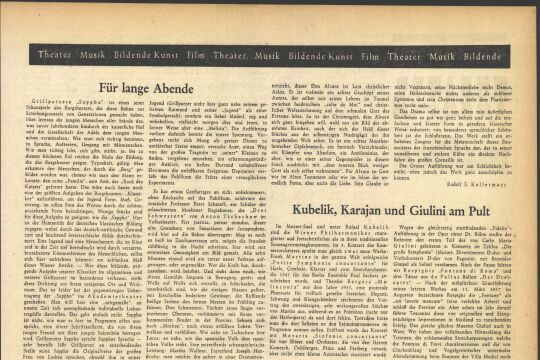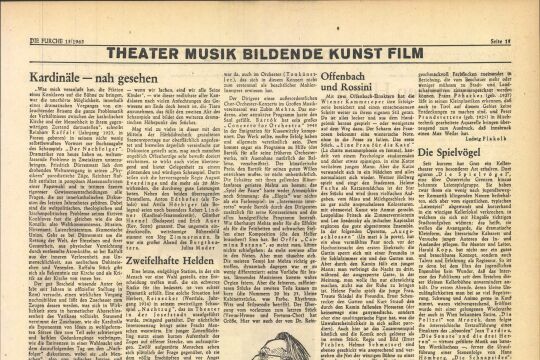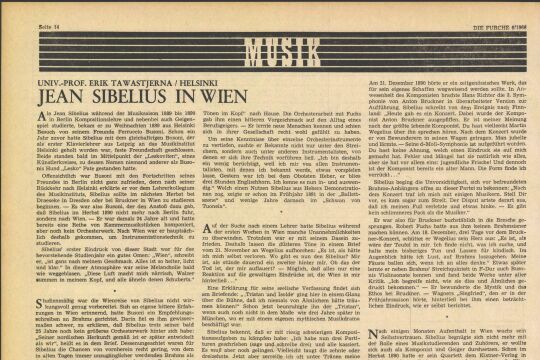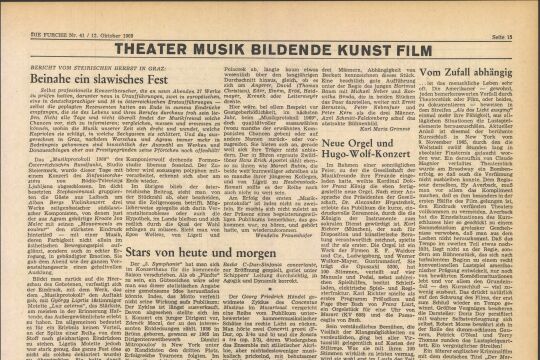Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Apostel, Grieg, Sibelius
Das Konzert der Wiener Symphoniker unter der Leitung von Peter Keuschnig begann mit den Haydn-Variationen von Hans Erich Apostel. Das bereits 1949 komponierte 22-Minuten-Werk hat sich in diesen letzten zwanzig Jahren als durchaus wertbeständig erwiesen. Seine Tonsprache, die man als freie Atonalität bezeichnen könnte, ist der des Berg-schen „Wozzeck“ verwandt, und so wie dieser klingt die Musik von Apostel, je öfter man sie hört, von Mal zu Mal, von Jahrfünft zu Jahrfünft etwa, immer schöner, immer harmonischer. Nach der „Durchhörbarkeit“ dieser Aufführung zu urteilen, ist das Stück auch gründlich geprobt worden. Edvard Griegs (einziges) Klavierkonzert a-Moll wurde 1869 in Kopenhagen uraufgeführt, ist also etwas über 100 Jahre alt. Aber die Zeit ist ihm nicht gut bekommen. So schätzenswert Grieg in seinen Kleinformen ist, besonders im folkloristischen Genre, so hörbar versagt sich ihm die große Form. Daß vieles in diesem etwa 40 Minuten dauernden Werk bombastisch-hohl, zuweilen auch etwas kitschig wirkt, ist auch der wenig differenzierten Instrumentierung zuzuschreiben. Den mit bedeutenden Schwierigkeiten ausgestatteten Solopart spielte mit vollendeter Technik und bemerkenswerter Anschlagskultur der junge Brasilianer Nelson Freire, der u. a. an der Wiener Akademie ausgebildet wurde und trotz seiner 26 Jahre bereits mehrere internationale Preise gewonnen hat. Danach hat er in der halben Welt konzertiert, wie das heute üblich ist. Trotzdem repräsentiert er nicht den Typus des Tastenvirtuosen, sondern eher jenen eines poesievollen jungen Musikers, dessen Eigenwilligkeiten es dem begleitenden Dirigenten nicht immer ganz leicht machten. Was an künstlerischer Substanz in ihm steckt, ist nach der Interpretation Griegs nicht mit Sicherheit zu beurteilen.
Das gutbesuchte Konzert wurde mit der 2. Symphonie von Jan Sibelius beendet, die, im Jahr 1901 komponiert, volle 45 Minuten dauert. Ihrem poetischen Zauber kann man sich kaum entziehen, auch wenn die geringe Qualität als Komposition mehr als einmal spürbar wird. Trotzdem muß man sagen, daß Sibelius bei uns allzu gering eingeschätzt und zu sehr vernachlässigt wird. Es gibt eine Erklärung dafür, die sogenannte Bruckner-Sibelius-Linie, d. h.: in jenen Ländern, wo Sibelius hochgeschätzt wird, kennt man — oder kannte man bis vor kurzem — Bruckner kaum, und wo es einen Bruckner-Kult gibt, glaubt man, auf Sibelius verzichten zu können. Es mag daher den Dirigenten Keuschnig, der bisher mehr auf neue und neueste Musik spezialisiert war, gereizt haben, sich einmal an etwas so ganz anderem zu versuchen: an einem monumentalen, nachromantischen Landschaftsgemälde, das von den Wiener Symphonikern nicht nur in kräftigen, sondern auch in außerordentlich schönen Farben nachgezeichnet wurde.
Helmut A. Fiechtner
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!