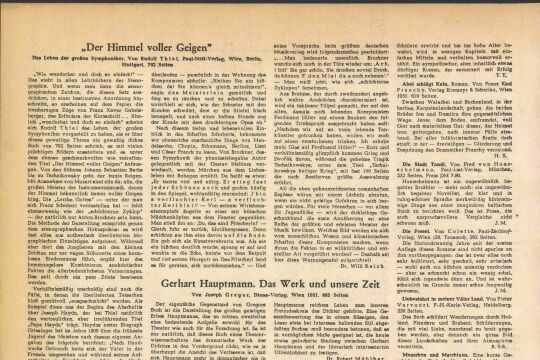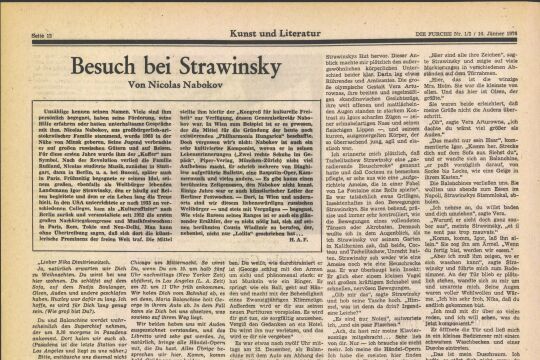Ala Jean Sibelius während der Musiksaison 1889 bis 1890 in Berlin Kompositionslehre und nebenbei auch Geigenspiel studierte, bekam er zu Weihnachten 1889 aus Helsinki Besuch von seinem Freunde Ferruccio Buisoni. Schon ein Jahr zuvor hatte Sibelius mit dem gleichaltrigen Busoni, der als erster Klavierlehrer aus Leipzig an das Musikinstitut Helsinki geholt worden war, feste Freundschaft geschlossen. Beide standen bald im Mittelpunkt der „Leskoviten”, eines Künstlerkreises, zu dessen Namen niemand anderer als Buso- niis Hund „Lesko” Pate gestanden hatte.
Offensichtlich war Busoni mit den Fortschritten seines Freundes in Berlin nicht ganz zufrieden, denn nach seiner Rückkehr nach Helsinki erklärte er vor dem Lehrerkollegium des Musikinstituts, Sibelius sollte im nächsten Herbst bei Draeseke in Dresden oder bei Bruckner in Wien zu studieren beginnen. — Es war also Busoni, der den Anstoß dazu gab, daß Sibelius im Herbst 1890 nicht mehr nach Berlin fuhr, sondern nach Wien. — Er war damals 24 Jahre alt und hatte bereits eine Reihe von Kammermusikstücken komponiert, aber noch kein Orchesterwerk. Nach Wien war er hauptsächlich deshalb gekommen, um Instrumentationstechnik zu studieren.
Sibelius’ erster Eindruck von dieser Stadt war für das bevorstehende Studienjahr ein gutes Omen: „Wien”, schreibt er, „ist ganz nach meinem Geschmack. Alles ist so heiter, licht und klar.” In dieser Atmosphäre war seine Melancholie bald wie weggeblasen. „Diese Luft macht mich närrisch, Walzer summen in meinem Kopf, und alle ähneln denen Schuberts.”
Studienmäßig war die Wienreise von Sibelius nicht wirkungsvoll genug vorbereitet. Sich an eigene bittere Erfahrungen in Wien erinnernd, hatte Busoni ein Empfehlungsschreiben an Brahms gerichtet. Darin fiel es ihm gewissermaßen schwer, zu erklären, daß Sibelius trotz seiner bald 25 Jahre noch kein größeres Orchesterwerk hinter sich habe: „Seiner nordischen Herkunft gemäß ist er später entwickelt als wir”, heißt es in dem Brief. Dessenungeachtet waren für Sibelius die Chancen von vornherein recht gering, von dem in alten Tagen immer unzugänglicher werdenden Brahms als Schüler angenommen zu werden. Auch Anton Bruckner, der zweite Musikgewaltige, zag sich immer mehr aus der Welt zurück. „Bruckner ist sterbenskrank”, berichtet Sibelius seiner Verlobten Aino Järnefelt nach Finnland. Er wartete ungeduldig auf ein Empfehlungsschreiben von Martin Wegelius, dem Direktor des Helsinkier Musikinstituts, an den berühmten Wagner-Dirigenten Hans Richter. Dieser empfing ihn dann auch freundlich, doch er verwies ihn an Robert Fuchs, den Professor für Kompositionslehre am Wiener Konservatorium. „Da können Sie überhaupt den besten Unterricht bekommen”, lautete sein Rat. — Unschlüssig telegraphierte Sibelius an Wegelius und bat ihn um Hilfe. Als Antwort kam ein Brief an Karl Goldmark, der nach dem Welterfolg seiner „Königin von Saba” gerade das größte Ansehen genoß. Sibelius erfuhr von einem Musikhändler, Goldmark würde sich beim Komponieren oft völlig abschließen. Tagelang belagerte er die Wohnung Goldmarks und glaubte ihn einmal, wie er schreibt, in seinen Gemächern „schreien und toben” zu hören.
Am 12. November 1890 wurde Sibelius bei Goldmark endlich vorgelassen. Der gefeierte Opernkomponist kam ihm im Schlafrock auf bloßen Strümpfen entgegen. „Treten Sie näher, treten Sie näher!” Wahrscheinlich war Goldmark von der Ehrerbietigkeit und dem sensiblen Antlitz seines Besuchers ebenso stark beeindruckt wie von dem Empfehlungsschreiben des Institutsleiters Wegelius. Goldmark erkärte, er habe jahrelang schon keine Schüler mehr gehabt, er wolle sich aber trotzdem die Kompositionen von Sibelius ansehen und ihm nötigenfalls Anleitungen geben. Sibelius hatte sein Quartett in B-Dur bei sich, dais Goldmark aber keines Blik- kes würdigte. Der beste Rat, den Goldmark seinem finnischen Lehrjungen geben konnte, war, er möge Mozarts Orchesterwerke studieren und besonderes Augenmerk dem Verhalten der Klarinette zu den übrigen Instrumenten schenken.
Schon in den ersten Tagen seines Wienaufenthaltes hörte Sibelius in der Hofoper den „Don Giovanni”. Begeistert und angeregt von der Vorstellung, saß er die ganze Nacht über der Partitur zu einem Violinkonzert. Für Goldmark schrieb er innerhalb einer Woche eine 38 Seiten lange Ouvertüre, die er am 19. November dem Meister vorlegte. Darüber berichtet er Wegelius: „Ich komme eben von Goldmark. Habe eine Ouvertüre komponiert. Da gibt es nach Goldmarks Worten manches Schlechte und manches Gute. Als Anfang ist sie jedoch ganz gut”. Die Instrumentierung ist bis auf eine Stelle, wo die Flöten allzu wild sind, völlig richtig. Er kritisierte dann die Ouvertüre eingehender. Eine halbe Stunde war ich bei ihm. Er bestätigte mir schriftlich meine Anmeldung. Weißt Du, er steht hier in verdammt gutem Ruf. Als sein Schüler genieße ich ja überall Ansehen. — Ein Unterricht ganz nach meinem Geischmack!”
Sibelius war von dem scharfen jüdischen Intellekt Goldmarks, von seinem Skeptizismus ebenso stark beeindruckt wie von seiner weltmännischen und doch leutseligen Art, zu der sich allerdings auch schonungslose Aufrichtigkeit gesellen konnte. Ein überragender Pädagoge war Goldmark zwar nicht, er gab aber die großen Richtlinien an. Um das rein Handwerksmäßige kümmerte er sich wenig. Deshalb meldete sich Sibelius, auf den Rat Richters, als Schüler bei dem Brahms-Jünger Robert Fuchs am Konservatorium an. Sibelius berichtet über seinen Unterricht bei Fuchs nichts Näheres, er beschränkt sich nur auf Feststellungen, ob sein Lehrer zufrieden war oder nicht. Viel deutet darauf hin, daß Fuchs konservativer war und einen su’ tileren Geschmack hatte als Goldmark.
Sibelius widmete sich wieder ernsthaft dem Geigenspiel. Er wurde am Konservatorium Mitglied des unter Leitung von Robert Fuchs stehenden Schülerorchesters. Von den Proben kam er, wie er schreibt, „mit Schmerzen und falschen
Tönen im Kopf” nach Hause. Die Orchesterarbeit mit Fuchs gab ihm einen bitteren Vorgeschmack auf den Alltag eines Berufsgeigers. — Er lernte neue Menschen kennen und schien sich in ihrer Gesellschaft recht wohl gefühlt zu haben.
Um seine Kenntnisse über einzelne Orchesterinstrumente zu vertiefen, suchte er Bekannte nicht nur unter den Streichern, sondern auch unter anderen Instrumentaliisten, von denen er sich ihre Technik vorführen ließ. „Ich bin deshalb ein wenig berüchtigt, weil ich mir von allen Instrumen- talisten, mit denen ich bekannt werde, etwas Vorspielen lasse. Gestern war ich bei dem Oboisten Heber, er blies drei Stunden Englischhorn. Ich kenne es nun in- und auswendig.” Welch einen Nutzen Sibelius aus Hebers Demonstrationen zog, zeigte er schon im Frühjahr 1891 in der „Ballett- iszene” und wenige Jahre darnach im „Schwan von Tuonela”.
Auf der Suche nach einem Lehrer hatte Sibelius während der ersten Wochen in Wien manche Unannehmlichkeiten zu überwinden. Trotzdem war er mit seinem Dasein zufrieden. Deshalb lassen die düsteren Töne in einem Brief vom 21. November an Wegelius aufhorchen: „Es ist, als hätte ich mich selbst verloren. Wo gibt es nun den Sibelius? Mir ist, als stünde dauernd ein zweiter hinter mir. Ob das der Tod ist, der mir auflauert? — Möglich, daß alles nur eine Reaktion auf die gewaltigen Eindrücke ist, die Wien in mir hinterließ…”
Eine Erklärung für seine seelische Verfassung findet sich am Briefende: „ ,Tristan und Isolde ging hier in einem Glanz über die Bühne, daß ich niemals von Ähnlichem hätte träumen können!” Schon jetzt beunruhigte ihn der „Tristan”, wenn auch noch nicht in dem Maße wie drei Jahre später in München, wo er mit einem eigenen mythischen Musikdrama beschäftigt war.
Sibelius bekennt, daß er mit riesig schwierigen Kompositionsaufgaben zu kämpfen habe: ,,Ich habe nun drei Partituren geschrieben (sage und schreibe drei) und alle kassiert. Es muß aber noch gelingen. Vielleicht taugt die zehnte oder dreizehnte. Jetzt aber zerreiße ich oft unter Tränen meine musikalischen Konzepte.” — Goldmark ging völlig in seiner eigenen Arbeit auf. Empfing er Sibelius, was nicht immer geschah, so konnte er ihn mit wenigen Worten abspeisen. Indigniert schreibt Sibelius anfangs Jänner 1891 nach Helsinki: „Sein einziges Urteil über einen Symphoniesatz war: ,Die Themen kommen nicht zur Geltung.” — Nichts weiteres. Du begreifst nun, daß ich als Anfänger in der Instrumentation einen weniger genialen Lehrer hätte haben sollen. Vor drei Wochen kam er auf die Idee, ich solle eine Cellosonate umarbeiten, und er sagte dazu: ,Bitte, mein Lieber, mich zu schonen, etwa einen Monat. Bringen Sie mir dann etwas Fertiges und Tüchtiges.” Das werde ich übrigens tun.”
Aus Briefen vom Herbst 1890 an Aino Järnefelt kann ein ständig wachsendes Interesse für alles Finnische herausgelesen werden, für die finnische Sprache und das Nationalepos
„Kalevala”. — „Ich lese eifrig im Kalevala und verstehe Finnisch bereits viel besser. Dieses ,soitto on murehista tehty” aus dem Kalevala — auf deutsch: ,Die Klänge sind aus der Trauer gehoben” — ist doch großartig.” Der Stimmungsgehalt des Kalevala sollte bei Sibelius langsam musikalische Formen annehmen. Ihm begann ein nationaler Musikstil vorzuschweben.
Die internationale Metropole Wien inspirierte ihn nicht nur zu einer Synthese unterschiedlicher Komponenten, sondern auch — und dies mag paradox klingen — zur bewußten Pflege des rein Nationalen. In seinem Lehrer Goldmark sah Sibelius einen Vertreter der Synthese, Fuchs dagegen vertrat — mit einer Neigung zu Schuhmannscher Schwärmerei — die Tradition der Wiener Klassik und des betont österreichischen. Sibelius besuchte regelmäßig die von Hans Richter dirigierten philharmonischen Abonnementkonzerte.
Am 21. Dezember 1890 hörte er ein zeitgenössisches Werk, das für sein eigenes Schaffen wegweisend werden sollte. In Anwesenheit des Komponisten brachte Hans Richter die 3. Symphonie von Anton Bruckner in überarbeiteter Version zur Aufführung. Sibelius schreibt von dem Ereignis nach Finnland: „Heute gab es ein Konzert. Dabei wurde der Komponist Anton Bruckner ausgepfiffen. Er ist meiner Meinung nach der größte lebende Komponist. Du hast vielleicht Martin Wegelius über ihn sprechen hören. Nach dem Konzert wurde er von Bewunderern in seinen Wagen getragen. Man jubelte und lärmte. — Seine d-Moll-Symphonie ist auf geführt worden. Du hast keine Ahnung, welch einen Eindruck sie auf mich gemacht hat. Fehler und Mängel hat sie natürlich wie alles, aber sie hat vor allem eins: jugendliche Frische! Und dennoch ist der Komponist bereits ein alter Mann. Die Form finde ich verrückt…”
Sibelius beging die Unvorsichtigkeit, sich vor befreundeten Brahms-Anhängern offen zu dieser Partei zu bekennen: „Nach dem Konzert traf ich mich mit einigen Musikern. Stell Dir vor, es kam sogar zum Streit. Der Disput artete derart aus, daß ich meinen Fuß verletzte und etwas hinke. — Es gibt kein schlimmeres Pack als die Musiker.”
Er war also für Bruckner buchstäblich in die Bresche gesprungen. Robert Fuchs hatte aus ihm keinen Brahmsianer machen können. Am 18. Dezember, drei Tage vor dem Bruck- ner-Konzert, schüttet er Wegelius sein Herz aus: „Es ist, als wäre der Teufel in mir. Ich finde nicht, was ich suche, und halte mein bisheriges Tun und Lassen für kindisch. Im Augenblick hätte ich Lust, auf Brahms loszugehen. Meine Fäuste ballen sich, wenn ich an alles denke.” Etwas später lernte er neben Brahms’ Streichquintett in F-Dur auch Busonis Violinsonate kennen und fand beide Werke unter aller Kritik. „Ich begreife nicht, wie sie dies und Ähnliches gedruckt bekommen.” — Er bewunderte die Mystik und das Ethos bei Bruckner. — Wagners „Siegfried”, den er in der Frühjahrssaison hörte, hinterließ bei ihm einen beträchtlichen Eindruck, wie er selbst berichtet.
Nach einigen Monaten Aufenthalt in Wien wuchs sein Selbstvertrauen. Sibelius begnügte sich nicht mehr mit der Rolle eines Musikstudierenden und Zuhörers, er wollte sich auch als Komponist und Geiger durchsetzen. Schon im Herbst 1890 hatte er sein Quartett dem Kistner-Verlag in Leipzig angeboten. Es kam aber von dort zurück. — In Wien machte ihn sein Freund Christoph mit einem Kammermusikensemble bekannt, in dem der begabte Aloiis Rosenberg die erste Violine spielte, Christoph selbst die zweite. In diesem Rosenberg-Quartett bewährte eich Sibelius als Kammermusiker und stand auch bald als Geiger in ziemlich gutem Ruf. Mit Rosenberg befreundete er sich. Nun begann er daran zu arbeiten, sein B-Dur-Quartett zuerst im Konservatorium und dann im Tonkünstlerverein aufgeführt zu bekommen. Er wußte sehr wohl, daß er als junger Musiker aus einem entlegenen, unbekannten Land auf Mißtrauen stoßen würde und daß sein Werk für den ausgeprägt konservativen Geschmack der Wiener allzu avanciert war.
Außerdem wollte er als Geiger bei den Philharmonikern aufgenommen werden und übte nun fleißiger denn je, um für das Probevorspiel gerüstet zu sein. Am 8. Jänner 1891 machte er seine Aufwartung bei dem mächtigen Professor Grün, der ihn für den nächsten Tag zur Prüfung bestellte. Sibelius fand ihn steif und unzugänglich, von sich selbst berichtet er, daß er zur Salzsäule erstarrt sei. Wahrscheinlich waren aber beide Herren ebenso liebenswürdig und zuvorkommend. Am 9. Jänner trat Sibelius vor die Rampe der Wiener Oper. Er spielte zuerst vor Grün allein, dann vor der gesamten Operndirektion und wirkte anschließend bei einer Orchesterprobe mit. Schon der Umstand, daß ihn Grün nicht gleich zum Tempel hinausjagte, ist ein Beweis dafür, wie sehr sein Können Anklang gefunden hatte. Sibelius war aber als Sologeiger zuletzt vor mehr als zwei Jahren aufgetreten — und so hielten seine Nerven der Zerreißprobe nicht stand. Nach einer Stunde wurde ihm totenübel, er bekam „Metallgeschmack im Munde”, berichtet er später, er zitterte am ganzen Leibe und war einer Ohnmacht nahe. Trotzdem fand Grün, daß er „gar nicht schlecht” gespielt habe. Seiner Nerven wegen riet er ihm aber mit Bestimmtheit davon ab, sich der Geige zu verschreiben. „Lernen Sie Klavier spielen, Sie sind doch Komponist”, war sein wohlmeinender Rat. Nach dem Probevorspiel setzte sich Sibelius weinend an den Flügel und begann Tonleitern zu üben. An Wegelius schrieb er: „Es gibt etwas in mir, was mich einmal befähigt, Großes zu leisten.”
Auch der Aufführung des B-Dur-Quartetts widersetzte eich Grün. Sibelius fiel es wie Schuppen von den Augen, er war zutiefst enttäuscht und fühlte sich selbst härter und kälter werden. Mit einem Schlage erlebte er die Einsamkeit und schwerere Lebensart des nordischen Menschen und das unbeschwertere „Wiener Gemüt” als quälenden Kontrast. „Die Deutschen glauben”, so klagt er, „daß der Pessimismus in Rußland und im Norden beheimatet sei. Sie dürften damit recht haben.” In seinem Künstlerkreis war der Norden immer schon ein diffuser Begriff gewesen. Man hielt ihn für einen Landsmann von Grieg, und als im Frühjahr Svendsens dürftiges Oktett in Wien gespielt wurde, war Sibeldus bei manchen die Zielscheibe giftigen Spottes gewesen. Diskussionen arteten häufig in Streitgespräche aus, die von seiten der Kollegen mit einem überlegenen „Was sind Sie eigentlich?” beendet werden konnten. Nur Alois Rosenberg ergriff seine Partei. Doch irgendwie gefiel es Sibelius, allein zu stehen gegen alle.
Zur Aufführung seines B-Dur-Quartetts hatte Rosenberg zwei Proben angesetat. Das erste Mal spielte man vom Blatt. Sibelius berichtet darüber: „So viel vermochten sie doch aus dem Quartett herauszuholen, daß es sie in Staunen versetzte. Und das freute mich bis in die Seele hinein. — Danach waren sie recht kleinlaut.” Es gab natürlich „blutige” Kritik, fügt er hinzu. Bei der zweiten und letzten Probe übernahm Sibelius die zweite Violine. Nach dem Konzert gab das Rosenberg-Quartett zu seinen Ehren ein Fest. In der Nacht schrieb er in sonderbarer, fast feierlicher Stimmung unter anderem: „Es war, als hätte mich jemand belohnen wollen für alles, was ich gelitten habe während meines ganzen Lebens.”